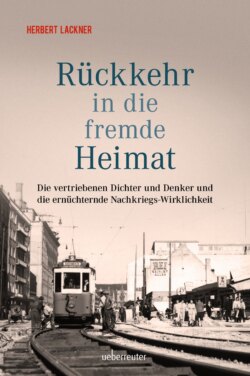Читать книгу Rückkehr in die fremde Heimat - Herbert Lackner - Страница 7
Los Angeles Mai bis Dezember 1945 „NEIN, ES IST KEIN GROSSES VOLK“
ОглавлениеThomas Mann rechnet mit den geschlagenen Deutschen ab, Alfred Polgar glaubt nicht an deren Schuldeinsicht – Franz Werfel stirbt – Und dann explodiert die erste Atombombe
Am 8. Mai 1945, dem Tag des Endes des Zweiten Weltkriegs, schreibt Bertolt Brecht in sein „Arbeitsjournal“: „Früh um sechs Uhr im Radio hält der Präsident eine Ansprache. Zuhörend betrachte ich den blühenden kalifornischen Garten.“
Brecht ist zunächst fassungslos, dass es gelang, dieses bestialische Regime niederzuringen, das fast ganz Europa und sogar Teile Afrikas erobert hatte.
Der in Los Angeles zunehmend depressive Feuilletonist Alfred Polgar macht sich in diesem Mai 1945 Gedanken über die Resozialisierbarkeit seiner Landsleute, die anfeuernd dabeigestanden waren, als man die Juden in Wien die Gehsteige schrubben ließ. Er hat wenig Illusionen: „Um einen Übeltäter zu bessern, muss man ihm vor allem einmal zum Bewusstsein verhelfen, daß, was er getan hat, übel war. Bei den Nazis wird man aber auf Schwierigkeiten stoßen: Vergebliches Bemühen, ihnen einleuchten zu wollen, daß es hässlich ist, wehrlosen Nebenmenschen die Nieren aus dem Leib zu treten; sinnlos, ihnen bekannt zu geben, daß ihr Brauch, Juden zu zehntausenden in Gaskammern zu sperren und sie hernach, tot oder halbtot, zu Dungmittel für die heilige deutsche Erde zu verkochen, bei sehr vielen Leuten, sogar Antisemiten, Indignation hervorruft.“
Thomas Mann verfolgt in den letzten Kriegstagen fieberhaft die Ereignisse in Europa. Jedes Gerücht trägt er in sein Tagebuch ein: Göring sei schon tot, glaubt er Ende April 1945. Hitler sei in Dänemark, und zwar entweder verwundet oder von einem Schlaganfall niedergestreckt. In sterbendem Zustand habe man ihn nach Österreich gebracht, notiert Mann zwei Tage vor dem Selbstmord Hitlers in dessen Berliner Führerbunker. In München sei Revolution ausgebrochen, schreibt er einen Tag später. Außenminister Joachim von Ribbentrop sei von „deutschen Partisanen“ festgenommen worden. Hitler sei wahrscheinlich nach Argentinien entkommen.
In seinem Urteil über die geschlagenen Deutschen ist Thomas Mann trotz der Unklarheit der Lage jedenfalls unbeirrbar: „Wildeste Brutalität im Siege, Gewimmer und Appell an Generosität und Gesittung in der Niederlage. Nein, es ist kein großes Volk.“
In einem offenen Brief mit dem Titel „Warum ich nicht nach Deutschland zurückkehre“ vertritt Mann im Herbst 1945 seine Kollektivschuld-These erstmals auch öffentlich: Der Nationalsozialismus sei „die politische Erfüllung von Ideen, die seit mindestens eineinhalb Jahrhunderten im deutschen Volk und in der deutschen Intelligenz rumoren.“ Thomas Mann nimmt sich dabei explizit nicht aus und er weiß, warum: Seine Kriegs-Trunkenheit im Jahr 1914, sein Glaube an die Sendung des Deutschtums, das, wie er damals meinte, mit demokratischen Grundsätzen, wie sie in den USA und England galten, nicht vereinbar sei – das alles hatte auch in ihm rumort. Aber inzwischen hat er den Irrtum erkannt. Mitleid mit diesen Deutschen hat er dennoch nicht. Selbst die Bombardierung deutscher Städte hatte ihn nicht gerührt: „Alles muss bezahlt werden.“
Die Reaktion in Deutschland folgt schon in den ersten Monaten nach Kriegsende. In der „Neuen Westfälischen Zeitung“ heißt es: „Wir können uns mit einer ganzen Welt versöhnen, aber nicht mit Thomas Mann. Dieser weiß nichts vom Leide. Darum hasst er uns und beschmutzt uns, denn er spürt nicht dort in der Ferne, daß wir durch das Leid tiefer, wesentlicher, menschlicher geworden sind, als er es ist, daß wir ihm überlegen sind, auch wenn wir unterlagen. Was weiß er überhaupt von Deutschland, obwohl er ein Deutscher ist? Nichts! Es gibt keine Brücke von uns zu ihm.“
Das hatte Thomas Mann natürlich nicht bedacht: Dass sich die Deutschen nun selbst als Opfer fühlten! Viele von ihnen hatten zuerst ja profitiert, als sie die Wohnungen der vertriebenen Juden plünderten, als der Nazi-Staat Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie schuf, als mit Raubgut „Kraft durch Freude“-Ausflüge finanziert wurden. Aber dann kamen die Bombenangriffe, der Verlust von Angehörigen an der Front, die Vergewaltigungen durch Rotarmisten, der Hunger, die Obdachlosigkeit. Man habe genug gebüßt, meinen nun auch Thomas Manns Leser, die den „Zauberberg“, die „Buddenbrooks“ und den „Tod in Venedig“ geliebt hatten und die litten, als seine Bücher 1933 auf die Scheiterhaufen der Nazis geworfen wurden.
Alma Mahler-Werfel schreibt zu Kriegsende gar nichts in ihr Tagebuch. Politik interessiert sie wenig, sie liebt nur das politische Spektakel. Am 12. Februar 1934 war sie mit einer Flasche Champagner begeistert vor ihrer Villa auf der Hohen Warte in Wien-Döbling gestanden und hatte zugesehen, wie das von den Austrofaschisten kommandierte Bundesheer von dieser Anhöhe aus den nahen Karl-Marx-Hof beschoss, wo sich sozialdemokratische Schutzbündler verschanzt hatten. Sieben Jahre zuvor hatte sie noch auf einer Prominenten-Liste gemeinsam mit Sigmund Freud, Robert Musil, Alfred Polgar und Franz Werfel zur Wahl der Sozialdemokraten aufgerufen – wohl eher um dem damals noch „linken“ Werfel eine Freude zu machen als aus Überzeugung.
Erst am 10. Mai 1945, fast einen Monat nach der Befreiung Wiens und zwei Tage nach der Unterzeichnung der Kapitulation Nazi-Deutschlands, kramt Alma ihr Tagebuch wieder hervor. Aber in ihrem Eintrag geht es vor allem um den Nachruhm ihres ersten Gatten: „Erste Nachricht aus Wien: Am 3. Juni wird Gustav Mahlers 1. Symphonie nach sieben Jahren wieder zur Aufführung in Wien gelangen. Vor Beginn wird im Konzerthaus eine Gedächtnistafel mit folgender Inschrift enthüllt werden: ‚Zum Andenken an das historische Datum der Wiedererweckung Gustav Mahlers in Wien.‘“
Alma kennt nicht den Hintergrund dieser Aufführung. Die sowjetischen Militärbehörden hatten den berühmten Wiener Dirigenten Clemens Krauss festgenommen und ihn genötigt, dieses Mahler-Konzert mit den Wiener Philharmonikern zu dirigieren. In einem internen Papier der US-Besatzungsmacht heißt es dazu: „Der Pro-Nazi-Dirigent, der sich in der Vergangenheit geweigert hat, ‚nicht-arische‘ Musik aufzuführen, wurde gezwungen, sein Programm mit einer Mahler-Symphonie zu beginnen, später musste er auch eine Gedenktafel zu Ehren des jüdischen Komponisten enthüllen.“
Damit wird Krauss Unrecht getan: Er spielte in den 1930er-Jahren mit den Wiener Philharmonikern immer wieder Mahlers Musik. Nach 1939 war er aber tatsächlich einer der Lieblingsdirigenten der NS-Größen. Das erste Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker gab es mit Clemens Krauss am Pult am 31. Dezember 1939 zu Gunsten der NS-Kriegs-Winterhilfswerks. Von 1939 bis 1942 leitete Clemens Krauss die Salzburger Festspiele, bis 1945 stand er dem Mozarteum vor und trug den pompösen Titel „Reichskultursenator“.
Der wohl berühmteste Dirigent dieser Zeit, der ebenfalls in die USA geflohene Arturo Toscanini – ein glühender Antifaschist, der schon Mussolini die Stirn geboten hatte –, legt 1945 ein gutes Wort für Clemens Krauss ein. Es bleibt wirkungslos. Nach dem ersten Konzert im Juni 1945 hat Krauss zwei Jahre lang Auftrittsverbot.
Alma Mahler-Werfel hat in diesem Sommer 1945 andere Sorgen: Franz Werfel geht es gesundheitlich nicht gut. Am 17. August wirft ihn ein weiterer Herzanfall nieder. Eine Woche später hat er sich einigermaßen erholt und besucht mit Alma und Bruno Walter das Nobelrestaurant „Romanoff’s“, in dem auch Alfred Hitchcock gerne tafelt. Am Morgen danach fühlt sich Franz Werfel so prächtig, dass er mit Alma Reisepläne schmiedet: London, Wien, Rom und Prag wollen sie besuchen. In London lebt Almas Tochter Anna Mahler, Wien ist ihre Heimatstadt, Rom lieben sie und in Prag wurde Franz Werfel geboren.
Am Abend desselben Tags findet ihn Alma am Boden neben seinem Schreibtisch. Der 55-Jährige hat einen weiteren Herzinfarkt erlitten und ist von seinem Stuhl geglitten. Wiederbelebungsversuche des herbeigerufenen Arztes bleiben erfolglos.
„Schmerzlich und schwer“, notiert Thomas Mann nach einem Kondolenzbesuch bei Alma in sein Tagebuch.
Zur Trauerfeier im Pierce Brothers Bestattungsinstitut in Berverly Hills kommen Igor Strawinski, Thomas und Heinrich Mann, Arnold Schönberg und viele andere Größen des vertriebenen europäischen Geisteslebens. Lotte Lehmann, am Klavier begleitet von Bruno Walter, singt Schubert-Lieder – selten gab es ein prominenter besuchtes Begräbnis.
Auf die Witwe wartet man vergeblich. Sie gehe nie zu solchen Anlässen, erklärt Alma Anrufern.
Der von ihr instruierte Trauerredner, ein katholischer Pater, murmelt etwas von einer „Begierdetaufe“ und deutet auf Wunsch Almas vage an, Werfel habe sich in seinem letzten Stündlein noch dem Christentum zugewandt. Das ist Unsinn: Als Alma Franz Werfel vor seinem Schreibtisch liegend fand, war er schon tot. Außerdem hatte er sich auch in den USA immer wieder zum Judentum bekannt – umso heftiger, je mehr obszöne Grausamkeiten des Hitler-Regimes sich bis an die amerikanische Westküste durchsprachen.
Alma ist gebrochen. Fast ein halbes Jahrhundert lang hat sie an der Seite berühmter Männer gelebt: Gustav Mahler, Oskar Kokoschka, Walter Gropius, Franz Werfel. Sie hat sich nicht nur deren Namen, sondern auch einen guten Teil ihres Ruhmes gesichert. Damit ist es nun vorbei, das weiß die 66-jährige Witwe.
Mit Franz Werfel stirbt ein weiterer Großer des europäischen Kulturlebens auf der Flucht oder im Exil.
•Im Juni 1938 wurde Ödön von Horváth in Paris von einem Ast erschlagen. Er war erst drei Tage zuvor in die Stadt gekommen.
•Otto Bauer, der Vordenker des „Austromarxismus“ und Chefideologe der österreichischen Sozialdemokraten, erlag wenige Tage später ebenfalls in Paris 56-jährig einem Herzinfarkt.
•Unter den ersten toten Emigranten war auch Sigmund Freud. Im Spätsommer 1939 hatten ihn noch Stefan Zweig und Salvador Dalí in seinem neuen Heim in London besucht, nachdem ihn die Gestapo aus seiner Wohnung in der Wiener Berggasse vertrieben hatte. Drei Wochen nach Zweigs und Dalís Besuch ließ sich der 83-Jährige von seinem Leibarzt eine Überdosis Morphium injizieren, die Schmerzen waren unerträglich geworden. Der Zigarrenraucher Freud litt seit Jahren an Gaumenkrebs.
•Kurz darauf erlag Joseph Roth in Paris seiner Alkoholkrankheit. Er war schon 1933 vor den Nazis in die französische Hauptstadt geflohen, hatte sich dort mit dem kaiserlichen Flüchtling Otto Habsburg-Lothringen angefreundet, aber dessen „Befehl“, mit dem Trinken aufzuhören, nicht befolgt.
•Wenige Monate danach ging der Philosoph und Kulturkritiker Walter Benjamin zugrunde. Er hatte 1940 die beschwerliche Flucht über die Pyrenäen bereits geschafft, als im spanischen Grenzort das Gerücht auftauchte, alle Flüchtlinge würden in das von den Nazis besetzte Frankreich zurückgeschickt und der Gestapo übergeben. Benjamin schluckte eine Zyankalikapsel.
•Der in Wien geborene Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hilferding – in der Weimarer Republik war er sozialdemokratischer Finanzminister – wurde 1941 von den mit den Nazis kollaborierenden französischen Behörden auf der Flucht in Marseille festgenommen und in Paris der Gestapo ausgeliefert. Nach schweren Folterungen erhängte er sich in seiner Zelle.
•Im Februar 1942 begingen Stefan Zweig und seine Frau Lotte in Brasilien Selbstmord. Erschöpft von den Jahren der Flucht habe ihn die Zerstörung seiner geistigen Heimat Europa nun völlig entwurzelt, schrieb Zweig in einem Abschiedsbrief. Der „Völkische Beobachter“ berichtete über den Tod des vielleicht größten österreichischen Schriftstellers seiner Zeit demonstrativ kühl: „Selbstmord des jüdischen Emigranten Zweig“ titelte das NS-Blatt seinen fünfzeiligen „Nachruf“.
•Zwei Monate später starb Robert Musil in seinem Schweizer Exil völlig verarmt nach einem Schlaganfall. Sein Opus Magnum, „Der Mann ohne Eigenschaften“, erschienen 1930, durfte nach der Machtübernahme der Nazis in Deutschland nicht mehr verkauft werden.
•1943 verschied der Regisseur und Begründer der Salzburger Festspiele Max Reinhardt mit 70 Jahren in New York nach zwei Schlaganfällen, verursacht durch einen Hundebiss. In Europa war er ein Star, in den USA hatte er nur einen, freilich großartigen Film gedreht („A Midsummer Night’s Dream“). Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in bescheidenen Verhältnissen.
•In New York starben im August 1945 der Autor Alexander Roda-Roda und der Komponist Béla Bartók – beide an Leukämie. Roda-Roda wie Bartók blieb der große Erfolg in den USA versagt.
•Der Wiener Autor Felix Salten kehrt ebenfalls nicht mehr in seine Heimatstadt zurück. Er stirbt 1945 in seinem Fluchtort Zürich. Vor seiner Ausreise aus Österreich hatten ihm die Nazis den Großteil seines Besitzes abgenommen. Die Rechte an seinem Roman „Bambi“ verkaufte Salten – übrigens ein Onkel von Karl Farkas – um nur 1000 Dollar. Walt Disney machte mit der Verfilmung Millionen. Mit Wien hatte Felix Salten schon nach seiner Flucht 1939 in einem Brief an einen Freund abgerechnet: „Ich habe die Wiener mein Leben lang weit überschätzt, und es gibt jetzt überhaupt keine Menschensorte, die ich so verachte, die ich so verdamme, wie die Wiener und die Österreicher überhaupt.“
Und nun wird also auch Franz Werfel die Städte seines Lebens – Prag, Wien, Venedig, Rom – nicht wiedersehen.
Aus Wien treffen weitere Todesnachrichten bei Alma Mahler-Werfel in Los Angeles ein. Ihr Stiefvater Carl Moll, ein Nationalsozialist der ersten Stunde, hat sich nach der Eroberung Wiens durch die Rote Armee vergiftet. Auch seine Tochter, also Almas Halbschwester, und deren Ehemann begingen Selbstmord.
Der Jugendstilmaler Carl Moll, der mit seinen Freunden Gustav Klimt und Koloman Moser 1897 die Wiener Secession gründete, hatte die verwitwete Mutter Almas geheiratet, als Alma 16 war. Sie verzieh ihrer Mutter die Wiederverheiratung nie, das Verhältnis trübte sich weiter ein, als diese noch ein Kind mit Carl Moll bekam.
Dennoch kaufte Alma mit Franz Werfels Geld 1931 eine Villa in der Steinfeldgasse auf der Hohen Warte, die an jene von Carl Moll und ihrer Mutter grenzte. Die Hohe Warte, eine kleine Erhebung in Wien-Döbling, war das angesagte Künstlerviertel dieser Zeit. Und Alma wollte große Feste geben.
Als sie im März 1938 mit Franz Werfel aus Wien floh, vertraute sie dem Stiefvater trotz der gegenseitigen Abneigung ihre Gemälde und die Villa treuhändig an.
Aber nun ist Carl Moll tot (Almas Mutter war schon 1938 verstorben) und die Villa in der Steinfeldgasse wurde im Krieg beschädigt, wird ihr aus Wien berichtet. Auch das Dachgeschoss, in das sich Franz Werfel zum Schreiben zurückzog, wenn ihm die rastlose Alma zu anstrengend wurde, ist völlig zerstört. Dort waren handschriftliche Partituren Gustav Mahlers und Manuskripte Franz Werfels aufbewahrt.
In jenem August 1945, in dem Franz Werfel, Roda-Roda und Béla Bartók sterben, werfen die US-Streitkräfte Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki ab. 100.000 Menschen werden sofort getötet, weitere 130.000 sterben bis Jahresende.
Der Einsatz der neuen Atomwaffe ist das Ergebnis einer mathematischen Kalkulation: Bei einer US-Invasion auf den japanischen Hauptinseln wären rund 250.000 amerikanischen Soldaten gefallen, so die Schätzung des Pentagon. Der Blutzoll der Japaner wäre doppelt so hoch gewesen, das weiß man seit den Kampfhandlungen um die kleineren Pazifikinseln.
Thomas Mann notiert in seinem Tagebuch etwas konsterniert über die antijapanische Stimmung in den USA: „Die Senatoren werden mit Telegrammen bombardiert: Wunsch, Land und Leute mit Atombomben zu vernichten.“
Bertolt Brecht, der Homo politicus, reagiert rasch. Er arbeitet gerade mit dem Hollywood-Star Charles Laughton an der englischen Übersetzung seines Stücks „Das Leben des Galilei“, geschrieben 1939 im dänischen Exil. Im Original war es entsprechend der historischen Ereignisse vor allem um die Auseinandersetzung der Wissenschaft mit der Kirche gegangen, in der englischen Version wird angesichts der Atombombe auch die Verantwortung der Wissenschaft selbst erörtert. „Die Atombombe hat die Beziehungen zwischen Gesellschaft und Wissenschaft zu einem Leben-und-Tod Problem gemacht“, schreibt Brecht in sein „Arbeitsjournal“.
Er ahnt: In diesem August 1945 bricht ein neues Zeitalter an.