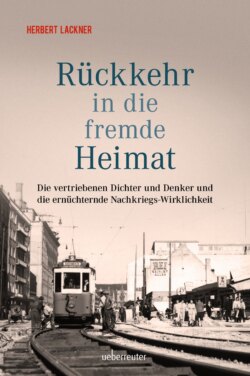Читать книгу Rückkehr in die fremde Heimat - Herbert Lackner - Страница 5
Los Angeles 1945 DAS „FLÜCHTLINGSCAMP“ VON HOLLYWOOD
ОглавлениеAlma Mahler-Werfel trauert Mussolini nach – Thomas Mann glaubt, Adolf Hitler sei noch am Leben – Friedrich Torberg bespitzelt im Auftrag des FBI Bertolt Brecht
„Ein alter, armer, kranker Mensch, geächtet auf der ganzen Welt“, schreibt Alma Mahler-Werfel am Abend des 29. April 1945 mitfühlend in ihr Tagebuch. Die Gattin des Erfolgsautors Franz Werfel hat in Beverly Hills eben von der Erschießung Benito Mussolinis durch italienische Partisanen erfahren.
Neun Jahre zuvor waren Alma und Franz Werfel an der Seite von Österreichs Ständestaat-Kanzler Kurt Schuschnigg in Mussolinis Limousine durch die Toskana getourt. Damals, 1936 – wie fern das doch alles war! – hatte Schuschnigg mit dem italienischen Faschistenführer auf dessen Landgut in Rocca delle Caminate nahe Viareggio verhandelt. Nach den politischen Gesprächen hatte man die Schönheit der Toskana genossen und das Haus des wenige Jahre zuvor verstorbenen Komponisten Giacomo Puccini besucht, den Alma als Frau des damaligen Wiener Operndirektors Gustav Mahler natürlich persönlich gekannt hatte.
Es war eine schöne Zeit und alle profitierten: Der Bundeskanzler schmückte sich mit dem berühmten Autor, die Werfels ließen sich im Gegenzug von den Mächtigen verwöhnen. Franz Werfel schrieb 1936 in der „Wiener Sonntagszeitung“ sogar einen öligen Jubel-Essay über Schuschnigg: „Die österreichische Menschlichkeit, die er, der geistige, empfindsame, unbeirrbare Mann in so hohem Maße selbst verkörpert – sie muß zum Heile Europas bewahrt werden.“
Menschlichkeit? Zwei Jahre zuvor, im Februar 1934, hatte sich Schuschnigg als Justizminister geweigert, dem Bundespräsidenten Gnadengesuche von sozialdemokratischen Schutzbündlern vorzulegen und ließ acht Todesurteile sofort vollstrecken. Nach dem Erscheinen von Werfels Artikel in der „Wiener Sonntagszeitung“ wetterte die im Brünner Exil erscheinende „Arbeiter Zeitung“: „Eine unerhörte Literatenlumperei. Die Werfels fressen aus der Krippe und lecken die Hand – die Verkörperung der menschlichen Dreckseele.“
Jetzt, knapp vor Kriegsende, sitzt Alma Mahler-Werfel, 66, in einer eindrucksvollen Villa in Kalifornien, bedauert Mussolini und sorgt sich um ihren Mann: Franz Werfel, elf Jahre jünger als sie, ist schwer herzkrank. Er hatte schon Herzprobleme, als sie sieben Jahren zuvor vor den Nazis aus Wien flüchten mussten. Nach einer Irrfahrt durch Frankreich waren sie damals mit einem Fluchthelfer über die Pyrenäen geklettert, hatten in einem Flüchtlingsheer Spanien und Portugal durchquert, um schließlich im Oktober 1940 auf einem der letzten Dampfer aus Lissabon Richtung New York auszulaufen. Die „New York Times“ widmete der Ankunft des europäischen Starautors Franz Werfel fast die gesamte Titelseite.
Nach einigen Wochen in einem Nobelhotel in Manhattan waren die Werfels damals nach Los Angeles weitergereist, wo sie ein ebenso stilvolles wie geräumiges Haus in Beverly Hills bezogen.
Sie konnten sich diesen Luxus leisten. Werfels Romane warfen beträchtliche Tantiemen ab. Besonders erfolgreich war jener über den Völkermord an den Armeniern „Die 40 Tage des Musa Dagh“, erschienen 1933 und in viele Sprachen übersetzt.
Schon wenige Monate nach der Ankunft in den Vereinigten Staaten war ein neuer Roman Werfels erschienen, der auf recht kuriose Weise entstanden war: Auf der Flucht durch das von Nazi-Deutschland besetzte Frankreich war das Paar auch durch Lourdes, den berühmten Wallfahrtsort nahe der spanischen Grenze, gekommen, wo 1858 dem Hirtenmädchen Bernadette Soubirous die heilige Maria erschienen sein soll. In panischer Angst vor der Gestapo – Werfel stand auf deren Fahndungsliste ganz oben – gelobte der Autor, einen Roman über diese Bernadette zu verfassen, sollte er den Häschern entkommen.
Schon während der Atlantik-Überquerung begann Werfel in seiner Kabine an der Lourdes-Geschichte zu arbeiten. Alma sah es mit Wohlwollen: Waren auch zwei ihrer drei Ehemänner Juden – Gustav Mahler und Franz Werfel –, war sie doch eine entschlossene christliche Antisemitin, die sich nichts sehnlicher wünschte als den Übertritt ihres Gatten zum katholischen Glauben.
„Das Lied der Bernadette“ erschien 1941 im Verlag Bermann-Fischer in Stockholm und wurde sofort ein Erfolg. In der Bestsellerliste der „New York Times“ rangierte Werfels Roman wochenlang auf Platz eins. 1943 wurde er mit einem Staraufgebot in Hollywood verfilmt („The Song of Bernadette“). Das laut Filmkritik „episch breit angelegte historisch-religiöse Drama“ erntete vier Oscars.
Den Werfels geht es also in ihrer neuen Heimat anders als vielen vor den Nazis geflohenen Künstlern und Autoren blendend. Wie in ihrer Wiener Villa auf der Hohen Warte ist auch ihr schmuckes Haus am North Bedford Drive in Beverly Hills Treffpunkt literarischer und musikalischer Größen: Die von den Nationalsozialisten aus Europa vertriebenen Komponisten Arnold Schönberg, Erich Wolfgang Korngold und Igor Strawinsky kommen in Almas Salon, Benjamin Britten bringt auch seinen Lebensgefährten mit. Der aus Wien geflüchtete Stardirigent Bruno Walter und die Regisseure Max Reinhardt und Fritz Kortner sind ebenso ständige Gäste wie die Autoren Lion Feuchtwanger, Erich Maria Remarque und Friedrich Torberg. Torberg ist Franz Werfels engster Freund.
Anders als praktisch alle hier – Gastgeberin Alma natürlich ausgenommen – ist Erich Maria Remarque nicht aus „rassischen“ Gründen emigriert, sondern weil ihn sein 1930 erschienener Antikriegs-Roman „Im Westen nichts Neues“ in Nazi-Deutschland zur Unperson gemacht hat.
„Üppiges Mahl, kalifornischer moussierender Burgunder, Benediktiner zum Kaffee“, schreibt Thomas Mann im Oktober 1942 nach einem Abend bei Alma in sein Tagebuch. Thomas Mann, Nobelpreisträger von 1929 und Prinzeps der deutschen Literatur, ist wohl der schillerndste Gast am North Bedford Drive. Viele der anderen Besucher in der Villa Werfel verdanken ihm ihr Leben – auch die Werfels.
Mann hatte sofort nach der Machtergreifung Hitlers Deutschland verlassen und war in die Schweiz übersiedelt. Im März 1938 trat er einen Lehrauftrag an der Princeton University nahe New York City an. Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Frankreich im Sommer 1940 sammelte Thomas Mann gemeinsam mit seiner Tochter Erika unter Bankern, Unternehmern und Universitätsprofessoren in New York eine ansehnliche Summe, mit der ein Fluchthelfer, der Journalist Varian Fry, in den unbesetzten Teil Frankreichs entsandt wurde. Dorthin, in den Süden des Landes, war die vom deutschen Vormarsch überraschte europäische Kulturelite geflohen, die zuvor in Paris gelebt hatte. Südfrankreich war freilich ein höchst unsicherer Fluchtort. Marschall Philippe Pétain, der Regierungschef von „Vichy-Frankreich“, kollaborierte bedingungslos mit den Deutschen. Die Häfen waren gesperrt, wer Frankreich verlassen wollte, benötigte ein Ausreisevisum und die Gestapo schaute den französischen Beamten über die Schulter.
Dem von Thomas Mann entsandten Fluchthelfer Varian Fry gelang es, Hunderte Flüchtlinge über die Grenze zu schmuggeln, meist mit gefälschten Papieren und über dornige Steige durch die Pyrenäen. Gleich in der ersten Gruppe, die sich auf diesem Weg nach Spanien und später nach Portugal durchschlug, waren Alma und Franz Werfel, Thomas Manns Sohn Golo, Manns Bruder Heinrich und dessen Frau Nelly. Auch die Maler Marc Chagall und Max Ernst, der Autor Lion Feuchtwanger und seine Frau Martha, der Wiener Feuilletonist Alfred Polgar sowie Hunderte andere Flüchtlinge erreichten nur durch Varian Frys Hilfe den rettenden Hafen Lissabon.
Dort lief im Oktober 1940 das letzte reguläre Passagierschiff Richtung New York aus, bevor der Schiffsverkehr wegen des U-Boot-Kriegs eingestellt werden musste. Der Dampfer hieß „Nea Hellas“ und fuhr unter griechischer Flagge. Neben den Werfels und den Manns waren auch Alfred Polgar und seine Frau sowie der Berliner Schriftsteller Alfred Döblin mit seiner Familie an Bord. Friederike Zweig, von Stefan Zweig inzwischen geschieden, war mit ihren zwei Töchtern aus erster Ehe auf diesem letzten Schiff, das planmäßig den Atlantik überquerte. Stefan Zweig wanderte da gerade mit seiner neuen Frau, seiner Ex-Sekretärin Charlotte Altmann, in Brasilien ein, seiner letzten Lebensstation.
Ganz oben auf der Liste der aus Südfrankreich zu schleusenden Autoren, die Varian Fry von Thomas Mann mitgegeben wurde, stand der Journalist Konrad Heiden. Heiden galt in Nazi-Deutschland als Staatsfeind Nummer eins. Er hatte vor 1933 den atemberaubenden Aufstieg der NSDAP in der „Frankfurter Zeitung“ kritisch dokumentiert und 1936 in der Schweiz die erste fundierte Hitler-Biografie veröffentlicht. Darin verfolgte er die Spuren der Familie des „Führers“ ins niederösterreichische Waldviertel. Hitler hatte seine Herkunft stets verschleiert und sogar Dörfer schleifen lassen, in denen seine Vorfahren lebten. Er hasste Konrad Heiden, nach ihm fahndete die Gestapo in ganz Frankreich. Auch er schlug sich mit Hilfe Varian Frys nach Lissabon durch und querte auf der „Nea Hellas“ den Atlantik.
Jetzt, als der große Krieg zu Ende geht, sind diese Geflüchteten mit großen Namen also seit mindestens fünf Jahren in den USA. In New York und Los Angeles haben sie deutschsprachige Künstlerkolonien gegründet. Den ganz Großen fehlt es an nichts. Erich Maria Remarque etwa scheffelt reichlich Tantiemen aus seinem ins Englische übersetzten Roman „Im Westen nichts Neues“ und hat eine Affäre mit der schon Anfang der 1930er-Jahre nach Hollywood ausgewanderten Marlene Dietrich. Der maskuline 44-Jährige gefällt auch Alma Mahler-Werfel. „Ich habe eine große Freundschaft und Saufgenossenschaft mit Remarque gefunden“, schreibt sie an ihren Kumpel, den Schriftsteller Carl Zuckmayer, der mit seiner Frau eine kleine Farm in Vermont gemietet hat. Remarque sieht Alma etwas distanzierter: „Ein wildes, blondes Weib, gewalttätig, saufend. Hat bereits Gustav Mahler unter die Erde gebracht. Sie pfiff Werfel wie einem Hund, er kam auch.“
Thomas Mann, ihr Retter, feiert am 6. Juni 1944, dem ersten Tag der Invasion der Alliierten in der Normandie, seinen 69. Geburtstag. Er hält das für eine Fügung des Schicksals. „Eigentümliches Zusammentreffen“, schreibt er in sein Tagebuch und führt die Liste der Geschenke an, die ihm seine Frau Katia gemacht hat: „Armstuhl fürs Schlafzimmer, Schlafrock, Platten, Ledernützlichkeiten, Seife, Süßigkeiten.“
Worüber unterhält man sich in Almas Mahler-Werfels Salon, den Thomas Mann so regelmäßig besuchte? Über Hitler? Über den Krieg? Über das Europa nach dem Krieg? Manns Tagebuch, in dem er stets penibel Gesprächspartner und Gesprächsthemen festhält, lässt anderes vermuten: Hier sitzen Bewohner des Elfenbeinturms zusammen. „Zum Abendessen bei Werfels. Über Nietzsche und das Mitleid, das er erregt. Begegnung mit Schönberg und Strawinsky in Aussicht genommen“, notiert Mann im Mai 1943. Drei Monate später ist er wieder zu Gast: „Zum Abendessen zu Werfels mit Strawinsky. Viel mit Strawinsky über Schönberg.“ Und wieder einige Monate später: „Abendessen bei Werfels mit Bruno Walter und Schönberg. Viel mit diesem. Champagner.“
Thomas Mann erwähnt in seinen Tagebucheintragungen über die Feste bei Alma Mahler-Werfel kaum je Diskussionen über die Ereignisse in Europa. Es ist die Stunde der Schöngeister. Manchmal kommt auch Theodor Adorno vorbei und spielt Klavier. Der Frankfurter Soziologe und Philosoph war 1941 mit seinem philosophischen Alter Ego Max Horkheimer aus New York ins klimatisch angenehmere Kalifornien übersiedelt. Hier verfassen sie nun ihr Hauptwerk „Dialektik der Aufklärung“, in dem sie angesichts der nationalsozialistischen Barbarei grundsätzliche Kritik an der europäischen Aufklärung üben, deren Fortschrittsoptimismus obsolet geworden sei.
Thomas Mann verfolgt genauer als alle anderen die Ereignisse in Europa. Fast jede seiner Tagebuch-Eintragungen, die stets mit Klagen über Krankheiten aller Art beginnen, endet mit einer Notiz über die Vorgänge in Europa: „Die Russen vor Minsk“, trägt er im Juni 1944 freudig ein. „Entsetzliche Zunahme des Juden-Massacres in Europa“ wenig später. „Fürchterliches Bombardement von Nürnberg“, notiert er einige Wochen danach fast erleichtert.
Seit 1941 nimmt Thomas Mann in Los Angeles Reden auf Schallplatten auf, die nach New York geflogen und von dort telefonisch nach London übertragen werden. Die BBC strahlt sie per Langwelle weit ins europäische Festland hinein. Bereits im Februar 1942 spricht Mann von der „Tötung von nicht weniger als elftausend polnischen Juden mit Giftgas“, die in „luftdicht verschlossene Wagen gesteckt und binnen einer Viertelstunde in Leichen verwandelt werden“. Man habe aus erster Hand „die Beschreibung des ganzen Vorganges, der Schreie und Gebete der Opfer und des gutmütigen Gelächters der SS-Hottentotten, die den Spaß zur Ausführung brachten.“
In Almas Salon bringt Thomas Mann so Schreckliches nicht zur Sprache.
Aber bei Weitem nicht alle auf ihrer Flucht an die Küste Kaliforniens gespülten Dichter und Denker leben den Luxus, den sich die erfolgreichen Emigranten leisten können. Viele der nun verarmten Flüchtlinge waren in Europa ebenfalls große Stars, aber ihre Bücher wurden nicht übersetzt, also gibt es jetzt keine Tantiemen. In Nazi-Deutschland wurden ihre Arbeiten aus den Buchhandlungen geholt und öffentlich verbrannt, ihre Konten sind gesperrt.
Präsident Franklin D. Roosevelt hat den Studiobossen in Hollywood zehn auf ein Jahr befristete Arbeitsplätze für geflüchtete und bedürftige europäische Autoren abgerungen. Monatslohn: 100 Dollar, nach heutiger Kaufkraft etwa 1800 Euro.
Friedrich Torberg ist unter jenen, die einen Schreibtisch in einem Filmstudio bekommen. Auch Alfred Döblin, der mit seinem 1929 erschienenen Roman „Berlin Alexanderplatz“ einen großen Erfolg gelandet hatte, bezieht ein Büro am Studiogelände von Metro-Goldwyn-Mayer.
Bald wird den Autoren klar, dass die Studios nur dem Präsidenten einen Gefallen tun wollten, aber an der Arbeit dieser verschrobenen Europäer nicht wirklich interessiert sind. „Tun tut man nichts, absolut nichts“, schreibt Döblin an einen Freund. „Wir erledigen unsere Korrespondenz, telefonieren, lesen Zeitung, schreiben unsere eigenen Sachen – was man so in Sitzhaft tun kann. Jetzt fängt es hier langsam an zu regnen. Vielleicht entwickelt sich eine Sintflut und ertränkt die Filmindustrie samt ihrer Autoren.“
Auch der Wiener Feuilletonist Alfred Polgar – Joseph Roth bezeichnete ihn als seinen großen Sprachlehrer – hat einen Job bei MGM bekommen. Als das Jahr in den Studios vorbei ist, zieht er bittere Bilanz: „Ich bekam nicht die geringste Gelegenheit während meines Engagements, weder mich zu blamieren noch mich auszuzeichnen. Man nahm von meinem Vorhandensein kaum Notiz.“
Polgar war am Tag vor dem Nazi-Einmarsch in Österreich mit seiner Frau mit dem Nachtzug über die Schweiz nach Paris geflohen, hatte dort von milden Gaben seines Schweizer Verlegers und von Zuwendungen seiner guten Freundin Marlene Dietrich gelebt, die er 1927 bei einem Gastspiel in den Wiener Kammerspielen kennengelernt hatte.
1940 entkamen die Polgars mithilfe Varian Frys über die Pyrenäen nach Spanien und schließlich via Lissabon in die USA. Bald querten auch sie mit dem Zug den Kontinent.
Anfangs gefiel es dem Wiener Grandseigneur im amerikanischen Westen recht gut: „Hier in Californien ist es schön und warm, Land und Leute mehr als freundlich; und wenn’s in mir nicht so aussähe, wie es aussieht, ließe es sich hier angenehm leben“, schreibt er seinem Schweizer Verleger.
Aber auf Dauer ist das kein Land für einen notorischen Kaffeehausliteraten aus Wien: „Ich sehne mich nach Gelegenheiten, irgendwo außer Haus allein eine Stunde bei einem Glas Bier, einer Tasse Café sitzen zu können. Aber diese Gelegenheiten gibt es hier nicht. Ein Restaurant, ein Caféhaus nach unserem europäischen Geschmack sind hier unbekannt“, schreibt er wenig später. Je länger Polgar in Los Angeles lebt, desto bitterer werden seine Briefe: „Ich fühle mich grenzenlos einsam, völlig beziehungslos zu der neuen Welt, in die mich die alte vertrieben hat“, notiert er 1941 kurz vor seinem ersten Herzinfarkt.
Alfred Polgar kann im Magazin „Esquire“ einige Artikel unterbringen, sein sehnlicher Wunsch, auch im „New Yorker“ veröffentlicht zu werden, erfüllt sich nicht. Der Versuch, gemeinsam mit Friedrich Torberg eine deutschsprachige Ausgabe des „Time“-Magazins herauszugeben, kommt über eine Probenummer nicht hinaus. Torberg und Polgar hatten geplant, das Magazin nach der Niederlage Hitlers auch in Deutschland zwecks Umerziehung des vom Nationalsozialismus benebelten Volkes erscheinen zu lassen.
Zu den Partys in Almas Salon ist Polgar nicht geladen – er hätte eine Einladung wohl auch abgelehnt. In der Ersten Republik war er immer auf der Seite der Linken gestanden, die Freundlichkeiten, die Alma und Franz Werfel nach 1934 mit den austrofaschistischen Machthabern austauschten, hatten auch ihn empört.
Am schmerzlichsten sind die Jahre im kalifornischen Exil aber wohl für Heinrich Mann, den älteren Bruder des gefeierten Thomas. Heinrich Mann war in der Weimarer Republik ein Großer der deutschen Literaturszene gewesen. Sein Roman „Der Untertan“, erschienen unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, rechnete schonungslos mit dem kriecherischen Opportunismus der bürgerlichen Gesellschaft im wilhelminischen Kaiserreich ab. Die narbenübersäten Burschenschafter, die krähenden Kriegshetzer, die dumpfe Bourgeoisie, die rücksichtslosen Ausbeuter – an ihrem Beispiel beschrieb er den Wilhelminismus.
Darin unterschied er sich deutlich von seinem jüngeren Bruder Thomas, der 1914 wie viele Intellektuelle im Krieg etwas Reinigendes, etwas Erhabenes gesehen hatte und erst nach der Katastrophe die Wurzeln des Unheils erkannte.
Heinrich Mann schloss sich schon während des Weltkriegs dem linken Flügel der Sozialdemokraten an. 1932 erwog die SPD, ihn bei der Reichspräsidentenwahl aufzustellen, entschied sich dann aber schweren Herzens, den reaktionären Amtsinhaber Paul von Hindenburg zu unterstützen, um den ebenfalls kandidierenden Adolf Hitler zu verhindern.
Heinrich Mann setzte noch im Februar 1933 – Hitler war seit zwei Wochen Reichskanzler – alles daran, SPD und KPD zu einer Einheitsfront gegen die totale Machtübernahme der Nazis zu überreden. Einen von ihm sowie von dem Physiker Albert Einstein und der Malerin Käthe Kollwitz unterzeichneten Aufruf zur Bildung eines letzten Aufgebots gegen die Nazis ließ die Gruppe mutig auf Plakatwänden in deutschen Städten anbringen. Vergebens: Stalin untersagte den deutschen Kommunisten jede Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten. Diese seien ebenfalls Faschisten, lautete die aus Moskau vorgegebene Parole, „Sozialfaschisten“ eben.
Und jetzt sitzt dieser tapfere Demokrat, wache Geist und gefeierte Autor Heinrich Mann, der bis zuletzt Hitler die Stirn geboten hatte, in einem Hollywood-Studio und niemand interessiert sich für ihn und seine Arbeit. Erst wenige Jahre zuvor, 1930, war sein Roman „Professor Unrat“ in Berlin mit Marlene Dietrich unter dem Titel „Der blaue Engel“ verfilmt worden. Es war erst der zweite deutsche Tonfilm, die Besucher stürmten die Kinos. Aber hier im ihm so fremden Westen der USA muss Heinrich Mann von dem Geld leben, das ihm sein erfolgreicher jüngerer Bruder Thomas ab und an zusteckt.
Dazu kommen seine privaten Sorgen.
Heinrich Mann war vor der Flucht aus Deutschland gerne durch die Berliner Bars gezogen. So hatte er 1929 die Animierdame Nelly Kröger kennengelernt. Sie war die Tochter eines holsteinischen Fischers und politisch ebenfalls von linker Gesinnung. Das gefiel Heinrich. Bald waren die beiden ein Paar. Nelly war 30, Heinrich Mann nahezu 60. 1933 flohen sie wenige Tage nach Hitlers Machtergreifung gemeinsam nach Frankreich. In der südfranzösischen Künstlerkolonie Sanary-sur-Mer mieteten sie eine Wohnung, die bodenständige Nelly war in dem Städtchen überaus beliebt. Besonderen Anklang fanden die groben Seemannslieder, die Nelly gemeinsam mit dem aus seinem dänischen Exil zu Besuch angereisten Bertolt Brecht in großer Runde zum Besten gab.
Nach Hitlers Frankreich-Feldzug flohen Heinrich und Nelly im Spätsommer 1940 nach Spanien. Die junge Frau schleppte den fast 70-Jährigen über die steile Buschlandschaft der Pyrenäen. Von Spanien ging es nach Lissabon, von dort nach New York und bald darauf mit all den anderen nach Hollywood, wo nun auch der alte Heinrich Mann diesen demütigenden Dienst im Filmstudio ableisten musste.
Thomas Mann, er lebt mit seiner Frau Katia ganz in der Nähe, in Pacific Palisades im Norden von Los Angeles, lehnte Nelly von Beginn an ab: Eine Fischerstochter aus Holstein – so eine passte seiner Ansicht nach gar nicht in eine Familie, die von Lübecker Kaufleuten und Senatoren abstammt. Außerdem hatte sie es gewagt, ihn, den Nobelpreisträger für Literatur, bei Tisch zu unterbrechen. Einmal, so wird erzählt, habe sie zu einer Party geladene Gäste betrunken und splitternackt empfangen. Thomas Mann bezeichnet seine Schwägerin manchmal als „die schreckliche Trulle“ oder „die arge Hur“. Seine Frau Katia nennt sie nur „das Stück“.
Weil das Geld knapp ist, nimmt Nelly einen Job als Nachtschwester in einem Krankenhaus in Los Angeles an. Und sie trinkt. Sie trinkt sogar viel und wird immer wieder bei Verkehrskontrollen angehalten, das knappe Familienbudget wird durch das Bußgeld noch mehr belastet. Nach einem im Suff verursachten Unfall unternimmt sie im Jänner 1944 einen Selbstmordversuch. Aus der psychiatrischen Klinik, in die man sie einliefert, schreibt Nelly an ihren Mann: „Ich kann nicht denken an das, was ich die letzten zwei Jahre gelitten habe, und nur weil ich in meiner tiefsten Demütigung ein Glas Wein zu viel getrunken habe und oft betrunken war, habe ich nicht ganz meinen Verstand verloren. Nun will ich leben!“
Aber der Entzug misslingt. Nelly gibt auf. Im Dezember 1944 stirbt sie nach Einnahme einer Überdosis Schlaftabletten. Heinrich Mann ist verzweifelt. Zum Trost gibt ihm sein Bruder Thomas Geld, damit er wenigstens seine Möbel aus dem Pfandhaus holen kann. „Sie hat ihm viel Schaden getan. Er ist in Tränen um eine ruinöse Gefährtin“, schreibt Thomas Mann am Tag der Beerdigung Nellys in sein Tagebuch.
Auch Nellys Sangesfreund aus den Tagen in Südfrankreich ist in Los Angeles eingetroffen – und das auf höchst abenteuerlichen Wegen: Bertolt Brecht kam nicht über den Atlantik, wie die anderen Geflüchteten, sondern über den Pazifik. Mit seiner Frau, der Wiener Schauspielerin Helene Weigel, und den beiden Kindern war er nach Hitlers Machtübernahme zuerst aus Deutschland in sein Haus im dänischen Svendborg geflohen und nach der Besetzung Dänemarks durch die Wehrmacht über Schweden und Finnland in die Sowjetunion. Die Brechts durchquerten das Land mit der Transsibirischen Eisenbahn, in Wladiwostok schifften sie sich nach Kalifornien ein. Die Nazis verfolgten die beiden aus unterschiedlichen Gründen: Brecht ist Kommunist, Helene Weigel Jüdin.
In Santa Monica trifft Bertolt Brecht bald auf alte Bekannte aus Berlin und ist entsetzt: „Döblin und Mann hier zu sehen, ist anstrengend. Sie sind mehr als erfolglos. Heinrich Mann hat nicht das Geld, sich einen Arzt zu rufen, und sein Herz ist verbraucht. Sein Bruder, mit einem Haus, 4 bis 5 Autos, läßt ihn buchstäblich hungern“, schreibt Brecht in sein „Arbeitsjournal“, wie er sein literarisches Tagebuch nennt.
Aber auch er kann nicht wirklich Fuß fassen, Kalifornien bleibt ihm fremd, er findet sogar sein Exil in Dänemark interessanter: „Die geistige Isolierung hier ist ungeheuer, im Vergleich zu Hollywood war Svendborg ein Weltzentrum.“ Immerhin verfasst Brecht 1943 gemeinsam mit dem aus Wien stammenden Regisseur Fritz Lang das Drehbuch zum Film „Hangmen Also Die!“. Es basiert lose auf Ereignissen in Prag ein Jahr zuvor. Dort hatten Widerstandskämpfer den SS-Statthalter Reinhard Heydrich ermordet, das hatte blutige Vergeltungsmaßnahmen der Nazis zur Folge. Die Filmmusik stammt vom Wiener Hanns Eisler, wie Bertolt Brecht und Fritz Lang ein Flüchtling. Auch die meisten Schauspieler sind Emigranten.
Aber das ist es auch schon für Brecht, zu Hollywood passt er nicht. Er hat allerdings vor der Flucht mit seiner „Dreigroschenoper“ so prächtig verdient, dass sich die Familie in ein schmuckes kalifornisches Holzhaus mit vier Schlafzimmern und einem großen Arbeitsraum einmieten kann.
Zu den Partys bei den Werfels ist natürlich auch Brecht nicht eingeladen, der „Kommunist“, wie ihn die anderen hinter vorgehaltener Hand nennen.
Er trägt es wohl mit Fassung. Thomas Mann, den Dauergast bei Alma, kann er ohnehin nicht ausstehen. Brecht verabscheut die von Mann vertretene Kollektivschuld-These. Als Mann einmal schreibt, die Alliierten sollten „Deutschland zehn oder zwanzig Jahre lang züchtigen“, und gar meint, „eine halbe Million muss getötet werden in Deutschland“, nennt ihn Brecht in seinem „Arbeitsjournal“ ein „Reptil“ und fügt ironisch hinzu, das deutsche Volk müsse sich vor allem dafür rechtfertigen, „daß es nicht nur die Untaten des Hitlerregimes, sondern auch die Romane des Herrn Mann geduldet hat – die letzteren ohne 20 bis 30 SS-Divisionen über sich.“
Thomas Mann hält von Brecht politisch ebenso wenig wie der von ihm, er gibt jedoch zu: „Das Scheusal hat Talent.“
Einer der Stammgäste in Almas Salon hat Brecht ins Visier genommen: Friedrich Torberg. Er trifft ihn öfter, ist von seiner Intelligenz fasziniert und „erschrocken von seiner raffinierten Art des Diskutierens“. Torberg, geboren in der Wiener Porzellangasse, ist entschlossener Antikommunist. Das hat auch das FBI mitbekommen, das sich ständig in Emigrantenkreisen umhört. 1943 bekommt Torberg den Auftrag, ein Dossier über Brechts politische Ausrichtung anzufertigen. Torberg liefert.
Die Feste bei Alma Mahler-Werfel werden nun seltener: Franz Werfel hat schwere gesundheitliche Probleme. Am 13. September 1943, wenige Tage nach seinem 53. Geburtstag, erleidet er einen Herzinfarkt, den er knapp überlebt. Im Frühjahr 1944 zieht auch noch sein Freund Torberg nach New York.
Aber Alma und Franz Werfel streiten jetzt weniger, sie ist eine fürsorgliche Übermutter mit entsprechenden Reflexen: „Trotz der Herzschwäche blüht jetzt seine Sexualität wieder auf“, schreibt sie im Herbst 1944 in ihr Tagebuch. „Da ich Angst um ihn habe und vor allem vor den großen Schmerzen, die er seit Jahren nach einer Liebesfreude bekommt, such’ ich ihn abzulenken, was ihn aber irritiert. Seit zwei Tagen sagt er fortwährend: ‚Ich geh in ein Puff, um mich zu reizen!‘. Seine Augen hängen an jeder Weibsgestalt mit unstillbarer Gier.“ Er sei eigentlich schon immer so gewesen, meint Alma, „darum ist er heute so fertig“.
Sie führt Werfels Herzleiden also auf Triebhaftigkeit zurück.
Ausgerechnet Alma!
Beim Komponisten Alexander Zemlinsky hatte sie in den 1890er-Jahren als sehr junge Frau nicht nur Musikstunden genommen und danach den um fast 30 Jahre älteren Direktor der Wiener Hofoper Gustav Mahler geheiratet. Noch zu Lebzeiten Mahlers begann sie ein Verhältnis mit dem Berliner Architekten Walter Gropius, ging dann aber eine leidenschaftliche Beziehung mit dem jungen Maler Oskar Kokoschka ein („Wir haben uns aneinander wund gerieben“). Kokoschka war ihr völlig verfallen, dennoch heiratete sie 1915 Walter Gropius. Gropius war noch in den Schützengräben an der Frankreich-Front, als Alma den um elf Jahre jüngeren Franz Werfel kennenlernte. Sie ließ sich von Gropius scheiden und heiratete Werfel. 1932, da war sie 54, lernte sie den um 16 Jahre jüngeren Priester Johannes Hollnsteiner kennen, den Beichtvater und Vertrauten von Justizminister Kurt Schuschnigg, dem späteren Bundeskanzler. Alma mietete für die Treffen mit dem Geistlichen eine kleine Wohnung, wo sie ihn mit Champagner und Kaviar bewirtete.
Almas Tochter Anna aus der Ehe mit Gustav Mahler erinnerte sich später: „Sie hat ihn gefragt, wie das nun also ist mit der Keuschheit. Da hat er ihr erklärt, das mit der Keuschheit, das ist immer nur, während man das (den Talar; Anm.) anhat. Sonst ist es gar nicht notwendig.“
Aber jetzt stößt sich Alma an der „Triebhaftigkeit“ des schwer kranken Franz Werfel und führt sogar sein Herzleiden darauf zurück.
Zur Jahreswende 1944/45 hat sich Franz Werfels Zustand so weit gebessert, dass er Zeit in seinem Schreibquartier in Santa Barbara zubringen kann. Alma ist anstrengend, im Haus an der Küste ist er ungestört.
Dann kommt der Frühling und der Krieg in Europa ist zu Ende.