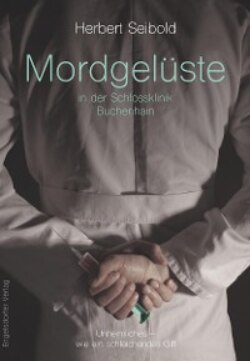Читать книгу Mordgelüste in der Schlossklinik Buchenhain - Herbert Seibold - Страница 11
Ermittlungen: Ist es ein Mitarbeiter der Klinik?
Оглавление„Herr Doktor Freund, ich grüße Sie. Haben Sie einen jüngeren Bruder Severin, der zurzeit beim Skispringen Deutschlands Champion ist?“
„Nein, Herr Hauptkommissar, wieso denn das? Ich sehe zwar sportlich aus, aber Skispringen ist nicht mein Ding – immer schön auf dem Boden bleiben, sonst fällt man zu tief.“
Joe Moser lächelte über diese coole Argumentation. „Entschuldigen Sie, d’accord, auch ich hebe selten ab! Wie lange arbeiten Sie schon in diesem Klinikum?“
„Oh, schon lange! Fünf Jahre. Bin ich deswegen verdächtig?“
Moser kannte diese Antwort aus Hunderten von Befragungen. „Nein! Sie wissen doch, dass wir alle befragen müssen. Mich interessiert vor allem die Stimmung unter den Mitarbeitern und Kollegen. Wie kommen Sie mit dem Geschäftsführer klar?“
Der Assistenzarzt konterte mit einer Gegenfrage: „Nach oder vor dem Anschlag auf den Geschäftsführer?“
„Im Klartext: War unter den Mitarbeitern einer so frustriert, dass er Wut und Mordgefühle haben könnte?“
„Darf ich etwas ausholen? Ich muss aus dem Nähkästchen plaudern. Wissen Sie, der Buchenhain ist unser Arbeitsplatz, den wir erhalten wollen. Seit dem neuen Abrechnungssystem weht in den Krankenhäusern ein kälterer Wind. In der Umgebung von fünfzig Kilometern sind ja schon einige Häuser eingegangen. Harte Belastungen gehören zum Alltag. Wir Ärzte sind abgehärtet. Was uns nicht umbringt, macht uns stark. Denken Sie doch an manche durchgedrehte Angehörige, die sich aufspielen und ihren Frust von zu Hause oder vom Arbeitsplatz an Schwestern und Ärzten auslassen. Der Geschäftsführer hat vor einem guten Jahr einen schweren Job übernommen und musste mit dem ererbten Defizit robust umgehen. Manche kamen damit wohl nicht so gut klar.“
Joe Moser nickte und ließ sich Zeit. Er hatte von der Sekretärin schon Vorinformationen bekommen und von Doktor Freund nur Gutes gehört. Die Sekretärin war ebenso schon fünf Jahre in der Klinik und wusste über Freunds Biografie grob Bescheid. Unter anderem hatte sie ihm fast vorgeschwärmt: „Wissen Sie, dieser Arzt ist, glaube ich, ein besonderer Mensch. Herr Doktor Freund sang früher im Kirchenchor mit einer guten Alt-, dann Baritonstimme und wollte eigentlich Priester werden. Er kam ursprünglich aus einer armen Bauernfamilie. Weil die Eltern die Schule und das Studium nicht bezahlen konnten, kam er in ein Internat, wo er fast kostenlos wohnen konnte. Dafür musste er in einem kalten Keller auch im Winter Kartoffeln aussortieren. Das hat ihn geprägt. Er sagte mir, dass er anfänglich eine echte Berufung für den Priesterberuf gespürt habe, weil er sich für religiöse Fragen interessierte und sich für soziale Fragen ereifern konnte und überzeugt war, auf diese Weise den Menschen mehr Freiheit und ein bisschen Glück zu vermitteln. Dass er nicht Priester, sondern Arzt wurde, lag nicht daran, wie Witzbolde ihm vorhielten, dass seine Glaubenszweifel schwarzhaarig oder blond waren, sondern echte Zweifel wegen der erzkonservativen Strukturen in der katholischen Kirche und des ihm unsinnigen Anspruchs der allein selig machenden katholischen Kirche. Die ‚Gutmensch-Eigenschaften‘, die seine Kindheit bis zum achtzehnten Lebensjahr prägten, hat er sich aber im Arztberuf bewahrt. Im Krankenhaus war sein fast missionarischer Drang, helfen zu wollen, aufgefallen. Wenn es hart auf hart kam, blieb er cool und hatte eine hohe Toleranzschwelle entwickelt. Die Schwestern mochten ihn sehr, berichteten aber, dass er sich auch aufregen, sozusagen in einen heiligen Zorn geraten könne – natürlich nur verbal –, wenn Menschen verlogen und inadäquat fordernd auftraten.“
Doktor Freund schaute stumm auf den Kommissar, der kurz die Augen geschlossen hatte.
„Fahren Sie fort, Herr Doktor. Sie haben recht, die äußeren ökonomischen Bedingungen in Krankenhäusern aber auch in der Wirtschaft sind psychologischen Einflüssen unterworfen, die manche Hirne ganz schön durcheinanderbringen können.“
„Oh, Herr Kommissar, Sie spielen doch nicht auf den Gentleman und Nobelpreisträger 2013 für Wirtschaft, Robert Shiller, an, der der Psyche der Banker beim Finanzgebaren eine große Bedeutung beimisst? Was mich betrifft – ich musste mich umstellen. Am schlimmsten fand ich eigentlich die Ansprüche der Angehörigen in diesem System, das zunehmend weniger Ressourcen bekam, immer weniger Zeit für Gespräche zuließ. Mein Gott, was werfen diese Leute dem Personal, bevorzugt dem Chefarzt, alles vor, wenn er auf Chefarztvisite kommt und gerade ein schwieriges differential-diagnostisches Problem zu lösen hat. Wie Kröten lauern die in den Sesseln. Die Suppe sei zu heiß oder zu kalt und nicht gesalzen. Wir haben unter Zeitdruck wirklich anderes zu tun, als all diesen Blödsinn anzuhören.“ Er bemerkte die leichte Ungeduld des Hauptkommissars, der auf seine Uhr schaute. „Ich komme gleich auf Ihre Frage zu sprechen. Immerhin haben wir jetzt unter Muniel eine positive ökonomische Entwicklung genommen. Wir stehen nicht mehr vor der Schließung. Das gibt auch uns Motivation, einander zu helfen. Zum Beispiel sind wir bezüglich der Hausdienste flexibel, tauschen auch Dienste, wenn nötig, und besprechen viel untereinander, nicht nur oder selten mit dem Chefarzt und Oberarzt bei der Morgenbesprechung. Ich finde, dass sich viel gebessert hat, seit nur noch deutsche Kolleginnen und Kollegen hier arbeiten. Halten Sie mich bitte nicht für nationalistisch.“
Joe unterbrach ihn: „Gibt es negative Beispiele von früher?“
„In der Tat, Herr Hauptkommissar, haben wir leider negative Erfahrungen mit Ukrainern und Weißrussen gemacht. Ein Kollege aus der Ukraine mit unterdurchschnittlichen medizinischen Kenntnissen ging oder wurde vor einem halben Jahr gegangen; zuvor wurde er oft zum Geschäftsführer gerufen. Dieser ukrainische Arzt war einfach trotz aller Hilfsbereitschaft seinerseits und auch unsererseits sichtlich ungeeignet, weil er keine Fortschritte machte, zu wenig lernfähig war und nach Monaten noch keine vernünftige Anamnese aufnehmen konnte. Die Visiten waren und blieben ein Graus. Man kam sich vor wie in der Hauptschule. Dabei war er so rührend. Mir brachte er zum Beispiel von der Kantine immer Plätzchen mit. Ich erinnere mich noch an dieses regelmäßige mittägliche Ritual: ‚Doktor Freund, Sie sehen aus so hungrig mit hohlen Augen. Warum nicht gegangen zum Mittagessen? Immer nur arbeiten der Doktor Freund!‘ Der Chefarzt wollte ihm noch etwas Zeit lassen und hatte sogar angefangen, die Entlassungsbriefe des Kollegen selbst zu diktieren. Schließlich riss dem Geschäftsführer Muniel der von Haus aus schon zu kurze Geduldsfaden. Zur Art und Weise der Entlassung kann ich nichts sagen. Aber der Kollege soll ziemlich wütend aus dem Haus gestürzt sein; offenbar ist er doch sehr gekränkt worden. Von hier aus ist er, wie man hörte, in die Ukraine gegangen, wo er ja herkam.“
Kommissar: „Wie hieß der Kollege?“
Freund: „Irgend etwas wie Cervinowich. Nein, das heißt ja ‚Hirschchen‘. Ein Platzhirsch war er nicht, unsere Schwestern waren eher kühl mit ihm, sondern – jetzt kommt es mir wieder – Cerebellinowitch oder so. Heimlich nannten wir ihn nämlich frei übersetzt ‚Kleinhirnchen‘; immerhin war er motorisch sehr geschickt und konnte so gut die Venen punktieren und Blut abnehmen wie keiner von uns, sodass wir ihn bei schwierigen Venenverhältnissen um Hilfe baten, während er bei der organisatorischen Stationsarbeit eher hilfebedürftig war.“
Tatsächlich dachte Oliver Freund mit gemischten Gefühlen an diesen Kollegen zurück. An ihn konnte er sich besonders gut erinnern, obwohl noch andere aus diesen osteuropäischen Ländern kurz hier arbeiteten und sei es auch nur als sogenannte Leihärzte.
„Auch in der Klinik gibt es also offenbar Symbiosen, nicht nur im Tier- und Pflanzenreich“, entfuhr es Joe offensichtlich amüsiert.
Olli Freund lachte und ergänzte: „Noch was! Dieser Kollege stellte die Genetik auf den Kopf: Igor Cerebellinowitch gab immer mit seinem angeblich eineiigen Zwillingsbruder an, der manuell nicht so geschickt sei, aber ‚weißt du, großer, großer Wissenschaftler in Molekulargenetik! Mein Bruder Alexander arbeitet und forscht bei Transplantationsteam an Universität in Kiew als wissenschaftlicher Angestellter.‘ Von wegen eineiig, dachte ich. Stattdessen nahm ich an, dass seine Mutter da einmal von einem Akademiker in der Uni beglückt wurde, als sie dort in der Kantine arbeitete.“
„Das ist ja interessant“, meint Joe, „weil möglicherweise Kooperationen unseres Transplantationszentrums der benachbarten Uniklinik Frankfurt mit Kiew bestehen könnten. Da können wir vielleicht etwas über beide Brüder herausfinden. Was mich wundert, ist, dass Sie das Betriebsklima fast rosig darstellen, wobei gerade mindestens drei Kollegen gekündigt haben sollen. Haben Sie denn auch gekündigt?“
„Nein, Herr Moser, ich habe ein Haus und eine Familie und werde schön hierbleiben.“
Hauptkommissar Moser schaute Herrn Doktor Freund ernst unter seinen buschigen Brauen an und meinte: „Herr Doktor Freund, danke für das Interview. Zur Beruhigung – wie ein Mörder sehen Sie wahrlich nicht aus.“
Freund lächelte: „Danke, höflich, Herr Kommissar, wer hätte das gedacht.“
Der Hauptkommissar notierte sich den Namen des ukrainischen Kollegen und bat über das Telefon die Klinikinformation, den Personalleiter die alte Personalakte suchen zu lassen.
Als Nächste kam die Assistenzärztin Frau Doktor Irma Seidler ins Besprechungszimmer. Sie blickte sichtlich nervös um sich. Normalerweise fanden in diesem Raum die Morgenbesprechungen mit dem Chefarzt statt. Joe begrüßte sie mit einem einladenden Lächeln, als er ihre Anspannung sah. Sie mochte Mitte dreißig sein, hatte glatte, lange, dunkelbraune Haare und ganz klare, merkwürdigerweise blaue Augen, die den Kommissar fragend, aber auch prüfend ansahen. „Entschuldigen Sie, in einer halben Stunde muss ich meine jüngste Tochter von der Schule abholen.“
Der Kommissar lächelte: „Kein Problem, wir machen schnell. Wie lange arbeiten Sie denn im Buchenhain, Frau Doktor?“
„Zwei Jahre. Seit meine beiden älteren Kinder in die Ganztagsschule gehen und mein Mann auf achtzig Prozent reduziert hat, konnte ich wieder in den Beruf zurückkehren. An Nachtdiensttagen kann mein Mann dann einen Tag zu Hause bleiben.“
Joe bewunderte Frauen, die die Doppelbelastung so toll organisierten. Im Laufe des Gesprächs fand er heraus: Frau Doktor Seidler war eine intelligente Frau von vierunddreißig Jahren, die trotz der etwas herben Gesichtszüge sehr sympathisch war, besonders wenn sie lächelte. Sie wirkte sportlich mit schnellen Bewegungen. Trotz der Nervosität waren ihre Bewegungen aber präzise. Lag es an einem eingebauten Ritardando der Handbewegungen? Spielte sie Geige?
Er bemerkte allerdings das Flackern ihrer Augenlider. Sie schluckte bei Fragen und wurde schnell rot. Nach seinen Profilerkenntnissen vermutete er eine Frau, die wahrscheinlich schlecht lügen konnte. Sie wirkte eher direkt und manchen Männern ein bisschen friesisch herb, obwohl sie Hessin war. Joe dachte an eine Vorlesung über Lügen und Sympathie vor zwei Monaten. „Angeblich wirken Menschen, die schon mal lügen, sympathisch, wenn man den Untersuchungen des Psychologen Professor Feldman über diesen paradoxen Sachverhalt glauben kann. Auch Altpräsident Clinton soll ja gerade wegen seiner Lügen keine Sympathieeinbußen erlitten haben – im Gegenteil – und später sogar als Vermittler in der Außenpolitik als besonders glaubwürdig gegolten haben. Verrückte Welt!“
Joe konzentrierte sich wieder auf Frau Doktor Seidler und nickte anerkennend: „Also Wiedereinstieg in den Beruf nach der Kinderauszeit!“ Er bemühte sich um einen lockeren Plauderton. „Wenn man nach einer Zeit des Abstandes wieder zurückkommt, nimmt man wohl Ungereimtheiten, vielleicht Missstimmungen im Alltag eher wahr, als wenn man seit Jahren im gleichen Trott steckt.“
Sie nickte. „Das könnte stimmen. Aber worauf wollen Sie hinaus?“
„Könnten Sie mir aus Ihrer Sicht die Stimmung oder das Klima in der Abteilung und im Krankenhaus schildern? Vielleicht ist Ihnen auch gestern um die Vormittagszeit etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Was erzählt man sich in der Kantine und welchen Eindruck haben Sie bei den Morgenbesprechungen?“
Sie überlegte und zog dabei die Stirn in Falten. „Zur fraglichen Zeit war ich schon zu Hause, weil ich Nachtdienst hatte. Die Stimmung ist seit einigen Monaten insgesamt besser geworden. Ich selbst spüre weniger Zukunftsangst, wir Assistenten wurden vom Geschäftsführer – oh Wunder – sogar gelobt. Oder vielleicht lobte der wegen der positiven Zahlen indirekt nur sich selbst, weil wir im letzten Jahr erstmals schwarze Zahlen geschrieben haben. Der Geschäftsführer kommt mir ehrlich gesagt sehr unnahbar, ja fast eiskalt vor. Gestern Vormittag beobachtete ich, wie Muniels Sekretärin wie jeden Mittwoch angezogen eiligen Schrittes aus der Tür des Verwaltungsschlösschens kam, als ich gerade wegfuhr.“
Frau Doktor Seidler stockte kurz, sodass Joe Moser fortfuhr: „Trotz der angeblichen Verbesserung der Stimmung kündigen gerade jetzt Assistenzärzte.“
„Das ist, wie ich meine – ich verstehe ja von Psychologie und Motiven bei Ärzten so viel wie eine Kuh vom Trompetenblasen – in der Tat ein anderes Kapitel – fast so komplex wie eine geriatrische Diagnose! Die Krankenhausszene ist mobiler geworden. Die nicht Ortsgebundenen wollen ins Ausland und in den Süden Deutschlands.“
„Okay, aber woran liegt es, dass es in den letzten Monaten besser geworden ist, jetzt aber Leute kündigen? Ist der Geschäftsführer plötzlich ein angenehmer Mensch geworden?“
„Es ist nicht der Geschäftsführer, sondern das zusammengeschweißte Team, einschließlich der Chefärzte. Mir gefällt es deswegen, weil wir zusammenhalten und mein Chef, Professor Seneca, zu uns hält und überhaupt ein toller Mensch ist. Er maßregelt nicht, sondern erklärt und übernimmt zum Beispiel schon mal einen schwierigen Entlassungsbericht selbst, ohne viele Worte zu verlieren. Vor sechs Monaten war das anders! Bei Personalmangel wurden bis dahin vermehrt Russen, Ukrainer und Weißrussen neben Arabern eingestellt. Die waren einfach schlechter ausgebildet als wir, sprachen nur dürftig Deutsch und ihre Entlassungsberichte waren nicht nur nicht rechtzeitig fertig, sondern eine Zumutung. Auch gab es immer Zoff auf der Station, besonders die Schwestern waren sauer, weil diese Kollegen Medikamente falsch und unleserlich eintrugen et cetera.“
„Wissen Sie noch Namen?“
„Oh, Sie meinen von den letzten zwei Jahren? Die haben so entsetzlich komplizierte Namen wie Cerebboll?? Oder bellovich? Sagen wir doch einfach Kleinhirnchen und Alanari oder Ahmadhi.“ Die Assistenzärztin hob den Zeigefinger. „Ich bin einfach glücklich, dass wir das Problem jetzt los sind. Wissen Sie was, wenn ich Kommissarin wäre, würde ich den Computer von der Personalabteilung auf alle fremd klingenden Namen durchsuchen lassen. Der Personalleiter wird zwar sauer sein, aber er kann ja auch einmal seinen Hintern bewegen und was schaffen, wie die Schwaben sagen würden.“
Die Frau Doktor ist wirklich herzerfrischend, dachte Herr Moser bei sich, beeilte sich aber, sich bei ihr zu bedanken, und entließ sie mit einem Schmunzeln: „Vielen Dank, eine Superidee! Wenn ich einen Bonus zu vergeben hätte, würde ich ihn gleich für Sie vorschlagen.“
Eine leichte Röte überzog das Gesicht der Assistenzärztin, bevor sie den Hauptkommissar wegen seines Charmes unschlüssig ein bisschen misstrauisch anblinzelte, dann aber abrupt mit schnellen Schritten, ohne sich noch einmal umzusehen, hinausging.
Im Laufe der Befragungen tauchten noch zwei Namen von Assistenten, die frühzeitig in der Probezeit entlassen wurden, auf. Joe nahm sich vor, ihre Aufenthalte ermitteln zu lassen. Bei der schwierigen Kooperation mit den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, der Ostblockstaaten und den arabischen Ländern, die keine perfekte Verwaltung haben, besonders nach der arabischen Revolution, war das ein Suchen nach der berühmten Stecknagel im Heuhaufen. Doch die Zeit drängte.
Der Hauptkommissar traf sich mit Kollegin Gerngross um vierzehn Uhr siebenundvierzig in einem separaten Raum der Kantine zur Besprechung. Sie gab ihm ein Stimmungsbild vom Fußvolk, wie sie das Pflegepersonal nannte. Es schälte sich heraus, dass tatsächlich seit einem halben Jahr Ruhe unter den Mitarbeitern und minimal mehr Zufriedenheit bei den Schwestern, den Therapeuten und dem technischen Personal eingekehrt war. Die Pflegedienstleitung und die Pflegedirektorin berichteten auch, dass der Ton untereinander wohl freundlicher geworden sei, was auf weniger unnötigen Stress hindeuten würde. Welch ein Wunder bei diesem Geschäftsführer! Die Schwestern hören die Buschtrommeln in einem Krankenhausbetrieb ja bekanntlich eher und intensiv wie sonst nur die Putzfrauen und berichteten von zwei Assistenzärzten, die schon früh nach Arbeitsantritt als nicht optimal aufgefallen seien und bei denen die Verwaltung aktiv geworden sei. Ein Doktor Cerebelliniwitch oder so ähnlich und ein Doktor Medjanovich oder Medjedew wurden spontan genannt, die wohl etwas aufbrausend waren und deren Auftreten im krassen Gegensatz zu ihren Leistungen stand. Einer sei sogar manchmal anzüglich geworden.
„Danke, Gertrude, das geht alles in die gleiche Richtung. Ich ruf mal die KTU an.“
Die KTU berichtete von den ausgewerteten Fingerabdrücken. Tatsächlich seien Fingerabdrücke an einer Tasse nachweisbar, die keinem derzeitigen Mitarbeiter zugeordnet werden könnten.
Joe klappte sein Handy zusammen und berichtete Gertrude davon. „Wo ist der Fremde oder die Fremde? Willst du mit der Personalabteilung über die Adressen der ausländischen Ärzte sprechen? Vielleicht haben wir ja Glück.“
Gerngross hatte zuvor schon von der Pflegedirektorin erfahren, dass für Muniel eine neurologische Reha vereinbart und von der Privatkasse bewilligt worden war – kein Wunder bei der Zweiklassenmedizin und der Hoffnung auf Weiterbeschäftigung!
Joe rief den Chefarzt an und erfuhr: Die weitere Strategie und das Rehaziel seien eine Aktivierung des Gedächtnisses für den unmittelbaren Zeitraum vor Wirkungseintritt der K.-o.-Tropfen. Der Chef in der Reha habe sich mit diesem Thema, Gedächtnisverlust und Stress, habilitiert. Vielleicht konnte man ja doch Hinweise auf den unheimlichen Besucher und Mordverdächtigen gewinnen.
Noch einmal traf sich Joe mit dem Chef der Inneren Abteilung, Professor Bernd Pfeifferlich, um etwas über Muniels Befinden und was man mit ihm vorhabe zu erfahren. Der erzählte ihm überraschend, dass Muniel im Moment, nachdem sein Kopf klar geworden sei, eher sanfter wirke und das Schroffe und Überhebliche nicht mehr wahrnehmbar sei. Auch sei er mit der Aussicht auf Reha mehr als einverstanden. Er lasse sich auf alles ein, um wieder gesund und leistungsfähig zu werden. Das ließ hoffen! Die genaue neuropsychologische Testung werde, so Professor Pfeifferlich, einen genaueren Einblick in das Arbeitsgedächtnis, die Informationsverarbeitung und das Denkvermögen geben, sodass auch die berufliche Situation und Perspektiven klarer würden. Auch solle eine spezifischere mentale Aktivierung möglich sein, sodass auch das Wiedererkennen des Täters nicht ganz unrealistisch sei.
Auch Frau Muniel freute sich, dass die rastlose Ungeduld und Aggression ihres Gatten momentan verschwunden war. Er perseverierte nur, indem er immer wieder fragte: „Liebling, sag mir: Habe ich einen Schlaganfall erlitten?“
Amalie streichelte seine Hand, nickte nur optimistisch und sagte: „Alles wird wieder gut.“
Professor Pfeifferlich hatte ihr beim Eintreffen Mut gemacht. Der hatte ihrem Mann zuvor fünfmal den Sachverhalt zu erklären versucht. Schließlich sagte er nur noch: „Das wird schon wieder.“
Herr Muniel schüttelte nur den Kopf, weil er sich an nichts Konkretes erinnern konnte, außer daran, dass er am Vortag in einer Vorstandssitzung gewesen sei und zu Hause mit seiner Frau Wein getrunken habe. Die genaue zeitliche Zuordnung machte ihm wohl große Probleme. Ein klassischer Fadenriss!
„Da ist noch viel zu tun, um das Hirnprogramm wiederherzustellen“, murmelte der Intensivpfleger, der ein Computerfreak war.
Amalie hatte ihrem Mann gleich bei ihrer Ankunft einen schmatzenden Kuss gegeben. Sie glaubte, sie könne die Liebe mit dem Wiederbelebten gleich mit beleben oder die Leute der Klinik, die bislang von einer schlechten Ehe gemunkelt hatten, vom Gegenteil zu überzeugen. Es blieben Zweifel.
„Wird es wirklich wieder gut?“, fragte sie alle möglichen Leute auf der Station.
Der Chefarzt tröstete sie: „Die Hoffnung stirbt zuletzt, Frau Muniel. Wir sind eher optimistisch. Er hat ja einen Überschuss an Hirnzellen und Nervenverbindungen – auch Synapsen genannt – mitgebracht, was wir auch am Hirnvolumen im CT sahen, und er ist noch jung, sodass er auf ein paar untergegangene Zellen getrost verzichten kann.“
„Sie sind so gut“, hauchte Amalie Muniel sichtlich gerührt.
Der gab sich bescheiden: „Jetzt kommt es auch auf Sie an, die Genesung zu unterstützen.“
Hauptkommissar Moser und Kommissarin Gerngross waren noch einmal auf der Intensivstation aufgetaucht und begrüßten die Ehefrau. Sie wollten sie ebenfalls befragen und gegen Abend ihr Haus aufsuchen.
„Frau Muniel, wir haben noch einige Fragen. Fühlen Sie sich schon dazu imstande? Außerdem müssten wir Sicherheitsmaßnahmen für Sie und Ihren Mann besprechen.“
Frau Muniel bedankte sich und versprach, einen Rotwein bereitzustellen. „Oder trinken die Herrschaften lieber einen trockenen Weißwein?“
„Wir sind im Dienst, aber vielleicht wäre ein Gläschen Rotwein gar nicht so schlecht, um etwas herunterzufahren und einen klaren Kopf zu bekommen.“
„Sie haben uns ja alle so geholfen. Ich will alles tun, dass dieser Mordanschlag aufgeklärt wird“, flüsterte die Ehefrau.
„Ist schon gut, Frau Muniel, bedanken Sie sich vor allem bei den Ärzten, besonders beim Oberarzt von Risseck, der Ihren Mann gefunden hat. Ich glaube, er würde einen guten Tropfen auch zu schätzen wissen“, empfahl ihr Joe Moser.
„Gute Idee. Herr von Risseck ist ja so sympathisch und eine echte Führungskraft, wie mein Mann, als er noch mit mir sprach, immer betont hatte“, flüsterte sie sichtlich gerührt.
„Hat Ihr Mann zu Hause von Sorgen und Problemen oder Ängsten gesprochen?“
„Leider in den letzten Monaten nur sehr selten, er war so gestresst, kam spät nach Hause, schlecht gelaunt und aggressiv, als hätte er vor einem Burn-out gestanden.“
„Wurde er erpresst?“, warf Gertrude Gerngross ein.
Frau Muniel schaute sie nur verwirrt an.
„Wir sehen uns ja dann um neunzehn Uhr?“, unterbrach der Hauptkommissar die Unterhaltung und lächelte seine Kollegin an. Beim Weggehen ahnte er zumindest die Logik der möglichen Abläufe der Tat und des Motivs. Er dachte an einen Zusammenhang zwischen kalter verletzender Distanziertheit Muniels und Hass und Wut von Seiten des Täters.