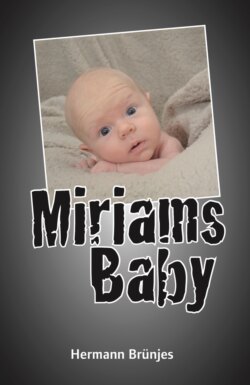Читать книгу Miriams Baby - Hermann Brünjes - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Mittwoch, 4.12.
ОглавлениеIm Sitzungssaal II wird gegen einen Kleinkriminellen verhandelt, der in der Kreisstadt mehrfach Einbrüche verübt und als nächtlicher Störenfried mit Gewaltpotenzial in und vor einschlägigen Lokalen aufgefallen ist. Dem Richter platzt angesichts der belastenden Vorwürfe gegen Werner S. der Kragen:
»Es reicht! Sammeln Sie in den nächsten Monaten statt der Anzeigen gegen Sie erst einmal zwei bis drei Gedanken darüber, wie Sie Ihr Leben in den Griff bekommen. Ich gebe Ihnen dafür ein kleines Zimmer und vier Wochen in der JVA bei freier Verpflegung. Damit derweil die Bürger unserer Stadt ein ruhiges Weihnachtsfest verbringen können, treten Sie Ihre Auszeit gleich von hier aus an. Die vier Tage in Polizeigewahrsam werden ihnen angerechnet.«
Ein Richter greift durch. Ich bin gewiss, dass sich während der Partys und Trinkgelage der Adventswochenenden andere Chaoten finden, die Werner S. würdig vertreten. Unserem KB wird der Stoff jedenfalls nicht ausgehen. Der Kollege, den ich vertrete, wird nach seiner Genesung die Gerichtsberichte allerdings wieder selbst schreiben müssen.
Am Ausgang stoße ich beim Öffnen der Glastür fast mit einem Mann meines Alters zusammen.
»Schorse!«
»Jens! Was machst du denn hier?«
Schorse, mit richtigem Namen Georg Martens, kenne ich noch aus meiner Zeit bei den Pfadfindern in der Nähe von Bremen. Wir waren damals dicke Freunde. Dann haben wir uns aus den Augen verloren. Er ging zur Polizei, ich zur Zeitung. Vor einigen Jahren haben wir wieder Kontakt bekommen und uns seitdem gelegentlich getroffen. Er ist in Lüneburg bei der Kripo gelandet.
»Na, das muss ich dich ja wohl erst recht fragen. Du hast dein schönes Lüneburg verlassen und kommst in meine Provinzmetropole.«
»Dienstlich, nur dienstlich!« Schorse lacht. »Ich muss als Zeuge zu einer Verhandlung wegen mehrerer Autodiebstähle. Wir haben einen Typen aus eurer schönen Stadt bei uns erwischt, als er einen BMW klauen wollte.«
Schorse muss sich beeilen. Wir verabreden uns zum Mittagessen in der Innenstadt. Ich schwinge mich auf mein Stevens-Crossrad und düse in die Redaktion.
*
Den Artikel über Werner S. zu schreiben ist ein Kinderspiel. Meinem geschätzten Kollegen gestehe ich gerne zu, mal krank zu sein – aber das wird er nicht durch Arbeitsüberlastung. Er hört sich im trockenen Gerichtssaal die kleinen oder auch größeren Geschichten an, setzt sich hin und schreibt seine Artikel. Kein Gerenne, keine weiteren Recherchen, keine zusätzlichen Interviews, wetterunabhängig. Welch ein ruhiges Reporterleben!
Allerdings nichts für mich! Ich brauche Abwechslung, Herausforderungen, Geheimnisse und manchmal auch Action.
Dass ich seit über dreißig Jahren beim Kreisblatt hängengeblieben bin, lässt das Gegenteil vermuten. Okay, das mag auch an meiner notorischen Trägheit liegen, oder an meiner gescheiterten Ehe, oder weil sich ein paar Gelegenheiten zerschlagen haben. Es liegt jedenfalls nicht daran, dass sie mich zum Ressortleiter oder sonst wohin in besser bezahlte und dafür arbeitssparende Regionen befördert hätten. Im Gegenteil. Mindestens dreimal bin ich übersprungen worden. Die meisten Chefs in unserem Verlagshaus sind inzwischen viel jünger als ich, mal abgesehen von Chefredakteur Florian Heitmann. Kaum jemand glaubt es mir, weil fast alle auf der Karriereleiter nach oben klettern wollen. Trotzdem stimmt es: Die Arbeit als normaler Journalist an der Basis macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Es stimmt natürlich, dass sich vieles wiederholt. Feuerwehr, Schützen, Kreis- und Rathauspolitik, Autobahn A39, der böse Wolf, Veranstaltungen, Vereine – und so weiter! »Immer dasselbe« sagen viele. Eben Käseblatt-Niveau. Mag sein. Aber es macht Spaß, den vielen verschiedenen Leuten zu begegnen, in unzählige Milieus und Lebensräume hineinzukommen und Denkweisen und Überzeugungen aller Art kennenzulernen. Ich liebe das. Genau deshalb ist mir auch die aktuelle Recherche um Weihnachten ein besonderer Genuss.
Hinzu kommt meine Freiheit. Die Redaktionssitzung – sonst habe ich keine regelmäßigen Verpflichtungen. Gleitende, selbst bestimmte Arbeitszeit, keine Residenzpflicht, Spesenabrechnungen gemäß der Belege – fertig! Klar, wenn ich Termine ausmache, sollte ich die einhalten, will ich nicht alle Sympathien verscherzen. Aber wann und wo ich einen Termin mache, entscheide ich selbst. Das nenne ich Freiheit!
*
Besonders frei fühle ich mich, wenn ich auf meinem Fahrrad sitze. Ich spüre den Luftzug, komme voran und kann auch schmale Gassen und Fahrspuren nutzen. Meinen Golf lasse ich folglich so oft es geht vor dem Haus stehen. Energiesparen? Sicher, aber ein echter Klimafanatiker ist aus mir nie geworden, weder 2019 Jahre nach Christus noch 1 Jahr nach Greta Thunberg.
Jetzt stelle ich mein Rad vor dem »Einstein« am Rande der kleinen Fußgängerzone ab und schließe es an eine Laterne. Stühle, Tische und Sonnenschirme sind längst weggeräumt. Im November gab es bereits Nachtfrost und auch der Dezember hat kühl und trübe begonnen. Nicht nur in den Dörfern, auch in der Stadt halten sich die Leute jetzt vor allem drinnen auf.
Entsprechend voll ist der Gastraum des Bistros. Die rustikalen Tische sind vor allem mit Angestellten der umliegenden Büros besetzt. Sie genießen den günstig angebotenen Mittagstisch.
Schorse sitzt an einem Zweiertisch direkt an der Wand.
»Jens, hier!«, er winkt mir zu. »Bei mir ging es doch schneller als gedacht.«
Wir bestellen beide das Gleiche, Schweineschnitzel mit geschmorten Zwiebeln, Champignons, Pommes und einem großen Alster.
Es ist schön, einen so alten Kumpel wiederzusehen. Wir albern herum.
»Schweineschnitzel! Da fällt mir unser Spanferkel ein!«
Wir lachen beide, erinnern wir uns doch ausgesprochen gut an jene wilde Zeit bei den Pfadfindern. Jemand hatte uns ein Spanferkel gespendet. Beim Herbstmarkt hatten wir es portionsweise verkauft und über hundert Mark eingenommen. Und was haben wir damit gemacht? Wir sind hungrig und durstig in unseren Stammimbiss gegangen und haben Kotelett, Pommes und Bier für die gesamte Summe verzehrt. Auf Deutsch: Alles wieder versoffen und verprasst.
Es ist wirklich schön, die alten Zeiten noch einmal aufleben zu lassen. Schorse und Jens in Kluft mit grauem Hemd und blauem Halstuch, Stammeslager, Wimpel, Nachtmarsch, Lagerbau, Knotenkunde, Feuermachen – ach, das waren wirklich tolle Zeiten.
»Was macht wohl der kleine Schissie heute?«
»Keine Ahnung. Vielleicht drillt er seine Urenkel mit Bibel und Schlüsselbund.« Wir lachen so laut, dass Leute vom Nachbartisch herübersehen.
Wir hatten damals zwei »Führer«, ja so hießen die Ober-Pfadfinder immer noch, auch über zwanzig Jahre nach dem Führer. Besonders der kleine Schissie, der jüngere Bruder vom großen Schissie, war ein scharfer Hund. Wir hatten zu gehorchen und zu spuren. Wenn nicht, flog ein Schlüsselbund – oder eben, weil wir ja christliche Pfadfinder waren, eine dicke, kantige Bibel.
»Und, Jens, woran arbeitest du gerade?«
Die Frage kommt für mich etwas unvermittelt. Ich erzähle ihm von meinem Weihnachtsprojekt.
»Na, da kannst du ja nahtlos an die Pfadfinderzeit anknüpfen! Weißt du noch, die Andachten mit Ewald?«
Allerdings, wie könnte ich die kurzen aber eindrücklichen Andachten mit dem Nachfolger von Schissie je vergessen. Ewald war ganz anders. Er kümmerte sich um uns und interessierte sich für das, was wir gerne mochten. Als ich ihn, den inzwischen über Achtzigjährigen im Sommer besucht habe, fühlte ich mich in seinem Haus sofort wieder geborgen und angenommen.
»Und woran arbeitest du? Welche Ganoven jagt ihr gerade? Ach nee, du bist ja inzwischen bei der Mordkommission. Also welche Mörder jagt ihr?«
Schorse wird plötzlich ernst.
»Wir jagen diesen Kindermörder. Aber wir kommen einfach nicht weiter!«
Ich hatte davon natürlich gelesen, jeder hatte das. Und jede und jeden hatte es gegraust, vor allem in Gedanken an die eigenen Kinder. Im großen Waldgebiet an der Kreisgrenze hatte man zwei Babyleichen gefunden. Beide konnten bis heute nicht identifiziert werden. Oder doch? Vor mir saß der zuständige Kommissar.
»Habt ihr die Babys inzwischen identifiziert?«
Er zögerte, bevor er sprach.
»Wir sind inzwischen sicher. Du musst es für dich behalten. Bloß nichts an die Presse!«
Er lacht und als ich ihm mein okay gebe, weiß er, dass ich mein Versprechen halte.
»In einem Hamburger Mietshaus werden zwei Babys vermisst. Leider haben wir wegen schlampiger Aktenführung und fehlender Vernetzung zwischen den einzelnen Dienststellen viel zu lange gebraucht, dies zu ermitteln. Bereits seit dem sechzehnten Oktober sind die Babys verschwunden, einfach weg. Anhand der DNA haben wir erst seit ein paar Tagen die Gewissheit, dass es sich um genau diese Kinder handelt.«
Ich bin geschockt.
»Waren es Geschwister?«
»Seltsamerweise nicht. Sie wohnten einfach nur im selben Haus. Die Eltern hatten nichts miteinander zu tun. Sie kannten sich nur vom Sehen.«
»Also kein Familiendrama.«
»Wohl nicht. Die Babys sind vermutlich entführt worden.«
»Wie kommt ihr darauf?«
»An besagtem Tag wurde ein Kastenwagen vor dem Haus gesehen. Zwei Männer saßen lange Zeit darin ohne auszusteigen.«
»Es könnten also die Entführer gewesen sein? Gibt es ein Nummernschild, Personenbeschreibungen oder so etwas?«
»Fehlanzeige. Nur drei Anwohnern ist das Fahrzeug aufgefallen. Keiner von ihnen hat sich etwas Brauchbares gemerkt.«
»Aber wie konnten die Babys einfach so entführt werden?«
»Das eine Baby schlief auf der Wiese vor dem Haus im Kinderwagen, das andere stand nur ganz kurz unbeaufsichtigt im Buggy vor der Wohnungstür im ersten Stock.«
»Da müssen die Entführer eine Menge Glück gehabt haben! Gibt es Lösegeldforderungen?«
»Ebenfalls Fehlanzeige! Eine der Mütter ist alleinerziehende Verkäuferin. Sie hat noch eine kleine Tochter. Die Eltern des andern Babys haben noch zwei Kinder im Kindergartenalter und leben von Hartz IV. Bei beiden gibt es also nichts zu holen.«
»Was ist mit sexuellen Motiven?«
Mir wird übel wenn ich so etwas auch nur denke. Wie kann man Kleinkinder oder gar Babys missbrauchen? Das ist einfach nur pervers. Allerdings, wenn jemand Babys tötet und sie in einen Fuchsbau steckt, erscheint auch alles andere möglich.
»Die können wir ausschließen. Der oder die Täter haben die Kinder ausgezogen, vermutlich um Spuren zu vernichten, und sie dann einfach entsorgt. Du hast ja wohl in eurem Konkurrenzblatt gelesen, wie.«
Ich spüre, dass meinem Freund das Thema unangenehm wird. Er hat ja recht. Wir treffen uns seit langer Zeit endlich wieder und essen und klönen gemütlich. Da sollten berufliche Probleme Nebensache sein. Wir haben gegessen – inzwischen sind unsere Teller leer.
»Noch ein Bier?«
Wir bestellen uns noch ein Alsterwasser. Er fragt mich nach einer neuen Beziehung. Ich halte mich zurück. Von Maren Bender weiß er nichts und muss auch nichts wissen. Er hat den Fall damals mit Sicherheit in den Medien verfolgt, mir ja sogar einige Tipps gegeben. Ich will aber jetzt nicht schon wieder in ein kriminelles Fachgespräch abrutschen.
Er erzählt mir von seinen Kindern. Ich frage nach seiner Frau und wie die Ehe so läuft. Alles gut, meint er, nur dass Frauen oft schwer zu verstehen und für ihn oft ein Geheimnis sind. Ach Schorse, wie ich dich da auf Anhieb verstehe ...
»Immerhin, ich bin aus Sicht meiner Kollegen ein seltenes Exemplar. Über 25 Jahre mit derselben Frau verheiratet! Das gibt es im gesamten Lüneburger Kommissariat kein zweites Mal – abgesehen von einem Inspektor in der Asservatenkammer. Die meisten Polizisten-Ehen gehen leider nach wenigen Jahren kaputt.«
»Wie bei den Journalisten.« Ich weiß, wovon ich rede.
*
Dunkelheit, schlechte Sicht, Nieselregen, Blätter auf der Straße, entgegenkommende Scheinwerfer – eine Fahrt über Land an einem Dezemberabend ist kein Vergnügen. Es wird bereits gegen fünf Uhr dunkel. Jetzt ist es kurz vor sieben.
In Himmelstal werde ich überrascht. Die alte Dorfkirche wird angestrahlt und leuchtet weihnachtlich. Alles Grau von gestern und von unterwegs ist vergessen. Die bunten Fenster sind von Innen erleuchtet. Ein Juwel, diese Kirche!
Drinnen geht es gänzlich anders zu als in jenem Gottesdienst, den ich hier im Sommer erlebt habe. Die jungen Leute aus der Hausgemeinde sitzen in den ersten zwei Reihen, dahinter mindestens fünfzig Konfirmandinnen und Konfirmanden. Als ich komme und mich in die Reihe hinter die Jugendlichen setze, ist es unruhig. Viele quatschen, einige albern herum. Wie man es von »Konfis« kennt. Einige Nachzügler stürmen in die Kirche, als gehöre sie ihnen. Heilige Gefühle bekommt angesichts des sakralen Raumes jedenfalls niemand. Auch die antiken Kronleuchter, die Wandleuchten, die Kerzen am Altar oder der angestrahlte Corpus Jesu am Kreuz werden von den Jugendlichen vermutlich kaum wahrgenommen. Die Nachzügler quetschen sich in eine bereits voll besetzte Bank.
Christian scheint für diese Andacht zuständig zu sein. Er läuft vorne hin und her, verteilt noch ein paar Liederbücher und sortiert eine überbelegte Reihe um. Vor mir sitzen zwei ältere Jugendliche, vermutlich Mitarbeiter aus der Gemeinde dieser Konfirmanden. Einen dazugehörigen Pastor sehe ich nicht.
Mit einigen Minuten Verspätung geht es los. Christian baut sich vorne auf. Er sagt zunächst nichts, schaut nur in die Gruppe. Das Wunder passiert. Als drehe man den Lautstärke- Knopf am Radio, wird es langsam leiser. Als Christian seine Ansagen macht, ist es nach wenigen Sekunden still. Die Gruppe ist erst vorhin vor dem Abendessen mit einem großen Reisebus angereist. Wie die Andacht läuft, weiß also niemand. Ein Heft hilft, die Texte mitzusprechen und die Lieder mitzusingen.
Am elektrischen Klavier sitzt Jakob. Er ist mir gestern kaum aufgefallen. Vielleicht ist er der ruhige Pol in der aktuellen Hausgemeinde. Klavierspielen kann er jedenfalls, zumindest so, dass man mitsingen kann. Anna Lena steht neben dem Klavier und leitet den Gesang. Es sind durchgehend neue Lieder, einige in Englisch. Ich habe den Eindruck, die Konfis möchten zwar, können aber nicht so recht mitsingen, da die Lieder ihnen fremd sind. Trotzdem, jetzt sind sie voll da ...
Christian führt durch die Andacht. Aufstehen, Hinsetzen, das gibt es auch hier. Anna Lena ist heute mit einer Auslegung zu einem Bibeltext dran. Wie alt mag sie sein? Ich schätze achtzehn.
Sie steht dort, als habe sie nie etwas anderes gemacht. Souverän erzählt sie den Jugendlichen etwas von ihrem Glauben. Sie bezieht sich dabei auf den Spruch für die erste Adventswoche. »Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer!« In mir klingeln Erinnerungen aus meiner Pfadfinderzeit. Auch Ewald liebte diesen Vers aus den Alten Testament.
Anna Lena macht es hervorragend. Sie schaut nicht nur auf ihr Manuskript, sie schaut auch die Konfirmanden an.
»Unmöglich! Ein König war noch nie bei dir zu Besuch, oder? Noch nicht mal ein Präsident oder ein Minister. Die gehen doch nur zu Ihresgleichen ...« Anna Lena beschreibt das unglaubliche Ereignis von Weihnachten im Bild des Propheten Sacharia. Weihnachten als Fest der Kleinen Leute, die ganz großen Besuch bekommen, Besuch von Gott, dem Chef und König vom Ganzen. Welche Aufwertung jener, die sonst nichts zu melden haben! Welche Liebe zu den einfachen Leuten! Anna Lena versteht es richtig gut, das Interesse für Jesus als diesen König zu wecken. Besonders als sie dann von sich selbst erzählt, spitzen alle die Ohren. Ich auch.
»Ich hatte mal ein echt mieses Selbstbewusstsein. In der Schule wurde ich von einigen Mädels gemobbt. Niemand fand mich nett oder interessant und wollte meine Freundin sein. Die Jungs sind auch nur auf die Tussis in unserer Klasse geflogen. Ich aber war eher eine graue Maus. Dann ging ich nach der Konfirmation in den Jugendkreis. Mehr und mehr befasste ich mich mit Jesus – und heute stehe ich hier vor euch! Das ist allein deshalb möglich, weil Gott zu mir gekommen ist, ausgerechnet zu mir, der ehemaligen grauen Maus.«
Schade, dass ich hinten sitze und deshalb die Gesichter der meisten Jugendlichen nicht sehen kann. Jene, die ich von der Seite sehe, sind aufmerksame, gespannte, ja gefesselte Gesichter. Es ist mucksmäuschenstill. Alle hören zu. In der Reihe vor mir stößt ein Junge in Kapuzenpullover seinen Nachbarn an und will eine Bemerkung machen. Der jedoch weist ihn zurecht: »Still!« Ob das Weihnachtswunder der Stillen Nacht bereits hier und heute beginnt?
Ich bin beeindruckt. Jetzt verstehe ich, was Theo Beyer meinte, als er davon sprach, dass die Hausgemeinde das »Herz des Hauses« sei und die Gäste auf die jungen Leute oft mehr hören als auf die Profis.
Nach einer halben Stunde ist die Andacht vorbei. Der Abgang hat es allerdings noch einmal in sich. Sie nennen es »Shake-Hands-Kette«. Einer beginnt, alle marschieren los und jeder wünscht jedem per Handschlag einen guten Abend. Bei über fünfzig Leuten dauert das. Nicht nur die Hand kommt ins Schwitzen. Eine junge Frau stellt sich mir als Pastorin der Gruppe vor. Ich hatte gedacht, sie sei ehrenamtliche Mitarbeiterin oder gar eine ältere Konfirmandin. Bin eigentlich ich in den paar Jahren so alt geworden? Oder sind Pastorinnen heute so jung? Oder beides?
Die Konfis stürmen aus der Kirche hinaus wie sie hinein gestürmt sind, geräuschvoll und schnell. Die Hausgemeinde klönt oder diskutiert noch im Altarraum. Für sie ist dieses Gotteshaus vermutlich inzwischen so etwas wie ein zweites Wohnzimmer. Ich sage Anna Lena, dass ich ihre Predigt gut fand. Sie freut sich riesig. Christian klopft ihr auf die Schulter und meint:
»Anna Lena ist ja auch die Beste von uns. Sie wird bestimmt mal Pastorin!«
»Blödmann, auch ihr anderen macht das gut mit den Auslegungen. Aber danke. Mir macht das echt Spaß und ich gebe gerne etwas von meinem Glauben an die Konfis weiter!«
Ich vermute, dass an Christians indirekter Einschränkung, was die Predigten der anderen angeht, etwas dran ist. Die Gaben sind ja wirklich verschieden. Vielleicht muss ich auch noch einmal wiederkommen, wenn Magda dran ist. Ob sie auch Zweifler zu Wort kommen lassen? Das wäre gewagt – aber sympathisch.
Beim Hinausgehen frage ich Christian: »Sag mal, macht ihr alle die Auslegungen zu Bibeltexten? Oder nur wer will?«
»Nee, wir alle machen das. So wie Putzen und Abwaschen gehört es zu unseren Aufgaben.«
»Und wenn jemand mit dem Glauben Probleme hat?«
Christian schaut mich an als habe ich bereits ziemlich viel in seiner Welt durchschaut.
»So wie Magda? Oder auch ich manchmal? Oder Yvonne? Oder Andreas? Oder Anna Lena? Herr Jahnke, wer von uns hätte denn keine Zweifel?«
Es verschlägt mir fast die Sprache. Das heißt schon was bei einem alten Reporter. Welch Weisheit aus jungem Munde!
*
Jede und jeder rennt so schnell es geht ins Trockene. Für mich ist das mein Golf. Es schüttet jetzt. Soll ich wirklich noch Maren Bender besuchen? Unangemeldet, einfach so?
Ich starte den Golf. Wieso er in Richtung Neubausiedlung fährt, kann ich nur vermuten. Jedenfalls stoppe ich ihn vor dem Haus der Witwe, an die ich so oft denken muss. Das Außenlicht geht sofort an. Seit einer Einbruchserie sind hier alle Häuser mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Ich zögere.
Dann stehe ich vor der Haustür, die Hand am Klingelknopf. Es läutet. Im Flur brennt Licht. Eine Frau kommt zur Tür. Es ist nicht Maren Bender.
Ich bin irritiert und höre mich leicht stottern.
»Entschuldigung, dass ich so spät hier auftauche. Ist Frau Bender zu Hause?«
Schnell schiebe ich noch nach, dass ich Jens Jahnke heiße und nur ganz kurz vorbeischaue, da ich gerade zufällig in Himmelstal bin.
Die junge Frau hat lange, dunkelbraune Haare, sieht irgendwie südländisch aus und ist ausgesprochen hübsch.
»Kommen Sie doch herein. Aber bitte sprechen Sie leise! Ich habe gerade meinen kleinen Jeschu ins Bett gebracht.«
Sie zeigt die Treppe hinauf. Jeschu? So hieß doch das Kind im Tagungshaus. Ob dies die Mutter ist?
Maren Bender kommt aus dem Keller, einen Korb mit Wäsche unter dem Arm. Ihr Gesicht verrät mehr als Erstaunen oder Überraschung. Sie strahlt mich freudig an, stellt den Korb weg und reicht mir die Hand.
»Herr Jahnke! Na, das ist aber eine Freude! Kommen Sie herein.«
Und an die junge Frau gewandt: »Miriam, das ist der Journalist, von dem ich dir schon so viel erzählt habe. Holst du uns etwas zu trinken? Wenn der Kleine schläft und du möchtest, kannst du dich auch gerne zu uns setzen.«
Miriam geht in die Küche.
Ich ziehe meine Regenjacke aus und gebe sie Maren, die sie in einen Garderobenschrank hängt. Vorsichtig entledige ich mich auch noch meiner schmutzigen Schuhe. Wie gut, dass ich mir heute die Socken ohne Loch gegriffen habe.
Ich folge der Hausherrin ins Wohnzimmer. Es ist stilvoll eingerichtet. Alte Eichenmöbel und moderne Sitzmöbel ergänzen einander. In einem weißen Kamin mit großem Sichtfenster und schwarzem Sims flackert es gemütlich. Ich setze mich in den Sessel neben der Feuerstelle. Schon nach kurzer Zeit durchzieht mich eine wohlige Wärme. Erst jetzt merke ich, dass es in der Kirche sehr kühl war.
Maren Bender freut sich, dass ich komme. Sie hat von mir erzählt, mich folglich nicht abgehakt und vergessen. Allerdings will sie nicht mit mir allein sein. Okay, das akzeptiere ich.
Von der ersten Minute an fehlt es uns nicht an Gesprächsstoff. Sie fragt mich nach meinem Eindruck vom Tagungshaus und der Andacht. Die neue Hausgemeinde hat sie persönlich noch nicht kennengelernt, allerdings über Miriam manches von den jungen Leuten drüben gehört. Miriam arbeitet als Praktikantin der Hauswirtschaft im Tagungshaus. Wie ich Theo Beyer finde, will Maren wissen und ob ich auch Andy und Petra getroffen habe.
Ich frage nach ihren Kindern. Ihr Sohn Benni hat jetzt eine Freundin, erzählt sie. Er arbeitet bei Porsche Stuttgart seit Anfang Oktober in einer anderen Abteilung. Caren lebt nach wie vor mit Sohn und Mann in Berlin. Mehrfach hat sie aber schon gesagt, dass sie am liebsten wieder zurück aufs Dorf ziehen würde. Typisch, kaum werden sie achtzehn, wollen fast alle Dorfkinder unbedingt in die Stadt - wenig später zieht es die Meisten zurück aufs Land.
Die junge Frau kommt und stellt einen mit Flaschen gefüllten Korb neben den Tisch. »Was trinken Sie? Bier, Saft, Wasser oder Wein?«
Welche Frage? Ich trinke prinzipiell alles.
»Ein Bier am liebsten. Ich muss ja noch fahren.«
Maren und Miriam trinken einen Rotwein. Die beiden Frauen ähneln sich. Beide haben leicht gelockte braune Haare, eine gerade Nase und braune Augen. Maren trägt eine weiße Hose und einen blassrosa Pullover, Miriam Jeans und ein hellblaue Strickjacke. Ich schätze Miriam auf Mitte zwanzig. Sie könnte Marens Tochter sein.
Ich frage Maren, wie es ihr seit unserer letzten Begegnung ergangen ist. Sie weicht aus. Stattdessen kommt sie auf Miriam zu sprechen.
»Dass Miriam hier ist, macht mich richtig glücklich!« Maren legt den Arm um die junge Frau. »Anfang Oktober ist sie mit ihrem kleinen Sohn völlig überraschend hier aufgetaucht. Sie hat sich um die Stelle der Hauswirtschaftspraktikantin im Tagungshaus beworben. Aber erzähl doch selbst, Miriam.«
Zu Beginn zögernd, dann etwas offener erzählt Miriam von sich. Sie hat zuletzt in Hamburg gelebt und ist alleinerziehende Mutter von Jeschu. Sie habe in der Stadt nicht mehr leben wollen und sich deshalb auf diese Stelle hier beworben. Da es im Tagungshaus für Mutter mit Kind keinen Wohnraum gab, hat der Geschäftsführer Andy Maren Bender gefragt.
»Und ich bin nun endlich nicht mehr allein im Haus!« ergänzt Maren. »Wir wechseln uns mit der Betreuung des Babys ab und versuchen, gegenläufige Arbeitszeiten zu kriegen. Wenn das nicht klappt, nimmt Miriam den Kleinen mit ins Tagungshaus. Dort findet sich meistens jemand von den jungen Leuten, die oder der sich um das Baby kümmert.«
Ich bin nicht nur neugierig, weil ich Journalist bin. Nein, es liegt vermutlich in meiner Natur.
»Sie heißen Miriam und Ihr Sohn Jeschu. Maria und Jesus – das klingt wie die Weihnachtsgeschichte. Schöne Namen!«
»Danke, ja. Wir sind allerdings keine Christen, sondern Juden! Unser Nachname lässt da keinen Zweifel: Goldstein.«
»Aber Sie arbeiten in einer christlichen Einrichtung.«
An Miriams Stelle antwortet Maren:
»Kein Problem! Jesus war ja auch Jude. Christen und Juden sind folglich Brüder und Schwestern. Den Mitarbeitenden im Tagungshaus war immer wichtig, Toleranz nicht nur zu predigen, sondern auch zu leben.«
»Und was haben Sie vorher in Hamburg gemacht?«
Ich wundere mich, dass meine ehr als Konversation eingestreute Frage Miriam so aus dem Konzept bringt. Sie stottert beinahe.
»Äh, ich habe dort gelebt. Ich meine von Hartz IV. Ich musste ja für Jeschu da sein und konnte nicht arbeiten.«
»Und Jeschus Vater?«
Vielleicht war ich jetzt doch zu forsch, zu privat. Miriam zögert wieder. Maren nickt ihr ermutigend zu. »Jens Jahnke kannst du trauen«, sagt ihr Blick und das freut und ehrt mich.
»Jeschus Vater hat mich sitzen lassen.«
Miriams Antwort ist kurz und eindeutig. Da werde ich nicht mehr weiter bohren. Muss ich auch nicht, denn Maren sorgt für Details.
»Er hat sie sitzen lassen, weil sie Jüdin ist! Stellen Sie sich das einmal vor. Zuerst zeugt er ein Kind, dann lässt er seinen Sohn im Stich und die Mutter dazu!«
Wieder legt sie den Arm um Miriam. Ich vermute, auch diese Geschichte war ein Grund, die Frau mit Kind aufzunehmen und einzustellen. Schuldlos mit Kind in Hartz IV gelandet – das ist wirklich übel.
»Aber der Vater zahlt Unterhalt, oder?«
Miriam lacht. »Wo leben Sie? Jeder Kontakt ist abgebrochen. Seit klar war, dass ich ein Kind von ihm kriege, war Funkstille. Aber Peter kann eigentlich nichts dafür.«
Der Vater heißt also Peter. Wenig jüdisch, dieser Name.
»Sein Vater steckt dahinter. Der ist totaler Antisemit. Als er hörte, dass sein toller deutsch-arischer Sohn eine Jüdin geschwängert hat, hat er seinem erwachsenen Sohn zuerst einen Schlag ins Gesicht verpasst und ihm dann jeden Kontakt mit mir verboten.«
Ich hätte nicht gedacht, heute Abend noch solch gemeine Geschichte zu hören. Dass es das überhaupt noch gibt! Wahrscheinlich übertreibt die junge Frau.
»Aber Sie sind doch sicher zur Polizei gegangen?«
Miriam schweigt. Maren nicht.
»Nein. Miriam hat sich in Hamburg eine Wohnung genommen und niemandem erzählt, wo sie lebt. Ihr Kind hat sie dann in der Klinik Barmbek bekommen. Miriam, hol doch mal die Fotos!«
Die junge Frau geht hinaus und ich höre sie auf der Treppe.
»Jens, wenn irgend möglich, helfen Sie bitte meiner Untermieterin. Keine Ahnung, was da im Hintergrund läuft, aber es ist nichts Gutes. Der Vater des Kindes ist nicht das Problem, der ist wohl eher ein Weichei. Aber dessen Vater macht Schwierigkeiten. Der ist ein richtiger Nazi oder zumindest etwas in die Richtung.«
Ich komme nicht dazu, Maren weitere Fragen zu stellen. Miriam ist zurück. Sie hält eine Mappe mit vier Fotos von dem ganz kleinen Baby Jeschu in der Hand. Es sind wirklich niedliche Bilder.
»Schauen Sie. So sah Jeschu mit zwei Wochen aus. Da war eine richtig nette und tolle Fotografin in Barmbek. Wie eine Babyflüsterin hat sie den kleinen Jeschu geradezu verzaubert. Schauen Sie, wie er lacht!«
Tatsächlich. Der Kleine lacht auf dem Foto, als liebe er das Leben jetzt schon überschwänglich. Hoffentlich hält sein Lachen an.
»Na, das ist ja ein richtiger Wonneproppen!«
Nun lacht Miriam.
»Stimmt. Genauso hieß die Firma der Fotografin. ›Wonneproppen‹. Ist doch niedlich.«
»Aber warum sind Sie aus Hamburg weg?«
Nun verschwand ihr Lachen. Eine Mischung aus Wut und Angst trat an seine Stelle.
»Mein Ex-Freund Peter rief an. Meine Handynummer hatte er noch, wo ich wohnte wusste er nicht.«
»Und was wollte er?«
»Er wollte mich warnen. Sein Vater hat wegen der Geburt seines Enkels recherchiert. Er hat herausbekommen, in welcher Klinik ich war. Nun hatte Peter Angst um mich und um seinen Sohn.«
»Und da sind Sie nicht zur Polizei gegangen?!«
»Die kann und wird mich nicht schützen. Ich habe vielmehr meine Koffer gepackt und bin hier untergetaucht. In meiner Wohnung fühlte ich mich nicht mehr sicher.«
Als Profi muss ich Geschichten beurteilen können. Diese ist sowohl wahr, als vermutlich auch von Interesse für Polizei und Öffentlichkeit. Ein politisch ultra-rechter Großvater sucht sein jüdisches Enkelkind. Wozu wohl? Die Tochter flieht und versteckt sich in einem kleinen Dorf. Warum wohl? Es riecht nach Bedrohung für Leib und Leben.
Miriam und Jeschu.
Plötzlich kribbelt es. Jenes Kribbeln, wenn mich eine Story findet, durchzieht meinen Körper. Ja, genauso passiert es gelegentlich. Nicht ich finde die Story, sondern umgekehrt. Die Geschichte findet mich. So gesehen hat mein Beruf auch etwas mit Berufung zu tun. Ich will nicht nur, ich muss recherchieren und aufdecken, was geschehen ist.
Trotzdem merke ich jetzt, dass Miriam nicht noch mehr erzählen will. Auch Maren Bender scheint es zu spüren. Sie wechselt das Thema.
»Jens, werden Sie nun öfter nach Himmelstal kommen, ich meine wegen der Weihnachts-Story?«
»Vermutlich schon. Ich will noch Interviews machen, einen Gesprächsabend mit der Hausgemeinde erleben, vielleicht auch diese legendäre Samstag-Andacht mitmachen und mal sehen, was sich so ergibt.«
Maren freut sich. Das Gespräch ebbt jedoch ab. Vermutlich sind die Frauen auch von einem langen Arbeitstag müde. Dann der Wein ...
Als wir uns verabschieden meint Miriam:
»Bitte behalten sie das von mir und Jeschu für sich. Niemand darf wissen, wer wir sind und wo wir sind.«
Ich verspreche es ihr.
»Aber bitte sagen Sie mir noch den Namen des Großvaters. Vielleicht sagt er mir etwas.«
Miriam zögert. Wieder ist es Maren, die mir ihr Vertrauen schenkt.
»Er heißt Heinrich Schlüter. Ich bin sicher, dass er in der Gegend bekannt ist. Ich sage nur: Rechts außen.«
*
Ich habe den Namen noch nie gehört. Die Geschichte von Miriam und Jeschu bewegt mich. Auf dem Heimweg muss ich mich wegen schlechter Sicht und feuchter Straße zwar extrem konzentrieren, aber auch immer wieder an Maria und Jesus denken. Die Personen unterscheiden sich, die Namen und ein Teil der Geschichte nicht.
Ich trete voll in die Bremse und schleudere quer über die Straße. Ein Aufprall bleibt aus. War das da eben ein Wolf?
Ich muss vorsichtig sein.