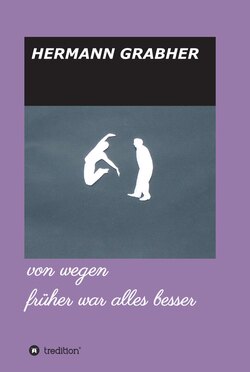Читать книгу von wegen früher war alles besser - Hermann Grabher - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2 Wurzeln
Kein Mensch hat einen Einfluss auf seine Wurzeln. Niemand kann seine Familie selbst aussuchen, auch wenn er der König von Brunei oder der Maharadscha von Jaipur ist, kann er das nicht. Erst wenn er/sie einen Partner/Partnerin (möglichst fürs Leben) findet und Kinder zeugt, nimmt der Mensch individuell Einfluss auf den weiteren Verlauf des Stammbaums und somit in die Zukunft. Eltern können ihre Gene vererben, sie können auch durch eine entsprechende Erziehung Einfluss nehmen, ob Kinder mehr oder weniger gut geraten. Aber letztlich ist jeder Erdenbürger ein Unikat, von dem es kein zweites davon gibt. Das Aussehen ist nur ein Merkmal von vielen. Charakter, Gemüt, Intelligenz, physische Konstitution und Stabilität der Gesundheit sind andere. Irgendwann, früher oder später, entfernt sich jeder Mensch dem Einflussbereich der elterlichen Fürsorge, dann ist er sich selbst überlassen, muss für sich sorgen, muss sich den Prüfungen des Lebens selbstverantwortlich stellen.
Meine Familie hat einen recht gut dokumentierten Stammbaum, der mir an sich aber ziemlich unwichtig ist. Denn zum rückwärts ausgerichteten eigenen Stammbaum habe ich nichts beigetragen. Ich bin ich geworden, ohne dass man mich fragte, genauso wie es bei jedem Menschen ist. Meine persönliche Möglichkeit der Beeinflussung liegt nur in der vorwärts ausgerichteten Linie, nämlich durch die Existenz eigener Kinder. Dennoch ist es manchmal interessant, nicht selten auch kurios, wie sich unsere Ahnen in der Vergangenheit verhielten.
Ich war eigentlich der Meinung, dass in unserer bodenständigen, eher traditionell geprägten Gegend die früheren Gesellschaftsstrukturen wohl ziemlich homogen sein mussten. Ich nahm an, dass sich Einheimische geographisch eher wenig veränderten und es auch nicht viele Zuzüger gab. Ein wenig Ahnenforschung jedoch genügte, um zu einem etwas anderes Bild zu gelangen, nämlich dass durchaus fremdes Blut in meinen Adern pulsiert, und zwar von Vaters Seite, wie auch von Mutters Seite. Unter diesem Aspekt ist es wohl angebracht anzunehmen, dass schon unsere Vorfahren reisten, immigrierten, ihre angestammte Heimat aus welchen Gründen und Umständen auch immer verliessen, um sich irgendwo an einem anderen Ort neu anzusiedeln. In schwierigen Zeiten gab es Massenexodusse. Bekannt in diesem Zusammenhang ist insbesondere die Immigrationswelle der Italiener in die Schweiz in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, sowie die Ausreiseaktivitäten von Europäern nach Amerika vor und nach der Jahrhundertwende um 1900, aber auch schon früher. Meistens waren Katastrophen oder Zwangszustände in der Heimat wie Raumnot, Mangel an Nahrung, gesellschaftliche Verfolgung und negative Ereignisse privater Natur die Triebfeder von Immigration. So sei denn die Frage erlaubt: Ist es nicht nachvollziehbar, wenn heute viele Afrikaner ihr Glück in Europa versuchen? Oder Südamerikaner an der Grenze zu den USA anklopfen? Ob und wie sich diese Menschen bei uns integrieren lassen, das ist ein anderes Thema. Ein Mann, der hier in der Schweiz Asylanten betreut, sagte mir kürzlich, dass das Verhalten vieler erwachsener Flüchtlinge absolut unselbständig sei, nicht anders als wären sie Kinder. Werden sich diese Leute je in unserer Gesellschaft zurechtfinden, sich integrieren lassen? Es ist unsere Pflicht ihnen in freundlicher Weise unsere Kultur und unsere Gepflogenheiten nahe zu bringen, dass sie möglichst schnell lernen, wie hier der Hase läuft.
Die Blutaufmischung auf Vaters Seite kam wie folgt zustande: In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts drohte die Sippe mit dem Dorf-Familiennamen «Knechts» auszusterben. Die letzte Familie des Stamms hatte keine männlichen Nachkommen, sondern nur zwei Töchter und die kamen auch schon in fortgeschrittene Jahre. Insbesondere war es schon damals für «alte Jungfern» nicht einfach einen Ehemann zu ergattern. Diese Frauen liessen sich aber ihre Lebenslust nicht verbieten und hauten anscheinend tüchtig auf den Putz. Bei einem Fest in Bregenz lernten sie Soldaten aus der Slowakei kennen, die eigentlich gar keine Krieger waren, sondern Musikanten. Sie waren Angehörige eines Musik-Bataillons in der K. & K. Kaserne am Bodensee stationiert. Aus dem Techtelmechtel gingen beide Mädchen schwanger hervor. Als die beiden Frauen ihre Schwangerschaft feststellten, waren die Herren leider längst aus der Kaserne ausgezogen. So war es nicht einmal möglich die Väter der Kinder in den Bäuchen der Schwangeren zu eruieren. Denn sie hatten es unterlassen Namen und Adressen auszutauschen. Offensichtlich war die Sache damals als kurzes, lustvolles Intermezzo eines Sommerabends betrachtet worden. Es scheint, dass sie die Folgen ihres Tuns ganz offensichtlich krass unterschätzt hatten. Wie auch immer, die zwei Frauen gebaren je einen Sohn - logischerweise mit dem Geschlechtsnamen Grabher, dem Ledig-Namen der Damen. Das lockere Verhalten der Frauen zeitigte immerhin einen positiven Aspekt, nämlich dass damit das Überleben der Sippe der Knechts gerettet war. Zumindest etwas scheinen die anonymen lebenslustigen slowakischen Musikanten mit ihren Genen weiter gegeben zu haben: Ihre musikalische Begabung. Manche der Nachkommen zeigten und zeigen noch immer ein musikalisches Talent, das auffallend ist.
Die Blutaufmischung auf Mutters Seite war wie folgt: Die Mutter meiner Mutter mit Namen Nora, also meine Grossmutter, hatte einen Vater, der aus Ungarn (damals K. & K. Österreich-Ungarn) stammte. Als Schuhmacher auf Wanderschaft machte dieser Mann zufällig Halt in Lustenau, dem Dorf meiner Urgrossmutter Sidonia (1865 – 1930). Der tüchtige Schuhmacher lachte meine Urgrossmutter Sidonia nicht nur an, sondern er heiratete sie. Das Paar war fruchtbar, es hatte 21 Kinder, von denen 15 das Erwachsenenalter erreichten. Daraus entsprossen 44 Enkel und 101 Urenkel (einer davon bin ich). Somit starben 6 ihrer Nachkommen im Säuglings- oder Kindesalter. Der Tod eines Kindes wurde zu jener Zeit nicht unbedingt als grosse Katastrophe betrachtet, sondern als natürliche Auslese: Der Herrgott gab und der Herrgott nahm, es war sein Wille. Kinder im Himmel betrachtete man als wichtige Fürsprecher vor Gott aller jener, die nach ihnen heimgeholt würden. Die Menschen jener Zeit gewannen somit dem Kindstod auch eine positive Seite ab. Es wurde erzählt, dass der Vater Franz am Morgen der Beerdigung eines seiner Kinder traurig war und heftig lamentierte. Am Nachmittag in der Schusterwerkstatt hatte sein Gemüt aber schon wieder eine positive Stimmung gewonnen und er pfiff ein Liedchen vor sich hin, wie das bei ihm anscheinend üblich war. Das Erwerbsleben der Familie war polyaktiv. Einerseits betrieb die Familie zwei Stickmaschinen. Andererseits führte der Vater seine Schuhreparaturwerkstatt vorwiegend abends und nachts, denn tagsüber arbeitete er als Arbeiter in einer Zichorie-Fabrik in Au auf der anderen Seite des Rheins.
Meine Grossmutter Nora heiratete Julius Bösch im Jahre 1911. Aus dieser Verbindung entsprossen 8 Kinder, Leni, meine Mutter, war das zweite Kind der Familie. Grossvater und Grossmutter mütterlicherseits lernten sich beim Musizieren kennen. Nora hatte einen blinden Onkel, der Musiklehrer war. Ihn betreute sie als Führerin. Bei diesem Onkel Pepi lernte sie das Spielen auf der Zither. Julius lernte gleichzeitig auf der Violine zu spielen. Julius ernährte seine Familie vorerst durch den Betrieb seiner Stickmaschine. Daneben wurden die meisten Lebensmittel in Eigenregie gepflanzt, insbesondere Kartoffeln, Türken (Mais), Getreide, sowie jegliche Art von Gemüsen und Salaten, die unser Klima hergibt. Obst und Nüsse gediehen auf den Bäumen der Hofstatt und Beeren wuchsen in den Sträuchern rund um das Haus. Ausserdem ermöglichte eine kleine Schweinezucht, dass ab und zu auch Fleisch auf den Tisch kam. Vor allem im Hauskamin geräucherter Speck liess sich lange haltbar aufbewahren. Nachdem die Stickmaschine durch ein Erdbeben beschädigt worden war und die Stickerei nach dem ersten Weltkrieg ohnehin in der Krise steckte, wurde Grossvaters Stickmaschine - wie hunderte andere in der Gegend auch – abgebrochen und zu Alteisen. Julius wurde Strassenmeister der Gemeinde bis zum Jahr 1938, dem Jahr, als die «Grossdeutschen» an die Macht gelangten und die «Schwarzen» (Christlichen) aus allen Ämtern verjagt wurden. Diese Beschreibung ist sehr typisch für eine durchschnittliche Familie, die zu Beginn des 20. Jahrhundert im Rheintal lebte, diesseits, wie jenseits des Rheins – die politische Komponente mal ausgeklammert. Deshalb ist sie erwähnenswert. Hunderte, wenn nicht gar tausende Familiengeschichten verliefen ähnlich. Ganz anders präsentierte sich die Entwicklung auf der politischen Ebene linksseitig und rechtsseitig des Rheins. Die Annektierung Österreichs durch Deutschlands Nationalsozialisten war für die Vorarlberger einschneidend und für viele überaus schmerzvoll. Die Menschen auf der Schweizer Seite waren glücklicher, denn ihr Leben fand in einem politisch stabileren Land statt.
Die Familie der Eltern meines Vaters war hingegen weniger typisch strukturiert. Mein Grossvater Franz-Sepp verlor im ersten Weltkrieg als 30-jähriger Soldat das Leben. Die Witwe (meine Grossmutter Kathrin) mit 2 Knaben (der Ältere war mein Vater) heiratete wieder und gebar noch sechs weitere Kinder vom zweiten Ehemann. In dieser Familie studierten drei der vier Söhne, was für eine Arbeiterfamilie jener Zeit eher ungewöhnlich war. Einer von ihnen wurde katholischer Priester, der andere Lehrer. Mein Vater besuchte das Technikum. Der Umstand, dass der Staat den zwei Waisen eine kleine Rente auszahlte, half dabei entscheidend.
Nach der Ausbildung fand mein Vater keine Arbeitsstelle, es ging ihm nicht anders als den meisten anderen Schulabsolventen des Technikums. Genau zwei Mitschüler in Vaters Klasse fanden einen Job und dies auch nur durch die Protektion ihrer einflussreichen Eltern. Infolge der wirtschaftlichen Depression vor dem zweiten Weltkrieg herrschte eine katastrophale Arbeitslosigkeit. Um die jungen Leute nicht der Resignation anheimfallen zu lassen, wurden verschiedene Hilfsprogramme und Aktionen für Jugendliche betrieben. Zum einen wurden defekte Apparate und Geräte wie Radios, Fotoapparate, Fahrräder, Motorräder und sogar Autos gratis repariert. Wer konnte, der zahlte einen bescheidenen Obolus, jeder entsprechend seiner individuellen Möglichkeiten. Beliebt war unter anderem der Rede-Club, bei dem unser Vater eine treibende Kraft war: Jedes Mitglied war gehalten sich periodisch mit einem spezifischen Thema intensiv auseinander zu setzen, um dann darüber vor all den Kollegen und der Öffentlichkeit im Allgemeinen einen Vortrag zu halten. Dies war eine Art Volkshochschule. Das Ziel war vor allem auch das Allgemeinwissen der einfachen Menschen im Dorf zu heben. In Anbetracht, dass nur wenige ein Radio besassen und die Television noch gar nicht existierte, das Internet noch nicht mal in der Fantasie bestand, war dies eine sehr sinnvolle Bildungsinstitution.
Als der Vater hörte, dass im Fürstentum Liechtenstein ein Mechaniker gesucht werde, schwang er sich aufs Fahrrad und stellte sich bei Josef Kaiser in Schaanwald (heute Kaiser Fahrzeugbau) vor. Die Realität war folgende: Ja, der Kleinbetrieb, der sich auf den Umbau von ausgedienten Autos in Traktoren spezialisiert hatte, sogenannte Auto-Traktoren, suchte tatsächlich eine Hilfskraft. Aber Josef Kaiser bekannte ohne Umschweif, keinen Lohn zahlen zu können, hingegen für Kost und Logis aufzukommen. Sozusagen beiläufig sagte Frau Kaiser, die Frau des Chefs, zum jungen Mann (unserem Vater), dass er wohl hungrig sei und dass sie ihm Spiegeleier braten würde, er solle ruhig sagen wie viele er möge. Am Schluss hatte er 7 Stück verdrückt. Unter diesen Umständen fiel es unserem Vater nicht besonders schwer zu entscheiden bei Familie Kaiser zu bleiben, Arbeit ohne Lohn hin oder her.
Die Tätigkeit meines Vaters war eine Mischung aus Konstrukteur, Mechaniker, Hausknecht und Mädchen für alles. Da die Familie Kaiser auch noch eine kleine Landwirtschaft betrieb – sehr üblich zur damaligen Zeit, musste der Vater am Morgen schon um halb sechs aus den Federn, um die Kühe zu melken. Wenn der Stall und die Tiere versorgt waren, wurde gemeinsam ein reiches Frühstück eingenommen: Üblicherweise Kaffee, Türken-Ribel, Rösti und Spiegeleier. Danach gingen Josef Kaiser und unser Vater – sein einziger Mitarbeiter – ans Tüfteln und Werkeln in der Werkstätte. Auch am Abend fand Vaters Abschlusstätigkeit im Stall statt. Nach einem Jahr eröffnete Josef Kaiser dem Vater, dass er sehr zufrieden sei mit seiner Arbeit und er gab ihm eine grüne Banknote, die das Abbild eines Holzfällers aufgedruckt hatte - fünfzig Franken. Der Vater war sehr stolz auf dieses Geld und er fuhr auf direktem Weg heim zur Mutter, übergab ihr das ganze Geld in der Annahme, dass sie es wohl nötiger hätte als er.
Unser Vater wurde bei der Familie Kaiser wie ein eigener Sohn gehalten, entsprechend harmonisch war das Verhältnis. Im nachfolgenden Jahr übergab Josef Kaiser unserem Vater eine blaue Banknote mit einem Mäher drauf - hundert Franken. Und auch dieses Geld überbrachte der Vater seiner Mutter.
Weil der Chef meines Vaters irgendwann der Ansicht war, es wäre an der Zeit, dass der Junge Geld verdienen sollte und Kaiser seinerseits nicht in der Lage war einen vernünftigen Verdienst anzubieten, half er zumindest mit auf der Suche nach einer Existenz und dies mit Erfolg. 1936 wagte mein Vater – 23-jährig - seine Geschäftsidee in die Realität umzusetzen, er gründete seine eigene Firma in der Schweiz. Es ging um die Konstruktion und Herstellung einer handbetriebenen Maschine zum Verschliessen von Konservendosen für private Haushalte. Nach dem Verschliessen durch Doppelfalz mussten die Dosen im kochenden Wasserbad sterilisiert, um den Inhalt haltbar zu machen. Mein Vater rühmte sich sein Leben lang damit, die Firma mit fünf Franken Startkapital gegründet zu haben. In der Tat waren es bestimmt einige Franken mehr. Doch es ist allemal erstaunlich mit wie wenig Geld man damals ein solches Wagnis eingehen konnte. Drei Jahre später – 1939, im Jahr des Ausbruchs des zweiten Weltkriegs - heirateten meine Eltern. In diesem Jahr – somit drei Jahre nach der Gründung – hatte Vaters Firma schon 50 Angestellte. Sein Produkt war gefragt in einer an sich desaströsen Weltlage. Wohl eher zufällig war er Produzent und Anbieter des richtigen Produkts im passenden wirtschaftlichen Umfeld. Es war Kriegszeit und wohin die Blicke schweiften, es gab vorwiegend Sorgen. Unbeeindruckt von allem gab unser Vater – der ewige Optimist - den Bau seines Familienhauses samt kleiner Werkstätte in Auftrag, das 1941 fertiggestellt war. Es war ein Lichtblick, oder eigentlich eher ein Wunder am dunkeln Firmament.
Doch leider sollte die Glückssträhne meiner Familie nicht lange dauern. Der Vater, der nun schon mehrere Jahre in der Schweiz wohnhaft war, aber sich noch nicht eingebürgert hatte (also noch immer Österreicher war), wurde von der Deutschen Besatzungsmacht mittels eines Stellungsbefehls in die Deutsche Wehrmacht eingezogen. Alle Widerstandsversuche waren ohne Chance - hoffnungslos erfolglos. Damit änderte sich die Situation schlagartig. Die Mutter – eine in Geschäftsdingen unerfahrene junge Frau – war gezwungen die Firma ohne Ehemann an ihrer Seite weiter zu führen. Doch wiederum geschah ein kleines Wunder: Als der Vater 1946 aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, existierte die Firma noch immer, wenn auch in stark redimensionierter Form. Meiner Mutter war es gelungen mit viel Mut, Gottvertrauen und weiblicher Intuition das Geschäft um alle Klippen zu schiffen. Der Neuanfang konnte beginnen.
*