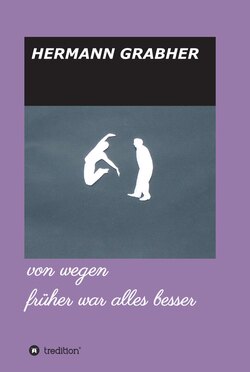Читать книгу von wegen früher war alles besser - Hermann Grabher - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4 Schuljahre sind keine Herrenjahre
Die Strasse zu unserem Haus führt an einem Kindergarten und an einer Primarschule vorbei. Dort gibt es täglich mehrere Male eine Art Massenauflauf: Erwachsene Menschen - meist Eltern und Grosseltern, bringen oder holen ihre Sprösslinge ab, teils zu Fuss, mit dem Fahrrad, mehrheitlich aber mit dem Auto. Ein solcher Service dürfte zwar vom Kind überaus geschätzt werden, ist aber wohl per se nicht unbedingt zu seinem Vorteil. Denn auf dem Weg zur Schule oder von der Schule heim nachhause kann einiges erlebt und insbesondere gelernt werden, sofern dieser zu Fuss zurückgelegt wird. Und sei es nur Selbstverantwortung und Pünktlichkeit. Der Schulweg birgt zwar Gefahren, lässt das Kind aber andererseits an Erlebnissen teilhaben, die es im Auto der Mutter oder von Opa oder Oma nie geben kann. Was findet sich nicht alles am Wegesrand: Echsen, Käfer, Schnecken, Beeren, Nüsse, Katzen, von denen sich manche streicheln lassen. Ausserdem entstehen aus jenen Kameradschaften mit Mitschülern, Mitschülerinnen auf dem gemeinsamen Schulweg nicht selten Freundschaften fürs Leben.
Vieles hat sich geändert in der Epoche der letzten zwei Generationen, und zwar sowohl für die Schüler wie auch für die Lehrer. Wir redeten unsere Lehrpersonen noch mit Herr Lehrer oder Fräulein Lehrerin an. Ich hatte in meiner ganzen Primar- und Sekundarschulzeit nur eine einzige Lehrerin, nämlich in der ersten Klasse. Sonst waren die Lehrpersonen stets Männer. Heute ist das insbesondere in der Primarschule genau umgekehrt: Weitaus die meisten Lehrkräfte sind Frauen und das ist gut so. Denn Frauen haben mit Sicherheit mehr Feingefühl für kleinere Kinder. Dass den Buben dabei die männliche Komponente fehlen würde oder gar die eigene dadurch abhandenkomme, ist wohl Unsinn. Zu unserer Schulzeit trugen die Herren Lehrer während den Schulstunden mehrheitlich Krawatte - aus heutiger Sicht ein lächerlicher Selbstzwang. Während die Lehrpersonen früher sehr weit gefasste Freiheiten hatten den Lehrstoff zu vermitteln und die Kinder entweder Glück oder Pech hatten, unter die Fuchtel eines richtig guten oder dann eben eines richtig mässig guten Lehrers (selten Lehrerin) zu gelangen, haben die Lehrpersonen heute sehr einheitliche und klar gefasste Richtlinien und Vorgaben, die sie im Laufe eines Schuljahres zu erfüllen haben. Die Lehrpläne geben eindeutig vor, was in welcher Zeit vom Schüler zu beherrschen ist und was es braucht, dass der Schüler, die Schülerin in die nächste Klasse oder in eine höhere Schule steigen kann. Die Lehrmittel sind leistungsorientiert ausgelegt. Somit ist Stress nicht nur ausnahmsweise vorprogrammiert - für die Schüler wie auch für die Lehrerschaft, aber auch für die Eltern. Für die Kinder ist es in jedem Fall ein Vorbote darauf, was sie im Leben als Erwachsene in der heutigen Leistungsgesellschaft erwarten wird. Und nicht zu unterschätzen ist jenes nebenbei, was ein Kind heute ausser der Schule auch noch in seinen Tagesablauf miteinzupacken hat. Oft ist es eher zu viel denn zu wenig. Von den Nachhilfestunden in Mathe und Latein bis zum Ballettunterricht, vom Fussball-training bis zu den Trainingsstunden im Turnverein, dem Schwimmclub, vielleicht auch dem gemeinsamen Üben im Musikverein oder der Musikschule. Und die Pfadfinder, die Jungwacht und den Blauring gibt es ausserdem noch.
Während bei der Generation unserer Kinder (die heute im Alter von über vierzig bis über fünfzig sind) die schulische Neuzeit schon eingeläutet war und alles schon sehr methodisch vonstattenging, war zu unserer Zeit der Unterricht insbesondere in der Primarschule eine wenig strukturierte, eine eher geruhsame Angelegenheit, dies ohnehin für die besseren Schüler. Während man heute sorgsam darauf achtet, möglichst übersichtliche Klassen zu bilden, waren zu unserer Zeit schon mal dreissig bis vierzig Kinder gleichzeitig im Schulzimmer. Dass die Lehrperson bei einer solchen Anzahl Schüler nicht stets jedes Kind im Auge behalten konnte, ist logisch. Entsprechend konnte man leicht «abtauchen» indem der Finger bei den Fragen des Lehrers nicht in die Höhe schnellte. Dann lief die Schulstunde weitgehend ereignislos an einem vorbei. Allerdings kam auch in unserer Zeit letztlich die Leistungsfähigkeit eines Schülers dennoch an den Tag, wenn es darum ging eine Klausur im Rechnen (wie eine Mathematik-Prüfung damals hiess) abzuliefern, ein Diktat oder einen Aufsatz in der Deutschstunde zu schreiben. So waren am Ende eines Schuljahres die Zeugnisnoten dennoch recht aussagekräftig hinsichtlich des Leistungsvermögens eines Schülers. Ich war stolz darauf in den ersten fünf Schuljahren im Zeugnis in jedem Fach eine 1 oder zumindest ein 1-2 stehen zu haben (Notenskala 1 – 5, wobei 1 = sehr gut bedeutete, 2 = gut, 3 = mittelmässig, 4 = genügend, 5 = ungenügend). Der Kommentar der Mutter war stereotyp gleich: «Auch ich hatte stets gute Noten, ausser im Rechnen! Da hatte ich oft einen Dreier!» Dies bedeutete nichts anderes, als dass man von uns Kindern gute Noten als eine Art Selbstverständlichkeit erwartete. Auch mein Vater konnte sich niemals durchringen, mir je ein Kompliment zu machen, weil er ein solches Zeugnis, wie ich es präsentierte, normal fand. Dabei hatte ich innerhalb unseres Familienverbandes harte Konkurrenz, denn die beiden Geschwister Werner und Magdalen, die nach mir kamen, übertrafen mich mit noch besseren Zeugnisnoten. In den Zeugnissen von Magdalen erschien in der ganzen Primarschulzeit in jedem Fach stets nur eine Note, nämlich eine 6 in allen Fächern (ausser der Handarbeit, welche sie wenig begeisterte). In diesem Fall war nun eine 6 die beste Note = sehr gut. Und auch in den nachfolgenden Schulen, dem Gymnasium und der Uni setzten sich ihre Erfolge auf oberstem Level fort. Die logische Folge war, dass Magdalen schon in jungem Alter einen Doktorhut hatte. Die Zeugnisse von Werner sahen ähnlich aus, wie jene von Magdalen. Aber der Bruder neigte dazu einerseits ziemlich bequem zu sein (was er sich leisten konnte) und andererseits ein vorlautes Mundwerk zu haben. Unter diesen Umständen musste erwartet werden, dass die Betragen-Note nicht in jedem Jahr ein «sehr gut» war, sondern es gab Zeugnisse, wo nur ein «gut» eingetragen war. Und persönliche Notizen der Lehrer liessen sich in Werners Zeugnissen ausserdem finden, zum Beispiel «etwas vorlaut». Eine Betragen-Note, die kein «sehr gut» beinhaltete und individuelle Bemerkungen des Lehrers im Zeugnis waren generell ziemlich unpopulär, denn sie bedeuteten so etwas wie ein Klecks im Reinheft eines Schülers. Allerdings veranstalteten unsere Eltern deswegen kein Drama. Ein solcher Satz rang unseren Eltern höchstens ein wissendes Lächeln ab. Denn sie kannten ihre Kinder ja ziemlich gut. Immerhin konnte ich mir auf meine persönliche Fahne schreiben, teilweise der Hauslehrer der jüngeren Geschwister gewesen zu sein. Auf jeden Fall konnten sowohl Werner als auch Magdalen perfekt lesen und weitgehend fehlerfrei schreiben, als sie in die erste Klasse Primarschule eintraten. Dabei muss ich offen zugeben, dass insbesondere bei Magdalen mein Aufwand als Lehrmeister eher bescheiden war. Eigentlich brachte sie sich das Lesen und Schreiben eher selber bei. Die kleine Magdalen hatte die typisch extremgute Auffassungsgabe einer Hochbegabten. Wenn ich meiner Schwester einmal einen Buchstaben erklärt hatte, war dieser fortan wie eingebrannt in ihrem Hirn existierend. Das Kind war fasziniert davon, wie durch das Aneinanderreihen von Buchstaben schlussendlich Wörter, Sätze, Begriffe entstanden. Es war für sie eine spannende Erkenntnis, in der Folge Zeitung lesen zu können! Werner lernte parallel mit mir das ABC und das 1x1 und er hätte problemlos direkt mit mir in die zweite, wie anschliessend auch in die dritte Klasse steigen können. Magdalen war als noch nicht Sechsjährige in der Lage das Buch «Pinocchio» mit mehr als 100 Seiten zu lesen und auch zu verstehen. Als kleines Mädchen mit viel Fantasie empfand sie allerdings den in ihren Augen schrecklichen Schluss der Geschichte als nicht akzeptabel. So strich sie den letzten Abschnitt mit einem violetten Farbstift kurzentschlossen durch und schrieb eigenhändig ein Happyend ins Buch. Magdalen war aus den Märchenerzählungen der Mutter gewohnt, dass Geschichten stets gut endeten. Aus diesem Grund konnte sie eine Geschichte mit einem unglücklichen Ende nicht ertragen.
Die Schule funktioniert heute völlig anders als zu meiner Zeit. Nicht nur das Vermitteln des Stoffes durch die Lehrer, nämlich was ein Schüler zu lernen hat und schlussendlich am Ende des Schuljahres beherrschen sollte, veränderte sich seit der Nachkriegszeit dramatisch, sondern eben auch die Struktur des Schulbetriebs. Damit in der heutigen Zeit die ganze Organisation einer Schule einwandfrei funktioniert, gibt es – ausser den Lehrpersonen - einen sehr ernsthaft arbeitenden Schulrat und in grösseren Schulen ein professionelles Sekretariat mit einem oft vollamtlichen Präsidenten. Der finanzielle Aufwand ist in grösseren Schulgemeinden in der heutigen Zeit ein Multimillionen-Ding, was nicht wenige der Eltern wohl gar nicht richtig wahrnehmen. In vielen Gemeinderechnungen schlagen die Kosten für die Schulbildung der Kinder mit einem Drittel des jährlichen Steueraufkommens der Kommune zu Buche. Dies ergibt dann einen Aufwand per Schüler um die 20.000 Franken. Doch es ist gut investiertes Geld. Je besser der Schulsack eines Kindes bestückt ist, umso einfacher gelingt später der Start ins Berufsleben und damit dessen Existenzsicherung.
In unserer Schulzeit kam der Inspektor einmal im Jahr in die Schule und er war ein Mann, vor dem man sich nicht fürchten musste. Denn er schien einerseits ziemlich unbedarft und andererseits sehr väterlich zu sein. Und am Ende eines Schuljahres war Elterntag, das heisst die Eltern durften eine Schulstunde zusammen mit den Kindern erleben, eine sehr eingeübte Angelegenheit, bei der alle strahlten, die Schüler, die Eltern, die Lehrperson. Es war vorgesorgt und ausgeschlossen, dass etwas schief gehen konnte!
Ich persönlich hatte in der Primarschule in gewissen Klassen ausgezeichnete Lehrer, in anderen Klassen sehr mittelmässige (um es mal gnädig auszudrücken). Als angepasstes Kind mit einer Lernfähigkeit über dem Durchschnitt und allzeit bestem Willen es gut zu machen und niemand zu ärgern, hatte ich kaum je Schwierigkeiten im Schulalltag. Kinder mit mässiger Begabung und insbesondere, wenn sie aus ärmlichen Verhältnissen kamen, hatten es allerdings oft schon schwerer. Gewisse Lehrer und auch Mitschüler behandelten sie nicht selten schlecht, abwertend. Dabei hielten sich manche Lehrer nicht zurück mit regelmässiger körperlicher Züchtigung. Sie verteilten Ohrfeigen, Kopfnüsse und Tatzen (Schlagen mit dem Lineal auf die ausgestreckte innere Handfläche) nach Belieben. Sadistisch veranlagte Lehrer – und solche gab es nicht mal selten - schlugen dabei mit der Kante des Lineals. Viele Buben hatten kahl geschorene Köpfe, sodass sie mir wie kleine Gefängnisinsassen vorkamen. Als Grund für die Glatzenschnitte wurde genannt, dass sich Läuse damit weniger gut einnisten könnten. Manche der Kinder erschienen schon am Morgen mit schmutzigen Händen und Füssen, mit verschmiertem Gesicht, dreckigem Hals und ebensolchen Ohren. Unter den Fingernägeln und Zehennägeln ruhte stets eine dunkle Packung Dreck. Dies alles fand ich furchtbar. Dabei sah ich schon damals, dass eigentlich die Eltern ihre Pflichten nicht wahrnahmen. Nicht wenige Kinder trugen armselige Kleider, die wohl schon ihre älteren Geschwister getragen hatten. Sie hatten Rotznasen, weil sie oft erkältet waren, dies als Folge, weil sie bis zum Einsetzen des Frostes barfuss liefen. Den Eltern ging es darum die Kosten für das Schuhwerk zu sparen. Barfuss laufende Kinder zogen sich immer wieder arg entzündete Wunden an den Sohlen der Füsse oder den Zehen zu, weil sie auf spitze Steine, Nägel, Glassplitter oder Stoppeln traten. Manche Kinder rochen schlecht, weil sie einerseits wohl nicht oft mit dem Waschlappen in Berührung kamen, andererseits ihre Kleider selten oder kaum gewechselt wurden. Wahrscheinlich waren manche von ihnen Bettnässer und Hosenbrünzler. Sie litten wohl unter einer permanenten Blasenentzündung. Im Grunde bedauerte diese Kinder. Doch Mitleid zu haben war das einzige, was man damals vor zirka siebzig Jahren haben konnte. Als Kind und Mitschüler hatte man keinerlei Möglichkeiten etwas zu verändern. Ich und meine Geschwister waren andererseits vielleicht eher überumsorgt von Seiten des Elternhauses. Auf jeden Fall besitze ich noch ein Klassenfoto, in dem ich als Einziger der Klasse Schuhe und Kniestrümpfe trage. Dafür bekam ich das Privileg die Schiefertafel in den Händen zu halten «1. Klasse 1947». Meine Frau Judith - in der gleichen Klasse wie ich, mein damaliger Schulschatz - lacht mich deswegen heute noch aus: Ein Mamakind eben!
Auch wenn ich dank etwas besser situierten Eltern gewisse Privilegien genoss, ein Herrenleben hatte ich im Primarschulalter dennoch nicht. Aber nicht die Schule forderte mich, sondern mein «Teilzeitberuf». Denn im Haus, oder genauer gesagt im Unternehmen meiner Eltern, hatte ich Pflichten zu erfüllen. Als Primarschüler hatte ich die Auflage, jeweils nach Schulschluss sofort nachhause zu kommen. Dort wartete der Fahrrad-Anhänger, der meistens voll war mit Paketen, bereit für den Postversand. Das Geschäft meines Vaters war eine kleine Maschinenbaufirma mit Handel einschlägiger Produkte. In der Werkstätte wurden handbetriebene Maschinen zum Verschliessen von Dosen für die Haushalt-Selbstversorgung produziert. Besitzer solcher Maschinen bestellten regelmässig Dosen und Deckel, damit sie ihre Produkte aus dem Garten (Früchte und Gemüse) oder auch Fleisch einmachen und sterilisieren konnten. Es war meine Aufgabe den Anhänger mit den bereit gestellten Paketen an mein Fahrrad zu koppeln und damit zur Post zu radeln. Die Pakete mussten vor 12 Uhr am Mittag aufgegeben werden, damit sie am nächsten Tag bei den Kunden einlangten. Regulär endete die Schulstunde täglich um Halbzwölf. Also hatte ich wenig Zeit, um mein Pensum durch zu bringen. Ich war der einzige Schüler, der mit dem Fahrrad in die Schule kam. Mein Velo war ein sehr spezielles Exemplar, das explizit für meinen Dienst von meinem Vater und seinen Mechanikern in unserer Werkstatt präpariert worden war. Dabei hatten sie ein normales Herrenrad in ein spezielles Kinderrad umgewandelt. Der Sattel musste tiefer gelegt werden, angepasst an meine Körpergrösse. Entsprechend musste die Längsstange nach unten versetzt werden. Ausserdem wurde das Fahrrad mit einer englischen «Sturmey-Archer»-Übersetzung mit vier Gängen versehen. Wenn ich sehr schwere Last hatte, konnte ich eine kleine Übersetzung einlegen. Nur so war es für mich kleinen Kerl möglich den anstrengenden Job zu erledigen. Bei grossem Paketaufkommen – was im Sommer ein üblicher Zustand darstellte, war der Fahrrad-Anhänger oft zu klein und die Fracht wurde auf einen Handwagen geladen. Bei der Post angelangt, musste ich die Pakete in die Schalterhalle tragen und dort aufgeben. Übrigens: Auf meine «Sturmey-Archer» war ich sehr stolz. Denn eine solche Gangschaltung hatten sonst üblicherweise nur noble Gentlemen-Fahrräder, die aus England importiert wurden und anscheinend sündhaft teuer waren, wie man mir sagte.
Bei meinem täglichen Dienst hatte ich zwei grössere Hürden zu überwinden. Das erste Problem war die Konfrontation mit dummen, immerhin nicht bösartigen Kindern, die genau wussten, dass ich täglich in Eile war. Sie stellten sich mir in den Weg. Sie klammerten sich an mein Fahrrad und ich kam dadurch in Zeitnot. Der hartnäckigste Dummkopf von allen war Lucky, ein linkisches Kind aus gutem Haus. Weil sich dieser Bub schwach und ungelenk durchs Leben zwängte, war er oft ein Opfer seiner Mitschüler. Er bekam von seinen Mitschülern oft aufs Dach und musste leiden. In mir hatte er seine einzig mögliche Herausforderung erkannt, nämlich seinerseits den Frust abzureagieren, vielleicht noch eher seine beschränkte Macht auszuspielen. Zwar war Lucky zwei Jahre älter als ich, aber im Grund war ich stärker und ohnehin in jeder Hinsicht behender. Es wäre für mich ein leichtes gewesen, mich zu wehren, sprich ihn zu vermöbeln. Aber als gewaltloses Kind tat ich dies aus Prinzip nicht und das wusste mein Kontrahent genau. Meine Waffe war meine Wendigkeit: Wenn mich Lucky abpasste – und das tat er permanent, versuchte ich mit Speed und Wucht ihn zu umkurven, sodass er mich nicht hinten am Gepäckträger fassen konnte. Meistens gelang mir dies, doch es war ein stetes lästiges Spiessrutenlaufen. Ich löste schliesslich dieses Problem, indem ich andere Strassen für meinen Weg von der Schule nachhause wählte. Dieser neue Weg war zwar länger, aber mit weniger Stress verbunden. Ausserdem konnte ich die Zeit besser kalkulieren. Mein zweites Problem erwartete mich, wenn ich mit meinen Paketen zur Post fuhr. Unmittelbar neben der Post befand sich das Restaurant «Bahnhof». Vor der Tür zum Restaurant lag täglich ein Appenzellerbless-Mischlingshund. Das Tier wartete anscheinend nur auf mein Erscheinen. Vielleicht betrachtete mich das Biest als eine Art Leibfeind, möglicherweise aber auch nur als lustigen Spielgesellen, auserwählt, mit ihm seine Possen zu treiben. Wie auch immer, ich war täglich eine willkommene Zielscheibe seiner giftigen Attacken. Sobald er mich mit meinem Gefährt erblickte, raste er wie ein Berserker auf mich zu und versuchte mit seiner Schnauze mein Hosenbein zu fassen. Mein Ziel war es, ihm möglichst auszuweichen oder eben das Bein, wo seine Zähne zupacken wollte, hoch zu ziehen. Auch versuchte ich mich mit den Schuhen zu wehren, auszuschlagen. Aber der Hund war sehr aufmerksam, sodass ich eigentlich kaum eine Chance hatte, ihm einen Tritt zu versetzen. Nur einmal, es war Winter, die Strasse schneebedeckt und gefroren, ich trug Holzknospen (grobe Winterschuhe mit einem Holzboden versehen), da gelang es mir dem Hund den Meister zu zeigen. Und das kam so: Infolge der prekären Strassenverhältnisse war ich mit meinem Gefährt sehr langsam unterwegs. Ich hatte keine Chance dem Tier durch eine rasante Fahrt zu entkommen. Also war ich gezwungen meine Strategie zu ändern: Als der Hund auf mich losstürmte, konzentrierte ich mich gar nicht mehr auf das Treten der Pedale, sondern nur auf das Tier. Mit einem gezielten Fusstritt mit dem Holzschuh in die Hundeschnauze beendete ich dieses lästige Katz- und Mausspiel für immer. Den Bless überschlug es. Anschliessend trottete er jaulend und mit eingezogenem Schwanz zurück zur Eingangstür seines Restaurants. Das Biest tat mir nicht leid, im Gegenteil. In der Folge wurde ich von diesem Hund nie wieder angegriffen. Wenn ich auf der Bildfläche erschien, blieb er regungslos auf seiner Decke liegen und beäugte mich misstrauisch aus sicherer Distanz. Ich war mächtig stolz auf mich, kam mir vor wie der Hero in einer Heldensage.
Und weshalb tat ich mir diese Kinderarbeit an? Erstens, weil ich solidarisch mit meiner Familie war und damit bewusst meinen Anteil beitragen wollte. Zweitens wurde ich bezahlt. Ich musste alle Pakete zählen und in eine Liste eintragen. Für jedes Paket bekam ich 2 Rappen – ein sehr geringer Lohn! Dennoch läpperte es sich zusammen mit dem Resultat, dass ich der mit Abstand «reichste Schüler» meiner Klasse war, ja sehr wahrscheinlich gar des ganzen Schulhauses. Ich hatte stets Geld zu meiner Verfügung, worüber ich beim Ausgeben keinem Menschen Rechenschaft abzulegen hatte. Allerdings war ich sparsam, überlegte genau, wofür ich meine Moneten investierte. Es waren stets sinnvolle Anschaffungen, beispielsweise eine Uhr, ein Portabelradio oder eine Fotokamera. Damit konnte ich mir Träume verwirklichen, wie sonst kein anderes Kind meines Alters.
Am Ende meiner regulären Schulzeit mit fünfzehn (nahe sechzehn), meldete ich mich für eine Reise nach Rom an, für welche der Jungmannschafts-Verband Werbung gemacht hatte. Die Reise von einer Woche kostete 250 Franken - Fahrt, Essen, Schlafen inklusive. Ich war der jüngste Reiseteilnehmer, alle anderen jungen Männer waren schon in der Lehre oder hatten diese beendet. Die Ältesten der Gruppe sprach ich in der Höflichkeitsform an, ich siezte sie. Immerhin waren die über doppelt so alt wie ich. Meine Anmeldung zu dieser Reise erfolgte ohne dass ich meine Eltern fragen musste, denn es war mein Geld, mein eigenes Geld, das ich hiermit investierte. Diese Reise war für mich die Initialzündung des Reisevirus, der nie mehr aus meinem Körper und vor allem nie mehr aus meinem Geiste weichen sollte. Zwei Jahre später – 1958 – besuchte ich die Weltausstellung in Brüssel. Dabei leistete ich mir unter anderem einen Rundflug im Helikopter über die belgische Hauptstadt – für meine Verhältnisse sündhaft teuer, damals eine Sensation, vor allem aber für mich ein Riesenspass. Helikopter waren in jener Zeit eine rare Sache, insbesondere zivil genutzte. Als ich zuhause von meinem Helikopter-Flugerlebnis erzählte, fragte mich manch einer in meinem Umfeld ernsthaft, ob ich wirklich so viel Geld besitze, dass ich in der Lage sei, es auf diese Weise sinnlos zum Fenster hinaus zu werfen. Meine Antwort lautete: «Ich hebe lieber in die Luft ab, statt dass ich die Luft verpeste!» Damit meinte ich das Zigarettenrauchen, das bei den Leuten, auch bei den jungen und sehr jungen, damals immer beliebter wurde. Ich verabscheute dieses Laster. Denn weil Rauchen praktisch überall erlaubt war, litten insbesondere alle Nichtraucher unter dem Tabakgestank. Die Raucher hielten sich nirgends zurück, vielleicht mit Ausnahme der Nichtraucher-Wagen in den SBB-Zügen. So kam es, dass die Kleider nach einem Restaurantbesuch, oder wenn ein Raucher im Auto mitfuhr, unweigerlich penetrant nach Tabakrauch stanken und man mit einer entsprechenden Fahne heimkehrte, was ärgerlich war. Und dass Rauchen nicht gesund sei, das wusste auch jeder. Aber diese Tatsache war in den Köpfen der Leute erst schwach verankert und kaum massgebend für einen Entscheid für oder gegen das Rauchen. Das Hauptkriterium war eigentlich nur: Wollte man sein Geld ausgeben für den Kauf von Zigaretten, oder wollte man das nicht!
*