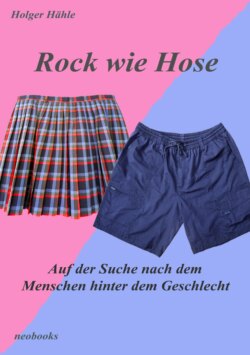Читать книгу Rock wie Hose - Holger Hähle - Страница 6
03 Der Tag X ist da
ОглавлениеEs ist soweit. Heute geht es los. Die Tasche mit den Klamotten habe ich bereits gestern Abend gepackt. Den Rock habe ich vorsichtig gefaltet und locker oben drauf gelegt. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie empfindlich die Falten sind und ob sie leicht verknittern. Gehört habe ich jedenfalls, dass das Bügeln der schmalen, ungefähr fünfzig Falten immer wieder notwendig und jedes Mal umständlich ist, weil die Falten nicht abgenäht sind.
Geschlafen habe ich gut. Als ich realisiere, welcher Tag ist, stellt sich wieder diese merkwürdige Gemengelage ein aus Bedenken und Zuversicht aus Bauch und Kopf. Auch wenn meinem Vorhaben nichts mehr im Wege steht, ein - wenn auch reduziertes - schlechtes Gewissen habe ich trotzdem. Auch weiterhin muss ich mir aktiv versichern, dass ich genau das Richtige vorhabe. Dann mache ich mich auf den Weg.
Wenig später sehe ich an der Bushaltestelle die ersten Schülerinnen von Wenzao. Ich grinse, als ich mich frage, ob die sich wohl vorstellen können, dass ich heute die gleiche Uniform tragen werde? Die Jungs fallen weniger auf. Ihre Hosen haben kein auffälliges Tartanmuster. Auch Schüler anderer Schulen nutzen den Bus. An Hand der Schulröcke sind sie gut zu unterscheiden. Es werden überwiegend Faltenröcke getragen. Etwa siebzig Prozent der Schulröcke haben ein schottisches Karomuster.
Als ich den Campus betrete, ist es noch früh. Die jüngeren Jahrgänge sind mit dem Ordnungsdienst beschäftigt. Sie fegen die Wege oder lesen Unrat auf. Zügig gehe ich zum Gebäude E. Mein Unterricht wird dort in einem der Computerräume stattfinden.
Der Vorteil der Computerräume ist, dass sie eine kostenlose Klimaanlage haben. Man muss nicht wie in den anderen Klassenräumen eine Geldkarte einstecken. Der Nachteil ist, dass die Klimaanlage lange braucht, bis der sehr große Raum spürbar heruntergekühlt ist. Der Nachteil wiegt schwer, weil wir wie heute, einen sehr warmen Frühjahrstag haben. Das Thermostat zeigt für den Raum 31 Grad an. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Normalerweise starte ich einfach das Klima und gehe für einige Minuten nach draußen, wo meist ein leichter Wind oder der Zug im Treppenhaus die tropischen Temperaturen etwas erträglicher machen.
Das geht heute nicht. Ich will mein Tafelbild schon vorzeichnen und muss noch einige Sachen für den Vortrag von einem speziellen Server herunterladen. Das ist deswegen nicht einfach für mich, weil die Benutzeroberfläche auf Chinesisch ist.
Zuerst aber will ich mich umziehen, bevor ich noch stärker zu schwitzen beginne. Ohne Zögern fange ich an. Jetzt noch hadern, das geht nicht. Innerlich schalte ich auf Vollzug um. Das entzieht dem Widerstand der Bauchgefühle gegen die Verkleidungsaktion die letzte Kraft. Beim verschärften Vollzugsmodus wird durch die strenge Fokussierung das Bauchgefühl ausgeblendet. Das ist für mich ein eingeübtes Verfahren, das ich schon als Student anwandte, um mich durchzuringen, trotz Semesterferien mit der Vorbereitung auf Klausuren zu beginnen.
Als Kind habe ich mich so im Schwimmbad ausgetrickst, um vom Sprungturm auch wirklich zu springen, wenn ich unsicher war und mich Angst zu blockieren drohte. Ich hatte mich doch schon entschieden zu springen. Also sollte es passieren. Erst habe ich mein Vorhaben lautstark angekündigt; und dann bin ich losmarschiert ohne anzuhalten, bis ich über den Rand des Sprungbretts trat. Ich glaube, schon damals funktionierte diese Strategie, weil ich mit meiner Ratio, die den Vorgang schon tausendmal durchgespielt hatte, im Reinen war. Damals wie heute kommt das Problem aus dem Bauch, der sich auch nach eingehender Prüfung durch den Verstand weiterhin uneinsichtig zeigt.
Eigentlich schwitze ich bereits, was ich daran merke, dass ich das Poloshirt nicht einfach über den Kopf ziehen kann. Damit ich die Hose besser von den Beinen pellen kann, setzte ich mich hin. Danach habe ich das erste Aha-Erlebnis.
Der Rock lässt sich so bequem anziehen. Eigentlich ganz klar. Röcke fallen als Beinkleid gegenüber Hosen dadurch auf, das sie viel mehr Weite haben als Hosenbeine. Das fühlt sich angenehmer an, als ich erwartet habe.
Die Bluse hatte ich vorher nur mal so übergezogen, ohne sie zuzuknöpfen. Jetzt stelle ich fest, ich kriege die Knöpfe nicht so leicht zu. Den Grund habe ich schnell ausgemacht. Die Knopfleiste und Knopflöcher sind umgekehrt. So herum habe ich noch nie geknöpft. Schon interessant, mit welchen Details, dazu gehört auch der runde Kragen - gegenüber dem spitzen Kragen der Jungenhemden versucht wird, aus einem normalen Oberhemd eine weibliche Bluse zu machen. Nachdem ich die Schleife am Kragenknopf befestigt habe und meine Sandalen gegen schwarze Ballerinas getauscht habe, beginne ich mein Tafelbild vorzuzeichnen. Das Thermostat der Klimaanlage gibt die Raumtemperatur mittlerweile mit nur noch 29 Grad an.
Obwohl ich spüre, wie Schweiß auf der Stirn aus den Poren perlt, fühle ich mich angenehmer als sonst. Die Gründe sind eindeutig. Es liegt an der Lüftung von unten und an der Rockbewegung beim Gehen. Dass die Temperatur über meinen Beinen unterm Rock wirklich niedriger ist als mit Hose, kann ich mir gut vorstellen. Die Luftbewegung ist durch den wogenden Stoff sicher höher. Der Tragekomfort ist gerade beim Gehen absolut überzeugend, denn durch die Dehnbarkeit der Falten ist die Bewegungsfreiheit maximal. Selbst ein Spagat wäre so möglich.
Ich frage mich spontan, warum mit der Erfindung der Hose die Männer das Rocktragen aufgegeben haben? Als sich die Frauen das Recht erstritten haben, Hosen zu tragen, haben die das Rocktragen doch auch nicht aufgegeben. Für einen Erklärungsversuch und weitere Eindrücke habe ich aber keine Ruhe. Die Zeit schreitet voran und ich muss noch einige Einstellungen mit der chinesischen PC-Oberfläche vornehmen. Augenblicke später bin ich bereits so sehr mit dem Computer beschäftigt, dass ich vergesse, dass ich heute etwas anders angezogen bin.
Erst als sich die Tür öffnet und mir ein „Tsao an lao shi“ (Guten Morgen, Herr Lehrer) zugerufen wird, erschrecke ich. Ich sehe vom Schreibtisch auf. Dann ergießt sich die Karawane der Schüler, die nach dem Ordnungsdienst in ihrem Klassenzimmer bis zum Klingelzeichen gewartet haben. Jetzt kommen sie in fast geschlossener Reihe durch die Tür. Einige raunen den Nachfolgenden etwas zu. Allgemeine Heiterkeit macht sich breit. Ich bin mir sicher, die Kommentare betreffen mich. In den Gesichtern lese ich Ausdrücke wie: ‚Er hat es tatsächlich getan.‘ Man setzt sich zügig hin wie immer, lächelt mich freundlich an oder schwätzt mit den Nachbarn. Ich spüre eine deutlich gehobene Stimmung. Man ist erwartungsvoll und wartet gespannt auf den Startschuss.
Erst jetzt stehe ich auf und trete hinter meinem Computer hervor. Dann unruhige Stille. Noch nie habe ich gleichzeitig so viele Blicke an mir kleben gefühlt. Ich warte einen Moment, bis jeder mich gründlich von Kopf bis Fuß angeschaut hat, blicke in die Runde und grüße: „Guten Morgen.“
„Guten Morgen“, schallt es wie ein Echo zurück. Dann wieder Tuscheln und Roswita bemerkt: „Sie sehen heute besonders gut aus.“
Ihre Nachbarn am Tischecarré nicken zustimmend. Ich lächel dankbar und schaue zu einem Jungentisch. Skeptisch frage ich Julio: „Wirklich? Hat sie recht?“
Mit ernster Miene kommt die Antwort: „Na klar, warum ziehen Sie das nicht öfter an?“ Auch Julios Nachbar am Tisch nickt zustimmend.
„Danke, ich werde mir das mal für die Zukunft überlegen“, erwidere ich und wende mich an den zustimmenden Nachbarn: „Na, wenn mir das gut steht, dann muss das den Schülern ja erst recht stehen? Das ist schließlich eine Uniform für Schüler und nicht für Lehrer, oder?“
Etwas außer Fassung erklärt Brian auf Englisch: „Why not, it is a good choice for everybody.”
„What an open minded attitude“, lobe ich ihn. Und Julio ergänzt seriös: „We belong to a new and different generation.”
“Seems to be a promising generation”, beschließe ich den Dialog, um zum Vortrag überzuleiten. Ich befürchte, die Zeit für die Grammatik der Vergangenheitsformen könnte sonst zu kurz kommen. Und vorher steht ja noch meine Power-Point-Präsentation an.
Abb. 04a/b: Ich beim Fachunterricht in Schuluniform
Die ist ein zehnminütiger Ausflug in die Kulturgeschichte der Bekleidung. Im Mittelpunkt stehen die Beinkleider Rock und Hose. Ich beginne mit dem Rock als dem älteren Beinkleid und zeige Bilder u.a. von schottischen Soldaten und japanischen Samurai.
Abb. 05a/b: Soldat aus Griechenland, schottische Soldaten im Ersten Weltkrieg
Abb. 06a/b: Asiatische Soldaten heute und früher
Von Anfang an will ich deutlich machen, dass Röcke nicht verweiblichen und auch nicht verweichlichen. Männer können als Soldaten auch im Rock den Feind brutal ermorden. Das hat die Geschichte tausendfach in West und Ost bewiesen. Viele taiwanische Ureinwohner, so wie die Paiwan aus der Provinz Pin Dong, pflegen ihre Rockkultur (siehe Abb. 09). Der Rock ist ihnen selbstverständlicher Bestandteil eines furchtlosen Stammeskriegers.
Ich hoffe, das gibt den Kritikern zu denken. Das Vorurteil vom sogenannten Sissy-Boy ist zu kurz gedacht. Gemeint sind damit die Weicheier unter den Männern mit weibischen Verhaltensweisen. Solche Männer sind nach Meinung von Teilen der Bevölkerung latent homosexuell. Das disqualifiziert sie nach Ansicht nicht weniger Eltern als Lehrer. Das Unwissen und bisweilen die Ignoranz über die Kultur- und Modegeschichte der Geschlechter, das den Nährboden diskriminierender Vorurteile bereitet, ist enorm. Das weiß ich noch aus meinem eigenen Erziehungsumfeld als Kind. Als Rock tragender Lehrer an einer katholischen Privatschule falle ich schnell in diese Schublade. Ich muss darauf eingehen, wenn ich das Minenfeld überleben will, in das ich mich heute Morgen mit dem Umkleiden in die Schuluniform der Mädchen begeben habe.
Aus diesem Grund zeige ich auch ein Foto von mir im Dienstkleid eines Beamten der letzten chinesischen Dynastie, die bis 1911 reichte. Meine Tochter hat es aufgenommen während eines Sonntagsausflugs in Kaohsiung. Von unserer Adresse aus kann man das Freilichtmuseum der historischen Fong-Yi-Akademie bequem mit der U-Bahn erreichen. Die Akademie diente der ersten Stufe der Beamtenausbildung in der Qing-Dynastie. Dort kann man die alte Arbeitskleidung anprobieren. Mit den aufwendig restaurierten Lehrgebäuden im Hintergrund ergeben sich so historische Szenen für ein Erinnerungsfoto. Das Foto zeigt mich vor der Holztür eines Schulgebäudes, bekleidet mit dem langen, seidig schimmernden Kleid und dem zugehörigen Hut eines Beamten im unteren Dienst.
Abb. 07: Ich im Beamtenkleid der Qing-Dynastie
Die Schüler sind nicht sehr überrascht. Grundsätzlich wussten sie, wie sie sagen, von der Beamtenkleidung im Alten China. Aber es ist, wie sie berichten, irgendwie nicht richtig drin im Kopf, oder es steckt verstaubt in einem toten Winkel des Gehirns. Es braucht ihr aktives Bemühen, das Wissen bewusst zu machen, denn es widerspricht ihren täglichen Erfahrungen, die sich ihnen als Gewohnheiten ins Hirn eingegraben haben. Ungefähr hundert Jahre Kulturgeschichte sind seit damals vergangen. Die kulturellen Prägungen und Konventionen haben sich drastisch verändert. Kaum zu glauben, dass es mal ein erstrebenswertes Privileg war, das Kleid zu tragen. Die Bekleidungsvorschriften von früher sind heute ein no go. Heute taugen sie nur noch zur Karnevalskostümierung. Ein bedeutendes Stück Kulturgeschichte des Männerrocks ist nur noch vage präsent.
Die gefühlten Traditionen und Normen umfassen unsere eigene Erlebenswelt und die Erlebenswelt unserer Eltern und eventuell Großeltern. Zu älterer Geschichte haben wir vielleicht Wissen, aber keine Beziehung. Die Qing-Dynastie liegt zu weit zurück. Sie ist zu weit entfernt vom aktuellen Leben. Was heute als weiblich oder männlich angesehen wird, kann zu anderen Zeiten anders gesehen worden sein. Das Beamtenkleid war sicher nicht weiblich, auch wenn wir das heute anders empfinden mögen. Es ist deshalb gefährlich, unsere gelebte Erfahrung 1:1 auf andere Epochen zu übertragen. Das führt schnell zu Geschichtsverfälschung. Wir neigen aber dazu, weil Erfahrungen als selbst erlebte Ereignisse uns so sehr überzeugen. Wir empfinden sie als so allgemeingültig, dass wir sie leicht ohne Weiteres als erwiesen einstufen und auch so damit umgehen. Das macht es so schwer, historisches, faktisches Wissen in unser aktives Denken und Handeln zu integrieren. Eigene Eindrücke wiegen schwerer als theoretisches Wissen. Ich glaube die Schüler spüren diese Diskrepanz zwischen ihrem gefühlten Wissen und den Fakten des Vortrags. Das beeindruckt sie so sehr an den folgenden Bildern
Sie zeigen Frauen beim Reiten auf einem Damenreitsattel. Sie tragen lange Kleider bis zu den Knöcheln. Beide Beine hängen auf einer Seite des Pferderückens, damit der Rock nicht hochrutscht. Sportlich sieht das nicht aus, eher als ob die Damen gerade vom Fünf-Uhr-Tee mit den strickenden Freundinnen kämen. Damals waren Hosen den Männern vorbehalten. Das hatte nichts mit einer Maßnahme zu tun, dass die Männer nicht mehr so oft vom Pferd fallen, sondern viel mehr mit Politik und Herrschaft. Den Schülern sind diese Bilder völlig fremd. Sie können sich emotional nicht vorstellen, dass vor nicht einmal siebzig Jahren Frauen in Hosen ein Skandal waren.
Abb. 08a/b: Frau in der Schwerindustrie, Marlene Dietrich 1933
Andere Bilder zeigen Frauen in Hosen. Die arbeiteten in der industriellen Produktion, als während der Weltkriege die Männer als Soldaten ihr Kriegshandwerk anrichteten. Frauen ersetzten die Männer an deren Arbeitsplätzen. Dort durften sie ausnahmsweise Hosen tragen. Gerade in der Schwerindustrie war das Arbeiten so leichter. Nach getaner Arbeit mussten sie sich aber wieder umziehen. Der Anblick von Frauen in Hosen galt in der Öffentlichkeit als unmoralisch. Die Schüler sind erstaunt, dass die Hose für Frauen sich so ganz erst in den siebziger Jahren durchsetzte, als auch die internationalen Luxushotels das Hosenverbot für Frauen aufhoben. Der Bundestagsvizepräsident Richard Jaeger (CSU) drohte noch 1970, weibliche Abgeordnete in Hosen aus dem Plenarsaal zu weisen.
Eine Schülerin meint, dass Hosen für sie im Alltag unverzichtbar sind. Und ich ergänze: „unverzichtbar geworden sind.“ Ihr Selbstverständnis als Frau in Hosen hat heute eine ganz andere Dimension als bei meiner Mutter oder Großmutter, auch weil ihr der emotionale Bezug zu der Zeit fehlt, als Hosen noch nichts für Frauen waren.
Zum Vortragsende gibt es Bilder von Männern, die heute noch Rock tragen. Ich zeige unter anderem: griechische Wachsoldaten vor dem Präsidentenpalast, englische Universitätslehrer bei einer Zeremonie, Priester und Mönche, den japanischen Kaiser im Kimono, Kendo-Kämpfer, indische Politiker im langen und indische Arbeiter im kurzen Lungi, Polizisten aus einigen Ländern Polynesiens und Sarong tragende Touristen bei einem Tempelbesuch auf Bali.
Abb. 09a/b: Polizeikapelle aus Samoa, Krieger der Paiwan
Die Schüler zeigen sich sprachlos. Ich erfahre, dass sie nicht gedacht haben, dass der Rock als universelles Kleidungsstück aller Geschlechter so weit verbreitet war und immer noch ist. Sie erkennen zum Ende, dass die Haltung zu Rock wie Hose variabel ist und mehr oder weniger vom jeweils aktuellen, kulturellen Zeitgeist abhängt. Mehr darf ich nicht von einem Kurzvortrag erwarten.
Erst mit dem Ende des Vortrags wird mir wieder bewusst, das ich nicht nur über Röcke rede, sondern auch einen trage. Das hatte ich zwischendurch völlig vergessen. Man muss sich nur mit anderen Dingen beschäftigen, schon verschwindet der Rock im Alltag und wird kaum merklich zur Tagesroutine. Das ist ein Zeichen für Normalität. Ich staune, wie schnell das geht. Vor etwa einer halben Stunde hatte ich noch Bauchgefühle mit Bedenken gegen den Rock, und jetzt fühle ich mich, als hätte ich nie etwas anderes getragen. Genauso normal setzt sich der Unterricht mit dem Grammatikteil fort. Es gibt kein Lachen und kein Tuscheln mehr. Jeder konzentriert sich auf meine Ausführungen zum Perfekt und probiert die Beispielsätze. Mein Rock ist auch bei den Schülern in der Normalität des Alltags angekommen. Der wird zur Nebensache, wo der Fokus auf den Unterricht schwenkt. Es gilt halt das Rock wie Hose-Prinzip. Wo der Unterricht im Mittelpunkt steht, wird Bekleidung zweitrangig. Bedenken, dass ich mich mit meiner Verkleidung eventuell lächerlich mache und an Autorität verliere, bestätigen sich nicht. Das Gegenteil trifft zu. Die Schüler zeigen sich beeindruckt.
Herausgerissen werde ich aus dieser Normalität erst wieder, als der bestellte Fotograf hereinkommt. Automatisch fange ich an, für die Kamera zu posieren. Beim Gehen setze ich die Füße voreinander. Im Stehen winkele ich das rechte Knie etwas an. Die linke Hand stützt die Hüfte. Nach einigen Augenblicken wird mir mein übertrieben weiblicher Gang anstrengend. Er entspricht nicht meinen natürlichen Bewegungen. Etwas später versuche ich noch mal den Catwalk-Gang. Wenn ich schon in einer Kostümierung auftrete, dann gehört das dazu. Die Rolle ist interessant, ich kann die Erfahrung durchaus weiter empfehlen. Sie weicht aber zu sehr von meinem Bewegungsmuster ab, um daran Gefallen zu entwickeln. Es bleibt anstrengend und meinem Bewegungsapparat fremd. Ich spiele eben nur das Schulmädchen, mehr nicht. Es ist eine Erfahrung, die ich zu einem besonderen Anlass gerne wiederhole. Nur in meinem Alltag brauche ich das nicht. In meinen Alltag möchte ich aber durchaus den Rock mitnehmen.
Seit heute weiß ich, es gibt in einem feuchtheißen, tropischen Klima keine bequemere Kleidung als einen weiten Rock. Mit dieser physischen Erfahrung im Bewusstsein kann ich überhaupt nicht mehr verstehen, warum Röcke zur Frauensache geworden sind. Ich finde, das sollte sich ändern.
Wenn ich genauer überlege, sind selbst viele traditionelle Männerhosen heute Frauenhosen geworden. Mit einer Hose ist Mann heute nicht immer auf der anerkannt männlichen Seite. Das ist umso verwunderlicher, wenn man bedenkt, dass vor weniger als hundert Jahren Frauen nicht mal Hosen tragen durften. Damals waren alle Hosen für Männer da. Heute werden alle betont weiten Hosen ganz überwiegend nur noch von Frauen getragen.
Abb. 10: Knickerbocker und moderner Hosenrock
Dazu gehören auch Pump- und Pluderhosen, wie ich sie im Urlaub auf dem Balkan und auf Kreta bei alten Männern gesehen habe. Die waren weit geschnitten. Nur an den Waden waren sie eng. Ihr Schritt hing auf Kniehöhe. Selbst die Sansculotte der französischen Arbeiter, die in der französischen Revolution zum Markenzeichen der Jakobiner wurde, wird heute unter dem Namen Culotte als kniebundfreie Damenhose oder Hosenrock ausschließlich für Frauen angeboten (siehe Abb. 10, kleines Bild). Die Knickerbocker meines Großvaters finde ich ebenfalls nicht mehr bei der Herrenmode. Das waren wadenlange Hosen, die so lang und weit geschnitten waren, dass der Stoff über die Bünde am Bein fiel. Heute werden diese und ähnliche Hosen nur noch in den Abteilungen für Damenmode angeboten.
Das letzte Rückzugsgebiet für Weite und Schritttiefe, das Männern geblieben ist, befindet sich daheim mit Nachthemd, Schlafanzug und Morgenmantel. Den hitzefreundlichen Schlabber-Look gibt es für Männer nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mit etwas Kreativität ließe sich aus jeder Pyjamahose leicht eine coole Freizeithose entwickeln, die einen heißen Sommer angenehmer macht. Für Frauen gibt es das schon.
Wie kommt das? Was ist passiert? Welche neuen Erkenntnisse haben dazu geführt, die Bekleidungsordnung für Frauen freier zu gestalten und gleichzeitig für Männer zu verschärfen? Wie wurden aus klassischen Männerhosen Hosenröcke für Frauen? Warum ist das so, wo doch für Männer weite Unterhosen, wie Boxershorts, unter weiten Hosen bequemer zu tragen sind? Unter einem hohen Schritt kann es ganz schön eng werden. Gerade als Mann spüre ich deutlich, ob ich unter Basketballhosen einen Slip oder Boxershorts trage. Der männlichen Anatomie kommt ein tiefer Schritt sehr entgegen. Die optimale Oberbekleidung für Boxershorts ist ganz bestimmt ein Rock. Da gibt es keinen Schritt, der im Weg sein könnte. Ich werde das ausprobieren.
Das Ende der Schulstunde ist erreicht. Ich sage Dankeschön für die allgemeine Begeisterung und ich sage Dankeschön für die Gelegenheit zu dieser Erfahrung. Irritiert, weil niemand Fotos macht, füge ich noch hinzu: „Sie dürfen jetzt fotografieren.“ Erst jetzt wird nach den Smartphones gegriffen. Eine Traube von FotografenInnen baut sich vor mir auf. Es sieht ein wenig so aus wie auf einer Pressekonferenz. Erst werde ich fotografiert, dann kommen Selfies mit mir. Zum Schluss muss der bestellte Fotograf ein Klassenfoto machen. Der nächste Lehrer, der die Klasse übernimmt, lässt sich von der Stimmung anstecken. Auch er will Fotos von sich und den Schülern und mir. Bei so viel Freude kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die diesen Spaß nicht billigen.
Abb. 11: Ich löse mein Versprechen ein
Aber Vorsicht, vergessen wir nicht, dass meine eigenen Bauchgefühle mit dieser Verkleidungsaktion nicht einverstanden waren und dass ich mich selbst erst überzeugen musste. Vier Dinge haben mich im Rahmen der Aktion und ihrer Vorbereitung nachhaltig beeindruckt:
1 Die Bequemlichkeit von Röcken
2 Die Macht sozialer Prägungen
3 Die neugierige Offenheit der Schüler
4 Mein Gewinn an Autorität trotz eines umstrittenen Themas durch Entschlossenheit, authentisches Auftreten und fachliche Ausgewogenheit.