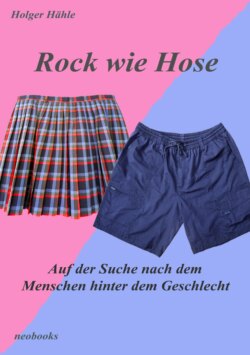Читать книгу Rock wie Hose - Holger Hähle - Страница 7
04 Die Zeit danach
ОглавлениеFür den nächsten Unterricht ziehe ich mich wieder um. Das erledige ich diesmal auf der nicht klimatisierten Herrentoilette. Hier wiederholt sich die einschneidende Erfahrung vom ersten Umziehen. Die Reihenfolge ist nur umgekehrt. Erst streife ich den Rock bequem aus, dann kämpfe ich mich in die vom morgendlichen Schwitzen noch feuchte Jeans. Der Vorgang erinnert mich ans Tauchen, wenn ich mich in einen hautengen Neoprenanzug zwängen muss. Zusätzlich behindern die Kabinenwände. Die Hitze treibt mir Schweißperlen auf die Stirn. Von den vollgesogenen Augenbrauen tropfen sie auf die Brillengläser.
Automatisch frage ich mich: ‚Wieso tu ich mir das an? Wieso ziehe ich mich überhaupt um? Hosen sind nicht immer bequem, nicht nur jetzt beim Anziehen. Durchschwitzte oder enge Hosen ziehen im Schritt beim schnellen Gehen oder Treppen steigen. Kann ich nicht den Rock anbehalten? Das ist viel komfortabler.‘
Bequemlichkeit schlägt sich so intensiv auf mein Wohlgefühl durch. Das verkneife ich mir nur ungern. Den so komfortablen Rock opfere ich also nur widerstrebend einer Männlichkeitsfantasie zur Geschlechterordnung, die die Welt nicht wirklich braucht. Ich muss aber gerade in einer offiziellen Situation nachgeben. Der gesellschaftliche Standard ist festgelegt. Und der ist besonders am Arbeitsplatz heute anders als in der Qing-Dynastie oder zu anderen Zeiten. Meine praktischen Überlegungen spielen dabei eine viel zu kleine Rolle.
Ich weiß ja selbst, dass auch im 21. Jahrhundert Röcke weiterhin sexualisieren. Gerade bei der Schuluniform liegt der Sinn nicht nur darin Unterschiede zu egalisieren, sondern auch gleichzeitig den von vielen als wichtig empfundenen Geschlechtsunterschied durch Röcke und Hosen, hervorzuheben. Gemeinsamer Unterricht bedeutet eben nicht immer, dass die Gemeinsamkeiten im Mittelpunkt stehen. Das wird auch dort sichtbar, wo die Hose für Schülerinnen an unserer Schule schon durchaus ein etabliertes, gemeinsames und zeitgemäßes Kleidungsstück sein könnte und trotzdem von Müttern und der College-Leitung nicht gern gesehen wird. Was den Schülerinnen an unserem College billig sein könnte, ist den Männern noch sehr teuer.
Heute widersprechen Röcke für Männer nach langer Tradition aktuellen Konventionen und in meinem Fall auch den Rahmenbedingungen für meine Anstellung. Ich müsste schon ein Mönch sein, um offiziell ein Kleid tragen zu dürfen. Jeans und ähnliche Hosen sind für männliche Lehrer nun mal die vorgesehene, aktuelle Arbeitskleidung in einem konfessionellen Umfeld, das auf seine Traditionen stolz ist. Zu kurz dürfen die auch nicht sein. Wo schon Bermudas unerwünscht sind, haben Röcke für Männer erst recht keine Chance. So viel Unvernunft ist bedauerlich aber auch sozio-kulturell vom Zeitgeist legitimiert.
Allerdings fühle ich mich durch mein Rockerlebnis wie der Blinde, der plötzlich sehen kann. Und jetzt soll ich die Augen wieder zukneifen? Werden wir von gesellschaftlichen Normen gegängelt ohne tieferen Sinn? Kapituliere letztlich auch ich gegenüber überkommenen Regeln, die altbacken und willkürlich wirken? Gebe ich zu leicht nach? Mit ein bisschen Logik könnten Regeln leicht modernisiert werden. Angestaubten, obsoleten Regeln könnte mit evaluiertem Sinn neues Leben eingehaucht werden.
Da beruhigt es mich ein wenig, dass zu anderen Zeiten Menschen noch unbequemere Kleidung tragen mussten, um die Reize ihres Geschlechts hervorzuheben. Der enge Stehkragen der Herrenhemden des neunzehnten Jahrhunderts wurde nicht ohne Grund Vatermörder genannt, schränkte er doch die Bewegung des Kopfs und manchmal auch das Schlucken ein. Ein Glück, können wir heute auf dieses wahnsinnig männliche Utensil verzichten. Es ist so überflüssig wie ein Kropf oder wie das Schnürmieder für Frauen aus der gleichen Epoche.
Warum sollte es nicht gelingen, noch einmal solchen Unsinn zu überwinden? Die Menschen haben sich doch lernfähig gezeigt. Nun ist es leicht mit großer zeitlicher Distanz eine sachliche Kritik zum Unsinn vergangener Tage zu formulieren. Schwieriger ist Unvoreingenommenheit im Alltag. Zu allen gelebten Dingen haben wir eine emotionale Beziehung. Ein bisschen mehr pragmatisches statt gewohnheitsorientiertes Denken wäre ein guter Anfang. Das Leben kann so viel einfacher sein, wenn wir einfach nur Mensch sind. Eine permanente geschlechtliche Positionierung brauche ich nicht. Das überlasse ich gerne den Machos.
Vielleicht sollte ich in meiner Freizeit anfangen, mir bezüglich meiner Kleidung ein paar Freiheiten zu gönnen, wenn sie mir das Leben in den Tropen leichter machen. Ein Rock ist so präsent. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, ich bin angezogen. Normalerweise greife ich in den Kleiderschrank, ziehe ein Hemd und eine Hose heraus und gehe damit durch den Tag. Würde mich jemand fragen, welche Farbe meine Hose hat, ich müsste mich bücken um nachzusehen. Es ist mir nicht bewusst. Ich weiß, ich brauche eine Hose und nehme morgens die, die im Schrank oben aufliegt. Der Rest des Tages gehört anderen Dingen. Mit einem Rock ist das anders. Der ist keine zweite Haut wie Röhrenjeans. Es gibt zwischendurch immer ein Feedback, weil der Wind den Rock bewegt oder ich über Treppenstufen springe. Ein Rock lebt. Ich werde weiter darüber nachdenken. Jetzt muss ich aber schleunigst zur nächsten Klasse.
Die SchülerInnen dieser Klasse lernen im dritten Jahr Deutsch. Viele haben schon das Zertifikat B1 des Goethe Instituts absolviert. Die Älteren sind 18 Jahre alt. Es ist ihr letztes Jahr in der klassischen Schuluniform. Danach endet die Schulpflicht. In den letzten zwei Jahren des fünfjährigen College tragen die Frauen dann gerade geschnittene Röcke in Blau, die etwas enger sind. Bei den Schuhen ist etwas mehr Absatz erlaubt.
Für den lockeren Einstieg entscheide ich, ein wenig von meiner Karnevalsvorführung zu erzählen. Das hätten sie auch gerne erlebt und wollen, dass ich das für sie wiederhole. Ich vertröste sie auf das nächste Jahr oder vielleicht Halloween. Ich mag nicht zustimmen. Ihre Begeisterung ist anders gemischt. Neben aufrichtig Neugierigen scheinen zu viele nur an der Sensation interessiert zu sein. Als Freak will ich aber nicht auftreten.
Meine Aktion vom Morgen spricht sich herum. Mittags im Fachbereich wollen Kollegen Informationen aus erster Hand.
„Na“, frage ich zurück, „was haben euch denn die Schüler erzählt?“ Die haben in diesem Fall nichts erzählt. Diesmal konnte sich der Kollege nicht zurückhalten, der die Klasse nach mir übernommen hat. Das amüsiert mich, aber es freut mich auch. Zeigt es doch, wie sehr der Lehrer angetan ist. Solche Unterstützung durch das Kollegium ist mir wichtig.
Nachmittags zeigen sich viele Schüler anderer Klassen ebenfalls gut informiert. Der verbale Austausch ist offensichtlich rege. Den Rest besorgt Facebook. In den kommenden Tagen sprechen mich alle meine anderen Klassen auf die Verkleidungsaktion an. Jede will eine exklusive Wiederholung.
Aus Sorge, ich könnte zu viel Aufsehen erregen, lehne ich ab. Nur wenn es relativ ruhig bleibt, könnte man eventuell einen weiteren Schritt wagen. Im Moment gehe ich davon aus, dass die Gegner sich zurückhalten, weil sie an eine Aktion mit begrenzter Wirkung glauben. Vielleicht gibt es aber auch gar nicht so viele Gegner. Vielleicht hat sich die Gesellschaft wirklich weiter entwickelt? Mal abwarten. Wir werden es sehen.
In einigen Fällen fallen mir die Absagen nicht so leicht. Immer, wenn ich auf echte Neugierde stoße, möchte ich schon gerne zustimmen. Ich fange an, nach einer Alternative zu suchen. Vielleicht kann man die Rockfrage in anderer Form mit einem Unterrichtsthema verknüpfen? Sowieso hat die Aktion bereits einige Fragen aufgeworfen, für die ich Antworten suche.
Ich bin zum Beispiel beeindruckt, dass der Rock der Schuluniform für jede Schule anders ist. Das entspricht einer in Schottland entstandenen Tradition, mit dem Kilt auch eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu verbinden. Auch die Schulröcke in Taiwan bedienen sich gerne des typischen, schottischen Karomusters, das auch Tartan genannt wird, um sich von anderen Schulen zu unterscheiden. Die Farben von Wenzao gibt es nur einmal. Falten gibt’s auch. Allerdings hat ein schottischer Kilt nur hinten Falten. Vorne ist er glatt. Der ganz große Unterschied zwischen Kilt und Schulrock liegt aber bei den Trägern. Traditionell ist der Kilt ein Rock nur für Männer. Ursprünglich waren Frauen vom Tragen ausgeschlossen. Beim Schulrock verhält es sich genau umgekehrt. Hier sind die Mädchen die alleinigen Trägerinnen der Schulfarben. Diesmal sind die Jungs ausgeschlossen. Wie können sich die Regeln für das Tragen eines doch sehr ähnlichen Rockes mit gleicher Sekundärbedeutung (das Design verweist auf eine Gruppenzugehörigkeit) nicht nur ändern, sondern ins Gegenteil verkehren?
Wenn der Rock als Kilt zum geschlechtsspezifischen Bekleidungsmerkmal wird und dann als Schulrock die Geschlechtszugehörigkeit wechselt, möchte man glauben, dass es dafür einen gewichtigen Grund gibt. Andernfalls frage ich mich: Wie ernst darf man Konventionen nehmen, wenn sie austauschbar sind. Eigentlich könnte die Wahl für Rock oder Hose auch freigegeben werden. Röcke haben eine lange Geschichte für Frauen und Männer.
Ich fürchte, Konventionen sind weitgehend frei von biologischen Notwendigkeiten. Konventionen sind als kulturelle Derivate entkoppelt von biologischen Notwendigkeiten. Ich ahne, Konventionen sind nur Vereinbarungen über vorherrschende Gefühlslagen und Standpunkte. Die sind streitbar wie Ideologien. Letztlich sind sie austauschbar, weil sie nicht auf universelle Wahrheiten bauen. Konventionen sind unnatürlich in dem Sinne, dass sie ohne die Natur als Grundlage auskommen. Das macht sie zu Produkten unserer Fantasie. Das macht Konventionen zu sozialen Kultur-Artefakten. Wir können sie ändern oder sogar umkehren, ganz im Gegensatz zu den Naturgesetzen, die unsere Biologie bestimmen.
Wenn aber der Rock weder durch die Kulturgeschichte noch durch Konventionen biologisch legitimiert ist als weibliches Kleidungsstück, wieso glotzen dann manche Menschen, wenn sie Männer in Röcken sehen? Wieso werden Männer im Rock dann kritisiert und manchmal angefeindet?
Nachdem ich diese und andere Fragen mehrfach durchgegangen bin, komme ich zu einer Idee, die im Rahmen eines Schulunterrichts das Rockthema aufgreift. Ich beschließe, im Fach Wirtschaftsdeutsch das Thema Marketing um ein Rollenspiel zu ergänzen. Anlass ist meine Frage. Warum tragen Männer in den meisten Kulturen heutzutage keine Röcke mehr? Ich finde heraus, dass es Ansätze gegeben hat das zu ändern. Es sind sogar prominente Namen und Marken damit verbunden. John Galliano, Marc Jacobs und Jean-Paul Gaultier haben Männerkollektionen entworfen, einschließlich Hosen und Röcken. Die Modekette H&M hat 2010 einen Männerrock angeboten, der unter dem Rock ähnlich wie bei Tennisröcken noch eine Art Shorts hatte. Zum Erfolg hat das nicht beigetragen. Genau wie bei anderen Bemühungen um den Männerrock, wurde auch er zu wenig gekauft, um zu einer Renaissance zu führen.
Abb. 12: Männerrockmode der letzten Jahre, u.a. von Gaultier und Jacobs
Warum sind die Anstrengungen gescheitert? Meine Idee ist, wir gehen im Rollenspiel von einem Männermodelabel aus, das versucht, mit einem Mänerrock neue Akzente zu setzen, um letztlich höhere Marktanteile zu gewinnen. Um im Gegensatz zu Gaultier und Co. erfolgreich zu planen, brauchen wir eine überzeugende Marketingkonzeption mit ausgefeiltem Marketing-Mix. Die notwendigen Planungsdaten sollen mit statistischen Mitteln und Befragungen erhoben werden, so wie das in der Marktforschung (Mafo) etabliert ist.
Ich verspreche mir von der Vorgehensweise, dass wir herausfinden, was für die Akzeptanz von Männerröcken wichtig ist. Die Empfehlungen, die wir daraus ableiten, könnte ich vielleicht sogar für mein Bekleidungsverhalten nutzen. Schließlich will ich in Zukunft bei tropischen Temperaturen häufiger Rock tragen und gleichzeitig die Akzeptanz meiner Mitmenschen finden. Für die Studenten ist so ein Rollenspiel eine realitätsnahe, praktische Marketing-Erfahrung.
Ich habe Glück, das Argument der Praxisnähe überzeugt die Studenten, sowie die Tatsache, dass für den Umfang des Themas zwei andere eher theoretische Unterrichtseinheiten gestrichen werden. Außerdem verspreche ich, mich bei der Umsetzung des Marketingplans als Model zur Verfügung zu stellen. So haben sie bei einer Modenschau oder einem Foto-Shooting dann doch noch die Gelegenheit, mich leibhaftig im Rock zu erleben.
Mir ist ein solches Ereignis, bei dem ich als Mann auftreten kann, viel lieber, als noch einmal die Rolle des Schulmädchens zu wiederholen. Als Mann fühle ich mich einfach besser. Ich gehöre eben nicht zu den Menschen, die gerne eine Frau wären, was ich im Übrigen aber auch in Ordnung fände. Was soll daran schlecht sein, eine Frau zu sein. Ich liebe Frauen. Ich bin deswegen sogar mit einer Frau verheiratet. Aber zu meiner Natur passt eben nur ein Kerl. Was ich suche, ist nicht ein Geschlechterwechsel, sondern mehr Freiheit in der Männerrolle und als Mensch neben meinem Geschlecht sowie zwischen den Geschlechtern. Ich habe kein Problem mit meinem Geschlecht. Ich habe ein Problem damit, dass meinem Geschlecht eine zu große Bedeutung beigemessen wird, die den Menschen dahinter verdeckt.
Mir sind die Rollenzuweisungen der Geschlechter zu eng. Das muss nicht so sein. In der Geschichte war das auch mal anders. Ich glaube, die Geschlechter verbindet mehr, als die tatsächliche Rollenverteilung zeigt. Rollen trennen. Sie schaffen Ungleichheit. Ich möchte die Gemeinsamkeiten pflegen. Unterschiede sind mir nur dort wichtig, wo es den Geschlechtern biologisch nützt oder eine sexuelle Orientierung unterstützt.
Schon der Begriff Rolle macht deutlich, dass das Erlernen von Verhalten wichtig ist und das es nicht von Natur aus angelegt sein muss. Konventionen verbinden das Geschlecht mit einer Rolle. Das ist möglich, weil Biologie und Kultur entkoppelt sind. Die Konventionen ersetzen mit ihren Regeln die Naturgesetze. Gesichertes Wissen repräsentieren Konventionen nicht. Maximal sind sie Prämissen eines überzeugten Glaubens. Trotzdem wird das Regelwerk zum Drehbuch unseres Lebens, dass das Geschlecht zur Hauptrolle und zum Lebensmittepunkt erklärt.
So wie ein Schauspieler eine Filmrolle lernt, werden Geschlechterrollen einstudiert. Da wir von Kindheit an Geschlechterrollen üben, gehen sie uns in Fleisch und Blut über. Im Gegensatz zu einem Schauspieler, der seine Film- oder Theaterrollen wechselt, verinnerlichen wir durch lebenslanges Training unsere Geschlechterrolle. So werden wir zur Rolle und kommen nicht auf die Idee, eine Rolle zu verändern oder zu wechseln. Obwohl Rollen grundsätzlich veränderbar und austauschbar sind, wird uns die einstudierte Rolle zur universellen Identität.
Rollen definieren unser Verhalten aber auch unsere Erwartungen an andere. Neben den Rolleneigenschaften, die wir einnehmen, gibt es Forderungen zum Rollenbild an andere Menschen. Wir sind enttäuscht, wenn andere dieser Pflicht nicht nachkommen.
Stellen Sie sich vor, der Moderator einer großen Abend-Gala kündigt einen Gast an. Der Gast heißt Yasmin Meyer. Tatsächlich betritt aber Herbert Meyer die Bühne. Die Erwartung, die die Ankündigung ausgelöst hat, wird dann enttäuscht. Wenn aber Yasmin Meyer die Bühne betritt und ein T-Shirt mit Jeans trägt, sind wir auch enttäuscht, denn unsere Rollenvorstellung erwartet von einer Frau auf einer Gala ein Abendkleid. Selbst wenn T-Shirt und Jeans von einem Stardesigner durchgestylt sind, widersprechen wir. Erst müssen wir den Bruch mit unserer Rollenerwartung überwinden, um anerkennen zu können, dass die T-Shirt-Jeans-Kombination ihr vielleicht großartig passt. So verhält es sich auch aktuell mit Männerröcken.
Wenn Leute sagen, ‚Röcke für Männer, das passt doch gar nicht“, dann ist das genauso richtig wie die Meinung, dass Hosen nichts für Frauen sind. Beide Meinungen stehen in Übereinstimmung mit dem Rollenverständnis und dem Zeitgeist einer bestimmten Ära. Nur, Zeiten und Moden ändern sich. Das hat mehr mit Vorlieben zu tun als mit dringenden Notwendigkeiten. Ist das nicht ein guter Anlass mehr Toleranz zu zeigen?