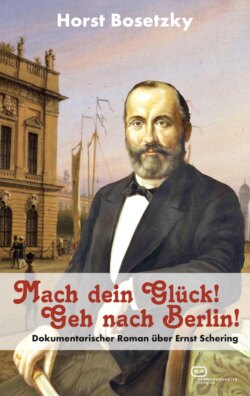Читать книгу Mach dein Glück! Geh nach Berlin! - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 5
ОглавлениеProlog
Am Anfang stand die Alchemie
1889
Ernst Schering war ein großer Name in Berlin. Jeder kannte den Königlichen Kommerzienrat und seine „Chemische Fabrik auf Actien“ im Wedding an der Müllerstraße. Als am 27. Dezember 1889 bekannt wurde, dass Schering soeben verstorben war, griffen viele Männer zur Feder, um einen Nachruf auf ihn zu verfassen, so auch der Schriftsteller und Volkspädagoge Ferdinand Schmidt. Dessen Erinnerungen gingen um mehr als fünf Jahrzehnte zurück ...
1837
Das Kloster Neuzelle war im Jahre 1268 vom sächsischen Markgrafen Heinrich dem Erlauchten gegründet worden, um einmal seiner verstorbenen Ehefrau Agnes zu gedenken und um zum anderen den von den polnischen Piasten erworbenen Landstrich zwischen Oder und Schlaube wirtschaftlich besser zu erschließen. Zwischen 1300 und 1330 entstand auf einem Bergsporn, der in die Oderniederung ragte, eine prächtige dreischiffige Hallenkirche. Nach einer wechselvollen Geschichte kam die sächsische Niederlausitz 1814/15 als Folge des Wiener Kongresses an Preußen und wurde von Friedrich Wilhelm III. säkularisiert. Im Waisenhaus des Klosters wurde ein Lehrerseminar eingerichtet.
Hier nun verbrachte Ferdinand Schmidt entscheidende Jahre seiner Jugend. Er war am 2. Oktober 1816 in Frankfurt an der Oder auf die Welt gekommen und hatte seine Jugend im Klosterort Neuzelle verbracht, wo sein Vater die Stelle eines Kornschreibers innehatte. Früh hatte er sich als Pädagoge versucht und war schon im Alter von nur 15 Jahren in einer nahen Oberförsterei als Hauslehrer engagiert geworden. Nach dem Tode seines Vaters hatte er in sein Elternhaus zurückkehren müssen, nun aber besuchte er das evangelische Lehrerseminar, um staatlich anerkannte Lehrkraft zu werden. „Volkspädagoge, das steckt mir so im Blut“, pflegte er zu sagen, doch irgendwie wollte er auch als Schriftsteller reüssieren.
An diesem Vormittag nun galt es, ein Referat über die ebenso unheimliche wie faszinierende Alchemie und die berühmtesten Alchemisten zu halten. Er begann mit schwankender und etwas zu hoher Stimme, wurde dann aber zunehmend sicherer.
„Das Wort Alchemie leitet sich wohl vom Arabischen al-kīmiyā ab, und schon seit Jahrtausenden üben die Alchemie und die Alchemisten eine erhebliche Faszination auf uns alle aus. Gemeinhin wird angenommen, dass es das einzige Ziel der Alchemisten gewesen sei, aus unedlen Stoffen Gold zu machen – Gold, das schon in der babylonischen Philosophie als das Metall der Erlösung gegolten hat. Für diese Umwandlung, auch Transmutation genannt, brauchte man eine besondere Tinktur – das war der berühmte Stein der Weisen.“ Er machte eine Pause, um sich die Lippen zu befeuchten. „Heute würden wir sagen, die Alchemisten seien allesamt Irrwege gegangen und gehörten ins Irrenhaus, aber ihnen verdanken wir die Erfindung des Porzellans, des Bologneser Leuchtsteins und des Schwarzpulvers, jedenfalls was Europa betrifft. Der berühmteste Alchemist in unseren Breiten war wohl Markgraf Johann von Brandenburg, der von 1406 bis 1464 gelebt hat, aber auch unserem Prinzen Friedrich Wilhelm Ludwig von Preußen sagt man diesbezügliche Neigungen nach.“ Jetzt holte er weit aus und kam auf die philosophische Dimension der Alchemie zu sprechen, was aber seine Zuhörer nicht sonderlich interessierte. „In unseren Tagen“, so schloss er nach etwa einer halben Stunde unter dem Gelächter seiner Zuhörer, „sind die Apotheker und die Chemiker an die Stelle der Alchemisten getreten.“
Einige Tage nach diesem Vortrag unternahm das Lehrerseminar einen Ausflug ins uckermärkische Prenzlau. Unten am Ufer der Oder lagen zwei Boote bereit, und auf denen ging es bis nach Schwedt, wo auf Pferdewagen umzusteigen war.
Ihr Mentor war die ganze Zeit über damit beschäftigt, ihre Allgemeinbildung zu verbessern.
„Nennt mir berühmte Männer und Frauen, die in Prenzlau das Licht der Welt erblickt haben?“
„Keinen und Niemand“, kam es aus den hinteren Reihen.
„Doch!“ rief der Mentor und zählte dann einige Söhne und Töchter Prenzlaus auf, die er für Berühmtheiten hielt. „Christian Friedrich Schwan, Verleger und Buchhändler. Jacob Philipp Hackert, Landschaftsmaler. Friederike von Hessen-Darmstadt, Königin von Preußen ...“
„Gott!“ lachte einer. „Die war doch furchtbar unscheinbar und völlig unbegabt.“
„Ruhe! Dann haben wir noch Wilhelmina von Hessen-Darmstadt, Gattin des Zaren Paul I.“
Ferdinand Schmidt meldete sich zu Wort. „Das verstehe ich nicht: Was hat denn Prenzlau mit Hessen-Darmstadt zu tun?“
„Ganz einfach: Die Damen wurden in Prenzlau geboren, weil ihre Väter in preußischen Diensten standen und hier stationiert waren.“
„Ach, haben die Väter sie zur Welt gebracht?“
„Ich verbitte mir diese Scherze!“
Der Mentor fand, dass es einigen der Seminaristen doch erheblich an sittlicher Reife mangele. Der nächste Scherz kam ihm zum Glück gar nicht erst zu Ohren. Beim Stichwort Darmstadt fragte nämlich einer der Zöglinge Ferdinand Schmidt, ob der denn wisse, was ein Furz sei?
„Nein.“
„Eine Botschaft von Pforzheim nach Darmstadt, dass eine Fuhre Dung unterwegs ist.“
Ferdinand Schmidt sah den Kameraden tadelnd an. „An dir ist noch viel zu veredeln, bevor du auf die Jugend losgelassen wirst, sie zu veredeln.“
„Ach, in dem, was aus dem Volke kommt, steckt mehr Kraft drin als in all unserer Gelehrsamkeit.“
„Hm ...“ Ferdinand Schmidt ging mit dem Gedanken schwanger, eine Preußische Vaterlandskunde für Schule und Haus zu verfassen, so sein Arbeitstitel, und da war es vielleicht gar nicht schlecht, Wendungen und Bilder aus dem Alltag zu benutzen, um die Leser zu ködern.
Endlich waren am Horizont die Türme Prenzlaus zu erkennen, und auf dem Marktplatz angekommen, wurde der Wunsch geäußert, in ein Gasthaus einzukehren, denn man sei nach der langen Reise ausgehungert und vor allem durstig geworden.
„Abschlägig beschieden!“, rief der Mentor. „Erst treten wir an zur Stadtbesichtigung.“
Dann ging es los mit den Kirchen: St. Sabini, St. Jacobi, St. Marien, St. Nikolai …
„Und ich komme aus St. Endal“, brummte der Seminarist, der das mit der Fuhre Dung zum Besten gegeben hatte.
„Mein Vater aus St. Uttgart“, fügte ein anderer hinzu.
Ferdinand Schmidt fragte sich, wie seine Kameraden später reagieren würden, wenn ihre Schüler Derartiges zum Besten gaben. Wahrscheinlich würden sie explodieren.
Nun kamen die Türme an die Reihe. „Wir haben den Seiler-, den Hexen-, den Pulver-, den Schwedter-, den Mittel- und den Blindower Torturm.“
„Da möchte man am liebsten türmen“, meinte der Seminarist aus St. Endal.
Das aber wagte keiner, und so trabten sie solange hinter ihrem sehr verehrten Mentor hinterher, bis der selbst am Ende seiner Kräfte war und nach einem Gasthof Ausschau hielt.
„Da ist einer!“ rief er, als er das Schild mit der schönen Aufschrift „Zur Kastanie“ entdeckte. „Inhaber: Christian Friedrich Scheng.“
„Das wird ein Chinese sein“, vermutete der Witzbold vom Dienst.
Ferdinand Schmidt stellte die Sache richtig. „Der Mann heißt Schering. Die Buchstaben r und i sind nur abgefallen. Schering also.“
Sie kehrten ein, das heißt, sie nahmen draußen im Garten Platz und hatten bald herausgefunden, dass Scherings Küche vorzüglich war und auch sein Bernauer Bier nichts zu wünschen übrig ließ. Nur der Mentor war mit seinem Wein nicht so ganz zufrieden und murmelte, dass der wohl nicht vom Rheine käme, wie die Frau Wirtin ihm versichert hatte, sondern eher von der Oder, aus Grünberg vielleicht oder Tschicherzig.
„Soll ich dem Herrn etwas Zucker zum Nachsüßen bringen?“, fragte ein Junge, dessen Alter so zwischen zehn und fünfzehn liegen mochte und der sie schon die ganze Zeit über vom Nachbartisch aus beobachtet und belauscht hatte.
„Du bist ja ein richtiger Spaßvogel“, merkte der Mentor an und wurde dann amtlich. „Wie kommst du denn hierher? Wissen deine Eltern, dass du dich im Wirtshaus herumtreibst?“
„Ja. Ich bin jeden Tag hier“, entgegnete der Knabe so lakonisch, wie es nur ein echter Märker konnte.
„Dann werde ich einmal mit deinen Eltern sprechen“, fuhr der Mentor fort. „Wo kann ich die denn finden?“
„Na, auch hier.“
Als seine Zöglinge das schon längst begriffen hatten, merkte auch er, wen er vor sich hatte: den Filius des Wirts. „Das entschuldigt alles. Und wie heißt du?“
„Ernst Christian Friedrich, aber alle sagen nur Ernst zu mir.“
„Und, Ernst, bist du gut in der Schule?“
Der Junge überlegte. „Ja, aber ich will gar nicht gut sein.“
„Warum denn das?“
„Weil ich dann etwas studieren muss ...“
Weiter konnte sich der Mentor des Jungen nicht annehmen, denn nun kam das Essen – und das hatte absoluten Vorrang. Ernst Schering wurde zudem ins Haus gerufen, um die Herrschaften aus Neuzelle nicht weiter zu behelligen. Nach dem Essen aber ließ ihn der Mentor noch einmal rufen, um seinen Seminaristen weiter vorzuführen, wie man mit einfach gestrickten Jungen wie diesem Gastwirtssohn umzugehen hatte. Er hielt ihm einen Strauß mit Wildkräutern hin, die er vorhin bei einer kleinen Rast für sein Herbarium gesammelt hatte.
„Nun, Ernst, bist du eigentlich ein Kind der Natur?“
„Ja.“
Nun reimte der Mentor sogar. „Dann sag mir doch geschwind, was das hier all für Kräuter sind?“
Mit stoischer Ruhe tippte Ernst auf die einzelnen Pflanzen und benannte sie ohne zu zögern. „Scharfer Hahnenfuß … Wiesen-Bocksbart … Vogel-Wicke … Gemeine Schafgarbe … Acker-Vergissmeinnicht …“
„Das ist nicht zu fassen!“, rief der Mentor.
Ernst Schering war aber noch nicht am Ende und zeigte auf einen gelben Korbblütler. „Das hier ist der Kleinköpfige Pippau ...“
Da brach ein unbeschreiblicher Jubel bei den Seminaristen aus, denn ihr Mentor, der so stolz war auf seinen großen Kopf und das viele Hirn darin, hörte auf den Namen Pippau, Peter Christian Pippau.
Aber nicht nur wegen dieses lustigen Vorfalls sollte sich die Landpartie nach Prenzlau bei Ferdinand Schmidt für immer einprägen, sondern auch wegen einer Szene, die sie auf dem Rückweg zu ihrem Pferdefuhrwerk vor der Holtz´schen Apotheke erlebten. Dort hatte es, wie man ihnen erzählte, in einem Anbau eine Explosion und anschließend einen Brand gegeben. Gerade trug man einen jungen Mann auf einer aus den Angeln gehobenen Tür auf die Straße hinaus und wartete auf ein Pferdefuhrwerk, das ihn ins Krankenhaus bringen sollte.
„Das ist einer meiner Gehilfen, der Friedrich Krumbeck“, diktierte der Apotheker einem Korrespondenten in die Feder. „Der wollte sich ein wenig Geld damit dazuverdienen, dass er Knallerbsen herstellte. Und dazu benötigt man Knallquecksilber. Gibt man nun im Umgang mit diesem nicht genügend Obacht, so wird man langsam vergiftet. Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel stellen sich ein. Von dem muss Krumbeck erfasst worden sein, und da ist er wohl in eine offene Flamme gestürzt.“
„Das ist doch ein Alchemist gewesen!“, rief einer der Nachbarn. „Der hat aus Quecksilber Gold machen wollen.“
Ferdinand Schmidt trat an der Seite des Mentors in den Hof der Apotheke, wo alles lagerte, was man aus dem brennenden Anbau noch hatte retten könnten. Darunter befand sich auch ein Haufen mit Chemikalien der verschiedensten Art, unter anderem ein Tütchen mit der Aufschrift Pottasche.
Der Mentor hob es auf und ließ das weiße Pulver zu Boden rieseln. „Den Mann möchte ich sehen, der aus dieser Asche Gold machen kann!“
Schmidt lachte. „Warten wir´s ab.“
Vor ihrer Rückreise kaufen sie sich noch ein paar Rosinenbrötchen in der Bäckerei Nickholz, die am Anfang der Klosterstraße gelegen war. Komischer Name, dachte Ferdinand Schmidt, und schrieb ihn in ein Büchlein. Er sammelte seltene Namen wie andere Schmetterlinge. Vielleicht würde er einmal einen Roman schreiben, und da brauchte man sicherlich viele einprägsame Namen.