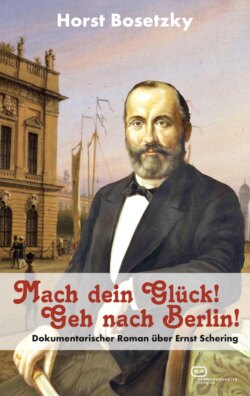Читать книгу Mach dein Glück! Geh nach Berlin! - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 8
Im Namen des armen Lazarus
Оглавление1839
In Preußen gab es mit Beginn der Industrialisierung soviel Massenarmut, Pauperismus, wie man damals sagte, dass eine eigene Armutsverwaltung geschaffen werden musste. Tausende Menschen waren nicht mehr in der Lage, für das eigene Auskommen zu sorgen, obwohl sie von frühmorgens bis spätabends schufteten und dabei ihre Gesundheit ruinierten. Im Adel und dem gebildeten Bürgertum fanden sich nur wenige, die sich um die Armen kümmerten. Die einen taten es, weil sie wahre Christen sein wollten, die anderen, weil sie gesellschaftliche Auflösungserscheinungen fürchteten, von der sittlichen Verwahrlosung bis hin zu Unruhen und Revolutionen. Herausragende Persönlichkeiten in diesem Kreise waren Bettina von Arnim, die sich 1831 bei der Choleraepidemie in Berlin für soziale Hilfsmaßnahmen in den Armenvierteln eingesetzt und Kranke gepflegt hatte, sowie schon einige Zeit vor ihr Johannes Rau, geboren 1673 in Perleberg, gestorben 1733 in Berlin, Diakon, Pfarrer und Probst in St. Nicolai, der seit 1699 Armenschulen in allen Quartieren der Residenz gegründet hatte, sowie Stanislaus Rücker. Der war aus Schlesien nach Berlin gekommen, hatte es hier zum preußischen Akzisedirektor gebracht und sich den Ruf eines Wohltäters der Armen erworben. 1733 hatte er das Grundstück Krausenstraße 30, Ecke Lindenstraße mitsamt des Irren- und Krankenhauses „Lazarus“ gekauft und dort nach dem Ausbau die lutherische Armenschule „Zum armen Lazarus“ gegründet.
Hier nun unterrichtete seit einiger Zeit auch Ferdinand Schmidt, den es nicht länger in Neuzelle gehalten hatte. Wer in Preußen etwas werden wollte, der kam nicht umhin, nach Berlin zu gehen.
Da saßen sie nun vor ihm, an die vierzig arme Würstchen, und wenn er in ihre Gesichter sah, schwankte er jeden Tag zwischen Lachen und Weinen, zwischen Hoffen und Verzweifeln. Er hatte seine Kinder, Jungen wie Mädchen, in vier Gruppen eingeteilt. Lieb und drollig waren die der ersten Gruppe, durstig nach Wissen und erfüllt vom Willen, dem Elend zu entrinnen, indem sie tüchtig lernten. Dumpf und ablehnend erlebte er die Schüler der zweiten Gruppe. Sie sahen keine Chance in ihrem Leben, ob sie nun ein wenig lesen oder rechnen konnten. Die Kinder, die zur dritten Gruppe gehörten, waren unrettbar krank, litten an Tuberkulose oder Leukämie, hatten sich schon aufgegeben, und ihr Anblick schmerzte ihn so sehr, dass ihm oft die Tränen kamen. Die vierte Gruppe hingegen ließ Aggressionen in ihm aufschießen, denn er wusste, dass sie es waren, die ihn gefährdeten, hatten sie das nötige Alter erreicht: Das waren die Jungen, die einmal Verbrecher werden würden – und auch wollten. Um die hatte er sich ganz besonders zu kümmern.
Ferdinand Schmidt betrat den Klassenraum der Jungen, und brav schnellten alle hoch. Das wenigstens hatten sie schon gelernt. Klar, man war ja in Preußen.
„Guten Morgen, Herr Schmidt!“, schallte es ihm entgegen.
„Guten Morgen! Setzen!“
Er warf das Klassenbuch und seine Unterrichtsmaterialien auf den Tisch und rief einen nach dem anderen auf. Hier! Hier! Fehlt! Fehlt! Hier! Jeden Morgen dieselbe Prozedur. Wie sagte sein Kollege Strzelczyn immer: „Lehrer werden ist nicht schwer, Lehrer sein dagegen sehr.“ Ja, hier war verloren, der nicht als der geborene Missionar auf die Welt gekommen war.
„Was machen wir heute, Herr Schmidt?“
„Wir kommen heute zum Buchstaben K.“
„K wie Kacke!“, kam es aus den hinteren Reihen.
Ferdinand Schmidt nahm es gelassen. Er stand auf und schrieb den Buchstaben an die Tafel, in seiner großen wie in seiner kleinen Version, dann zog er ein Bonbon aus der Tasche. „Das bekommt der, der einen Satz schreiben kann, in dem die meisten K´s vorkommen. Los, holt eure Tafeln heraus und fangt an.“
Es siegte Heinrich Reinsch mit dem Satz: Konrad Krause kann kleine Küken klauen.
Dass ausgerechnet der das Bonbon gewann, ärgerte die letzte Reihe, und sofort kam von dort der Ruf: „Ist hier jemand, der Reinsch heißt?“, aber so betont, dass es wie „rein scheißt?“ klang.
„Ruhe auf den billigen Plätzen!“, rief Ferdinand Schmidt. Wenn er den Rufer in die Ecke stellte oder vor die Klasse schickte, verhärtete sich dessen Wesen nur, das wusste er. Also ließ er es und lachte mit den anderen mit. Der Heinrich Reinsch war hart genug, der konnte das vertragen. Wer Kackstein oder Hundgeburth hieß, hatte es schwerer.
Als die Stunde langsam zu Ende ging, hatte Ferdinand Schmidt eine Idee. „Morgen bringt jeder mal das Buch von zu Hause mit, das seine Eltern am liebsten lesen.“
Nun lachte alles schallend, und aus der letzten Reihe kam die Frage: „Een Buch, wat issen ditte?“ Es stellte sich alsbald heraus, dass die Eltern seiner Kinder, wenn überhaupt, nur ein Buch besaßen: die Bibel.
Kaum im Lehrerzimmer angekommen, wandte sich Ferdinand Schmidt an Albrecht Strzelczyn. „Du, wir müssen unbedingt etwas unternehmen!“
„Ja, am Sonntag einen Ausflug nach Sanssouci.“
„Unsinn! Etwas, damit die Kinder Bücher in die Hand bekommen. Wer nicht liest, bleibt dumm, und darum müssen wir sie zum Lesen bringen. Und da sich die Eltern keine Bücher leisten können, brauchen wir eine Volksbücherei!“
„Bücher? Woher nehmen? Am besten du schreibst selber welche“, brummte Strzelczyn.
„Das auch, aber das braucht seine Zeit. Bis dahin müssen wir durch die Stadt ziehen und Bücher sammeln.“
„Wir? Du!“
So machte sich Ferdinand Schmidt daran, das zu tun, was man in späteren Zeiten Klinken putzen nennen sollte, veröffentlichte in der Berliner Zeitschrift „Die Biene“ einen Aufruf mit der Bitte um Bücherspenden, und in kurzer Zeit kamen tatsächlich 218 Bände zusammen. Seine Kinder konnten nun Bücher anfassen, aufschlagen und den Versuch machen, sie auch zu lesen.
Aber seine Aktivitäten brachten Ferdinand Schmidt nicht nur Freunde ein, es gab auch Männer, die sein Treiben nicht so gerne sahen, so der Freiherr Albert von Seld und der Stadtschulrath Otto Schulz.
Der Freiherr hatte mit seiner Arbeit über Die Unterrichtsmethode in den preußischen Schulen und verschiedenen juristischen Abhandlungen die besondere Anerkennung des Königs und seines Staatsministers v. Kamptz erworben und war zur Aufsicht über einige Armenschulen bestimmt worden. Dabei war ihm einiges aufgefallen, und er hatte Ferdinand Schmidt zu sich rufen lassen.
„Mir ist zu Ohren gekommen, mein Lieber, dass sie doch sehr arg mit der Disziplin in ihren Klassen zu kämpfen haben und einiges durchgehen lassen, was an sich den Rohrstock verdient hätte.“
Ferdinand Schmidt wusste, dass ihm jetzt nichts anderes blieb als zu buckeln, wollte er seine Stelle behalten und sie keinem überlassen müssen, der niemals einen Zugang zu den Schülern aus den Elendsvierteln finden würde. So gab er sich unterwürfig.
„Sehr wohl, Herr von Seld!“ Es war sehr militärisch, wie er das hervorstieß. „Ich werde mich in Zukunft so verhalten, wie Sie es von mir verlangen.“
Das besänftigte von Seld ein wenig, aber dennoch schnauzte er Schmidt weiterhin an. „Und noch etwas: Sie sollen des öfteren in ganz bestimmten Lokalitäten gesehen worden sein, wo man dem Laster des Branntweintrinkes verfallen ist.“
„Aber nein, um Gottes Willen!“, rief Ferdinand Schmidt, der wusste, dass der Freiherr den Kampf gegen die Trinksucht mit dem Eifer eines Kreuzzüglers verfolgte und schon mehrere Enthaltsamskeitsvereine gegründet hatte. „Ich gehe nur hin und wieder durch die Etablissements, um zu sehen, ob sich welche von meinen älteren Schülern dort herumtreiben und um sie, erwische ich sie, auf den Pfad der Tugend zurückzuführen.“
„Brav, sehr brav, mein Lieber. Und dann noch etwas: Fangen Sie nicht an, ein Dichter werden zu wollen, das lenkt nur von Ihrer Arbeit in der Armenschule ab. Und außerdem: Mit dem aus Werneuchen haben wir schon einen verspotteten Dichter mit Namen Schmidt in Preußen – ein zweiter tut nicht Not.“ Und er erinnerte darin, wie Goethe über den armen Friedrich Wilhelm August Schmidt, genannt Schmidt von Werneuchen, parodistisch hergezogen war. „Liebes Mädchen, laß uns waten / Waten noch durch diesen Quark.“
Diesmal wagte Ferdinand Schmidt sich zu verteidigen. „Ich dichte nicht, Herr von Seld, ich arbeite an einer Preußischen Vaterlandskunde für Schule und Haus.“
„Na, dann ist es ja gut.“
Nach Seld nun der Herr Stadtschulrath. Otto Schulz erinnerte ihn an den „beschränkten Unterthanenverstand“ seiner Schüler und warnte ihn davor, sie mit seinem wirklich oder auch nur eingebildeten Wissen unnötig voll zu schütten und zu überfordern.
Da Schulz über keine große Machtfülle verfügte, konnte es Ferdinand Schmidt in diesem Falle bei der Floskel belassen, sich „alle Mühe geben zu wollen, dass in seinem Klassenzimmer von ihm fürderhin eine leichtere Kost verabreicht werde.“
Wie auch immer, als am 2. Oktober die dritte „Communal-Armenschule“ in der Großen Frankfurter Straße eröffnet wurde, gehörte Ferdinand Schmidt zu den geladenen Gästen.