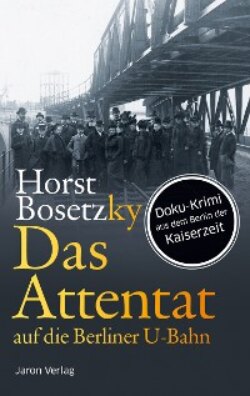Читать книгу Das Attentat auf die Berliner U-Bahn - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 10
Fünf 1881
ОглавлениеHermann Mahlgast trug den Anzug, den ihm seine Eltern im letzten Jahr zur Einsegnung geschenkt hatten, und war von seiner Tante so hergerichtet worden, dass er älter als fünfzehn aussah. Liesbeth Cammer saß für ihr Leben gern in einem Café, doch Damen war es generell verboten, ohne Männerbegleitung ein solches zu betreten. Um diese Vorschrift zu umgehen, hatte sich ein besonderer Berufsstand herausgebildet: der des Damenbegleiters, auch »Bärenführer« genannt. Der bezahlte Begleiter erhielt fünfzig Pfennige und einen Kaffee. Dieses Honorar wollte sich Liesbeth Cammer ersparen, indem sie sich, wann immer es ging, ihren Neffen ausborgte.
Für Hermann Mahlgast waren diese Ausflüge einerseits immer eine fürchterliche Pein, andererseits jedoch genoss er durchaus den erotischen Kitzel, sich an der Seite einer schönen Frau zu bewegen und für deren Gigolo gehalten zu werden. Natürlich verbot er sich, an das zu denken, was ein Gigolo seiner Dame ganz speziell zu bieten hatte, doch je strenger er mit sich verfuhr, desto weniger ließen sich seine Regungen unterdrücken. Besonders heftig errötete er, wenn seine Tante sagte, er sehe ihrem verschwundenen Mann Germanus Cammer immer ähnlicher.
So geschah es auch im Café Bauer. »Ganz der Germanus, wie ich ihn als jungen Mann kennengelernt habe.«
Hermann Mahlgast versuchte, sich hinter der riesigen Getränkekarte zu verstecken. »Drei Jahre ist es nun schon her, dass er …«
»Er wird nach Amerika gegangen sein und dort sein Glück versucht haben.« Für Liesbeth Cammer war diese Annahme das beste Mittel, um über ihre Depressionen hinwegzukommen.
Hermann Mahlgast suchte nach Gesprächsthemen, die unverfänglicher waren. »Hast du von dem hungrigen Mann gelesen, der einem Ziehhund das Futter aus dem Napf gestohlen und aufgegessen hat?«
»Ja. Es ist schon ein Elend. Ich schreibe gerade an einem Artikel über Mütter, die Anzeigen aufgeben, um ihre Kinder zu verkaufen. Gestern habe ich mit einer Witwe gesprochen, die gleich vier ihrer sieben Kinder abgeben wollte – die Wohnung war viel zu klein für alle.« Sie musterte ihren Neffen. »Liest du eigentlich auch Heidi?«
»Nein, das ist doch nur was für Mädchen.«
»Schade. Gerade hat Johanna Spyri ihren neuen Roman veröffentlicht: Heidis Lehr- und Wanderjahre. Wie willst du denn deine Lehr- und Wanderjahre verbringen?«
»Ach …« Hermann Mahlgast senkte den Kopf.
Seine Tante lachte. »Ich weiß schon: in die Fußstapfen meines Germanus treten und bei Siemens Hochbahnen bauen.«
»Erst muss ich ja mal zum Militär und dann studieren.«
»Wie kommst du denn mit der Schule zurecht?«
»Danke, gut.« Das war leicht untertrieben, denn Hermann Mahlgast galt in seinem Gymnasium geradezu als Musterschüler. Er wusste, dass er sich alles erarbeiten musste, und so bereitete er sich auf jede Unterrichtsstunde gewissenhaft vor, ließ keine Hausaufgabe unerledigt, lernte alle Vokabeln, übte sogar in der Obertertia noch Schönschrift. Sein Verhalten gab nie Anlass zu Klagen. Den Lehrern gegenüber legte er den Gehorsam an den Tag, den sie erwarteten, ohne sich aber dabei demütig zu geben oder ihnen zu schmeicheln, und seinen Mitschülern gegenüber war er ein guter Kamerad, beliebt vor allem dadurch, dass er den Schwächeren nach Kräften half. So kam er nie in den Ruf, ein Streber zu sein. Sich mit ihm anzulegen wagte ohnehin niemand aus seiner Klasse, denn er war stämmig gebaut und konnte so gut turnen, ringen und boxen wie kein Zweiter. Demnächst wollte er in einen Ruderverein eintreten.
»Was liest du denn gerade?«, wollte seine Tante als Nächstes wissen.
Hermann Mahlgast druckste ein bisschen herum. »Am liebsten etwas über Technik.«
Liesbeth Cammer war darüber nicht sonderlich begeistert und hielt ihm einen längeren Vortrag über Dichter der neueren Zeit, die er unbedingt lesen müsse. »Ferdinand Freiligrath – diese wunderbare Naturmalerei …«
Nach unendlich langen Minuten des literarischen Exkurses hörte Hermann Mahlgast schon gar nicht mehr zu. Literatur langweilte ihn, einzig Naturwissenschaften und Technik zählten für ihn. Nach einer guten Stunde war das gemeinsame Kaffeetrinken beendet, und seine Tante entließ ihn wieder. Er konnte nach Hause laufen, während sich Liesbeth Cammer in den Geschäften nach neuer Garderobe umsehen wollte.
In der Belle-Alliance-Straße ging er ganz langsam die Treppe hinauf. Wenn er Glück hatte, kam ihm Emilie entgegen. Sie war so alt wie er, und schon seit Wochen saß er in seiner Kammer und versuchte, ihr einen Liebesbrief zu schreiben. Aber nie war er mit einem Entwurf zufrieden, immer wieder zerriss er das Briefpapier, das aus den Vorräten seiner Mutter stammte. Noch weniger wollte ihm ein Gedicht gelingen. Er war eben kein Poet. Auch ein Aquarell, das er für sie gemalt hatte, eine romantische Felsschlucht, wagte er nicht, in ihren Briefschlitz zu stecken. Zum einen erschien es ihm nicht vollkommen genug, zum anderen war zu befürchten, dass es ihre Mutter fand. Was er aber wirklich gut zeichnen konnte, waren Lokomotiven und Brücken, die er nach real existierenden Vorbildern zu Papier brachte, und Hochbahnzüge, diese aber weithin als Phantasieprodukte. Aber das war doch nichts, womit er einem jungen Mädchen imponieren konnte.
Er hatte Pech und bekam Emilie nicht zu Gesicht. Seine Mutter war nicht zu Hause, und Minna hatte in der Küche zu tun. So konnte er sich auf sein Bett werfen und sich seinen Träumen hingeben. Seine Tante und Emilie verschmolzen zu einer Person. Minna wunderte sich zwar, warum in letzter Zeit so viele Taschentücher verschwanden, aber anders ließ sich das Problem nicht lösen. Um sie milder zu stimmen, machte er sich anschließend daran, einen Flaschenzug zu konstruieren, der es ihr ersparen sollte, den schweren Einkaufskorb nach oben zu schleppen, hoch in die dritte Etage. Er war sehr stolz auf sein Patent. Eine zwei Meter lange Dachlatte war so am Balkongitter befestigt, dass man sie im Ruhezustand und von der Straße aus kaum erkennen konnte. Sollte sie eingesetzt werden, konnte man sie ausfahren. Vorn hingen die beiden Rollen, über die eine zehn Meter lange Wäscheleine verlief. Unten war ein Fleischerhaken befestigt. Hermann rief das Dienstmädchen und erklärte ihm die Vorrichtung.
»Ich warte oben auf dem Balkon, bis du vom Einkaufen zurückkommst. Wenn du unten stehst, brauchst du deinen schweren Einkaufskorb nur einzuhaken – und ich ziehe alles nach oben.«
»Junge, du bist der geborene Ingenieur!«
Hermann Mahlgast freute sich sehr über diese Aussage, und am liebsten hätte er den elektrischen Aufzug, den Werner Siemens für die Gewerbeausstellung in Mannheim konstruiert hatte, auf der Rückseite ihres Mietshauses nachgebaut.
Minna, die auf die vierzig zuging, hatte es im Kreuz und ließ sich von seiner Mutter ständig mit Franzbranntwein einreiben. So war sie froh und glücklich über Hermanns Erfindung und stürzte schon los, um beim Kolonialwarenhändler einiges einzukaufen und alles auszuprobieren. »Ich kann es gar nicht erwarten.«
Lange stand Hermann Mahlgast dann auf dem Balkon, um Minna nicht zu verpassen. Insgeheim hoffte er auch, sein Vater würde früher nach Hause kommen und so Zeuge seiner Vorführung werden. Mit ihm kam er blendend zurecht, denn er ließ ihm in allem freie Hand, solange sein Handeln und Unterlassen nicht gegen die geltenden Normen verstieß. Sie waren beide ähnliche Charaktere, gutmütig und behäbig, und da Gustav Mahlgast mit sich und der Welt zufrieden war, gab es keinen Grund für ihn, an seinem Sohn herumzumäkeln.
Ganz anders die Mutter. Mit der lag er andauernd verquer, denn sie hatte sich ihren Sohn ganz anders vorgestellt: temperamentvoller, nicht so märkisch, sondern eher südländisch, nicht bieder, sondern elegant, nicht wortkarg, sondern sprühend vor Witz, kein Klotz, wenn getanzt wurde, sondern in den Bewegungen federleicht wie ein Solotänzer des Staatsballetts. Auch seinem Wunsch, Ingenieur zu werden, konnte sie nichts abgewinnen, sie hätte ihn viel lieber im diplomatischen Dienst gesehen. »Mein Sohn ist gerade Vortragender Legationsrat geworden und für den Botschafterposten in London im Gespräch. Gestern war er zur Gratulationscour Seiner Majestät im Weißen Saal des Stadtschlosses.« Dass er ihr dieses Glück nicht gönnen wollte, nahm sie ihm übel.
Endlich kam Minna vom Einkauf zurück, stellte ihren Korb auf den Bürgersteig und sah zu Hermann herauf.
»Wat is nu?«
»Sofort!«
Schnell fuhr er seinen Galgen mit den Rollen aus und ließ das Seil herab. Der Haken schlug punktgenau vor Minnas Beinen auf das Pflaster, und sie hatte keine Mühe, den Henkel ihres bis an den Rand gefüllten Weidenkorbs an ihm zu befestigen.
Sie hob die rechte Hand. »Et kann losjehn! Hau ruck!«
Hermann Mahlgast begann, an seinem Ende des Seils zu ziehen, und hatte wenig Mühe, den Korb nach oben schweben zu lassen. Etliche Passanten stoppten ab, blieben stehen und klatschten Beifall. Das gefiel ihm, ohne dass er so eitel gewesen wäre, sich zu verbeugen.
Schon war der Korb zum Greifen nahe, und er beugte sich vor, um ihn zwischen zwei Blumenkästen hindurch auf den Balkon zu ziehen – da geschah das Malheur. Der Haken, den er in die Dachlatte gedreht hatte, wurde durch das immense Gewicht aus dem Holz gerissen. Der Korb gehorchte den Gesetzen der Schwerkraft und raste wie ein Meteor unaufhaltsam auf das Dienstmädchen zu. Die konnte gerade noch zur Seite springen, als er neben ihr aufs Pflaster schlug, ja geradezu explodierte. Schreie hallten durch die Belle-Alliance-Straße.
Alles hätte noch unter den Teppich gekehrt werden können, wenn nicht gerade in diesem Augenblick eine Droschke vor dem Wohnhaus gehalten und in dieser Droschke seine Mutter gesessen hätte. Der war das Ganze furchtbar peinlich, denn sie fürchtete nichts mehr, als zum Gespött der anderen zu werden.
»Eine Woche Stubenarrest!«, rief sie, als sie den Tatbestand eruiert hatte.
»Bitte, nein, Mutter, ich bin mit Ludolf verabredet – wir wollen nach Lichterfelde raus, die erste Straßenbahn der Welt sehen.«
»Zwei Wochen Stubenarrest!«
Ludolf Tschello wusste sehr wohl, dass er ohne das Zeugnis der Reife keinen Zugang zur Universität erhielt, aber er hatte sich geschworen, zum Erreichen dieses Ziels nicht mehr zu tun, als unbedingt nötig war. Non scolae, sed vitae discimus. So ein Unsinn. Wozu musste er, der Ingenieur werden wollte, wissen, wie das zu übersetzen war. Natürlich lernte er nicht für das Leben, sondern für die Schule. Hausarbeiten vergaß er grundsätzlich. Schludrig war er zudem, nie waren seine Schulbücher sauber eingeschlagen, nie schrieb er einen Text ohne diverse Tintenkleckse. Dass er dennoch nie sitzenblieb, lag daran, dass ihm alles zuflog. Und was ihm nicht zuflog, das hasste er. Die Lehrer verhöhnte er als furchtbar medioker, und dennoch schafften sie es nicht, ihn scheitern zu lassen, denn der Rektor seines Gymnasiums hielt ihn für ein Genie. Das mochte auch daran liegen, dass dieser der Musik leidenschaftlich verbunden war, das Geigenspiel über alles schätzte und Ernst Moritz Tschello, den Vater Ludolfs, seinen Freund nannte und immer wieder zu privaten Empfängen einlud.
Ludolf Tschello war schlank und dunkelhaarig und ließ alle Frauen, saß er am Klavier und spielte Chopin, dahinschmelzen. Zwar war er kein so begnadeter Virtuose wie sein Vater, aber bei sachgemäßer Ausbildung am Konservatorium hätte er es in die berühmtesten Orchester bringen können, doch er wollte nichts anderes werden als Ingenieur. Musik verklingt, hatte er einmal in einem Aufsatz geschrieben, aber die Pyramiden stehen ewig.
Seine Eltern sah er wenig. Der Vater hatte andauernd Proben und Konzerte, die Mutter war damit beschäftigt, Gutes zu tun, und kümmerte sich lieber um Trinker, liederliche Dirnen und kinderreiche Frauen, denen der Mann davongelaufen war. So musste Ludolf sich selber erziehen, was ihm durchaus recht war.
Langeweile hatte er nie. Entweder stromerte er durch die Stadt und heftete sich an die Fersen schöner Frauen und Mädchen, oder er saß zu Hause in seinem Zimmer, spielte Klavier oder entwarf kühne technische Bauwerke, so etwa riesige Türme aus Stahlträgern oder eine hängende elektrische Bahn, deren Rollen auf dicken Stahlseilen liefen, die hoch über der Spree aufgehängt waren. Von Charlottenburg bis Oberschöneweide sollte sie gehen.
Am 16. Mai 1881 fuhr in Lichterfelde, das damals noch nicht zu Berlin gehörte, die erste öffentlich betriebene elektrische Straßenbahn im Linienverkehr. Die Strecke zwischen dem Bahnhof an der Anhalter Bahn und der Hauptkadettenanstalt an der Finckensteinallee hatte eine Länge von etwa 2,5 Kilometern. Die Spurweite betrug einen Meter, und der Strom wurde den Motoren über die beiden Fahrschienen zugeführt. 180 Volt Spannung waren es. Der behördlichen Anordnung gemäß sollte die durchschnittliche Geschwindigkeit fünfzehn Stundenkilometer betragen und durfte an keiner Stelle zwanzig Kilometer pro Stunde übersteigen. Zwanzig Personen fasste der Wagen.
»Vata, wo is ’n det Pferd?«, fragte ein Junge, der staunend stehen geblieben war.
»Das befindet sich sozusagen unter dem Wagenkasten.«
»Isset überfahrn worn?«
»Nein, das nennt man jetzt Motor. So ein Elektromotor ist viel stärker als ein richtiges Pferd.«
Der Wagenführer, der zugleich auch Schaffner war, achtete darauf, dass die Säbel und Degen der Offiziere ausgehakt waren, weil man ansonsten damit rechnen musste, dass die Garderoben der Damen Schaden nahmen. Sollte es losgehen, rüttelte er am Seil einer Glocke, die am Führerstand auf der offenen Plattform über ihm hing. Nachdem er gebimmelt hatte, drehte er an der Kurbel des Fahrschalters, und die Bahn setzte sich langsam in Bewegung.
Noch einmal wurde kräftig gebimmelt, denn wieder einmal spielten Kinder mitten auf den Schienen. Auch manch Erwachsener unterschätzte die Geschwindigkeit des Gefährts.
Ein gerade vorüberzuckelnder Droschkenkutscher schüttelte den Kopf. »Bevor das gefährliche Ding sich breitmacht, muss der alte Zentralfriedhof wieder in Betrieb genommen werden – wegen der Verkehrsopfer.«
Ein wenig abseits unter einer alten Eiche stand Werner Siemens und verfolgte das Treiben um seine Straßenbahn mit gemischten Gefühlen.
Erich Abendroth, der ihn auch an diesem Tage nach Lichterfelde begleitet hatte, sah ihn prüfend an. »Es scheint mir, als könnten Sie sich über den Erfolg Ihrer Straßenbahn gar nicht so recht freuen.«
»Wie denn auch?«, fragte Werner Siemens. »Zwar wird man nun nicht mehr anzweifeln können, dass sich der elektrische Bahnbetrieb bestens für die Praxis eignet, aber dies hier ist nicht mein Traum, das ist doch nur eine von ihren Säulen und Längsträgern auf den Erdboden verlegte Hochbahn – und die ist das Eigentliche, um das es mir geht.« Und mit der Schuhspitze zeichnete er in den Sand, wie er sich die Sache vorstellte.
Diese Zeichnung versetze Hermann Mahlgast und Ludolf Tschello anfangs in helles Entzücken, als sie, kaum dass Siemens und sein Ingenieur weitergegangen waren, den Platz unter der Eiche besetzten.
»Das ist ja alles nur eingleisig«, sagte Ludolf Tschello, von der simplen Konstruktion doch ein wenig enttäuscht.
»Zwei Längsträger mit ihren Säulen nebeneinander wären zu teuer«, meinte Hermann Mahlgast. »Man kann ja auch Ausweichen bauen.«
Ludolf Tschello blieb weiter sehr kritisch. »Und nur ein einziger Wagen oben auf den Schienen, da passen doch viel zu wenige Menschen rein. Wenn ich da an die Stadtbahnzüge denke, wie lang die sind.«
»So ein kleiner Elektromotor hat nun mal nicht so viel Kraft wie eine große Dampfmaschine auf Rädern«, belehrte ihn der Freund.
»Dann muss man stärkere Elektromotoren bauen«, forderte Ludolf Tschello.
Hermann Mahlgast lachte. »Dann sag das doch mal dem Herrn Siemens, da steht er ja noch.«
Das traute sich Ludolf Tschello dann doch nicht, aber vielleicht hätte er es getan, wenn sich in diesem Augenblick nicht ein Stückchen weiter ein Riesengeschrei erhoben hätte. Was war geschehen? Ein Droschkengaul hatte mit einem seiner vorderen und einem seiner hinteren Beine die verschieden gepolten Straßenbahnschienen so unglücklich berührt, dass der Strom durch seinen Körper floss. Da war er dann durchgegangen, und der Droschkenkutscher hatte das Tier erst hundert Meter weiter wieder bändigen können. Aber nicht er tobte, sondern sein Fahrgast.
»Das ist ja eine Unverschämtheit, die Straßen hier unter Strom zu setzen!«, rief er und wäre Werner Siemens gegenüber fast handgreiflich geworden. »Ich hätte mir durch Ihre Schuld fast das Genick gebrochen.«
Erich Abendroth legte dem Mann die Hand auf die Schulter. Man kannte sich von vielen Scharmützeln her. »Nun beruhigen Sie sich doch mal, Herr Grasmuck. Es war doch eine sehr schöne Vorführung.« Er war sich sicher, dass Georg Grasmuck den Vorfall inszeniert hatte, um einen weiteren Trumpf im Kampf gegen die elektrischen Bahnen in der Hand zu haben.
Hermann Mahlgast und Ludolf Tschello fanden das Ganze viel spannender als einen Abenteuerroman. Sie hörten auch, wie Werner Siemens sagte, bei seiner Pfeilerbahn wäre das nicht passiert.
»Doch – bei Pegasus!«, rief Ludolf Tschello.
Erich Abendroth lachte und fragte die beiden Obertertianer, ob sie sich denn für elektrische Bahnen interessieren würden.
Aber ja, diese seien ihr großer Traum. »Deswegen sind wir ja auch nach Lichterfelde rausgekommen, und wir …«
Grasmuck unterbrach sie. »Ich werde heute noch Anzeige bei der Polizei erstatten, Herr Siemens. Stellen Sie sich mal vor, Kinder erleiden einen Stromschlag und werden getötet.«
»Ein Kind macht doch nicht so lange Schritte.«
»Aber zwei Kinder können sich an der Hand halten.«
»Und beide sind zufällig barfuß …« Abendroth verzog das Gesicht.
»Weg mit der Elektrizität von unseren Straßen!«, rief Grasmuck.
Werner Siemens nickte. »An sich haben Sie ja recht, aber solange man mich keine Pfeilerbahn bauen lässt …« Er sah zu den Bäumen hinauf. »Es sei denn, man hängt zwei Fahrdrähte oben auf und lässt das mit den Schienen.«
»Sie meinen, wir bauen einen Elektromotor in eine Kutsche ein?«, fragte Abendroth.
Siemens nickte. Die Idee zu dem, was man später Oberleitungs- oder kurz Obus nennen sollte, hatte er schon lange.
»Und wenn sich nun zwei Elektrowagen begegnen?«, fragte Hermann Mahlgast.
»Gut, der Junge!«, rief Abendroth. »Ja, was machen wir dann, wenn sich zwei Wagen begegnen?«
Hermann Mahlgast dachte nach. »Es muss vier Fahrdrähte geben, zwei für jede Richtung.«
»Nein.« Ludolf Tschello hatte eine bessere Lösung. »Bei nur zwei Drähten fährt ein Wagen zur Seite und kappt seine Kontakte vorübergehend, damit der andere vorbei kann.«
»Ihr seid ja großartige Fachleute«, lobte Werner Siemens sie. »Herr Abendroth, geben Sie bitte Order, dass die beiden jungen Herren so lange umsonst mit der Straßenbahn fahren können, wie sie wollen.«
In jedem Vierteljahr luden die Tschellos alle Freunde und Verwandte zu einem kleinen Konzert in ihre Wohnung ein. Auch Menschen, die klassische Musik eher als Folter denn als Genuss empfanden, beeilten sich, dieser Einladung Folge zu leisten, denn nur der eigene Tod wurde von Ernst Moritz und Auguste als Hinderungsgrund anerkannt, alles andere galt als Affront und führte zum Abbruch der Beziehungen.
Hermann Mahlgast litt zwar immer gewaltig, wenn Vater Tschello unerbittlich lange »das Wimmerholz bearbeitete«, so sein Ausdruck für das Geigenspiel, doch er folgte seinen Eltern ein jedes Mal ohne Murren, denn vor und nach dem Konzert war immer noch genügend Zeit, mit dem Freund zu spielen.
Noch immer waren Hermann Mahlgast und Ludolf Tschello unzertrennlich. Was sie wohl derart aneinanderbinden würde, fragten sich viele. Der Hauptgrund war vermutlich, dass sie sich zu einer Einheit ergänzten. Der eine stand für das Solide, Stabile und Verlässliche, der andere für das Leichte und Lockere. Der eine nahm das Leben als Pflichterfüllung, der andere als Spiel, und so kamen sie glänzend voran. Und noch wussten sie nicht, dass in ihrer Dyade ein Konflikt angelegt war, den man nur teuflisch nennen konnte.
An diesem Abend spielten sie Erfinder. Beide waren dabei, eine elektrische Bahn zu entwickeln, die der von Siemens & Halske um einiges überlegen war.
»Vor allem brauchen wir nur eine Schiene«, betonte Ludolf Tschello immer wieder. »Und nur zwei Räder für einen Waggon und nicht vier.«
»Und nur einen Oberleitungsdraht«, ergänzte Hermann Mahlgast.
Auf die Idee zu ihrer Einradbahn waren sie gekommen, als Ludolf einen großen Kreisel geschenkt bekommen hatte. Zog man den mit einer Schnur auf, lief er einige Minuten lang, ohne ins Trudeln zu geraten. Baute man einen mannshohen Kreisel aus Eisen und sorgte mit Hilfe eines Elektromotors dafür, dass er sich in der Minute Hunderte von Malen drehte, und stellte diesen Kreisel auf einen Wagen, der vorn und hinten genau in der Mitte des Kastens ein Rad hatte, dann, so dachten sie, war es völlig unmöglich, dass dieser Wagen umkippte. Die Schwungmasse hielt ihn in jedem Fall im Gleichgewicht. Die beiden Räder waren konkav, also nach innen gewölbt, und die Schiene konvex, also eine unten auf Stützen ruhende Röhre.
Ludolf Tschello war für die Zeichnungen und Berechnungen zuständig, Hermann Mahlgast hatte das Handwerkliche zu erledigen. Mit Hilfe zweier etwas verkürzter Garnrollen und Brettchen, die von den Zigarrenkisten seines Vaters stammten, hatte er einen Straßenbahnwagen gebaut. Mangels seitlicher Stützen – die waren erst noch zu konstruieren – kippte das Gefährt im Ruhezustand natürlich immer um, aber Hermann Mahlgast konnte das wenig verdrießen.
»Pass mal auf, wie der sich in der Horizontalen hält, wenn wir deinen Kreisel erst obendrauf montiert haben.«
»Hauptsache, du hast die Achse so gebohrt, dass er nicht eiert.« Ludolf Tschello wusste, was Siemens an seinem Halske hatte. Ohne erstklassigen Mechaniker funktionierte nichts.
Dann hatten sie Grund zum Jubeln, denn ihre Bahn legte, nachdem Hermann Mahlgast sie angeschoben hatte, tatsächlich gute 2,50 Meter auf dem Flur zurück, ehe sie umkippte.
»Lag das nun am Schwung, dass sie so weit gefahren ist, oder an der Wirkung des Kreisels?«, fragten sie sich, konnten aber nicht weiter experimentieren, da Ludolfs Mutter nun in die Hände klatschte und rief, das Konzert würde beginnen.
Man nahm Platz und setzte sich in die Pose »Kunstgenuss und Verzückung«. Ernst Moritz Tschello trat ein, verbeugte sich, nahm den Beifall geschmeichelt entgegen und begann, ebenso hingebungsvoll wie professionell die Serenata a un coro di violini von Johann Jakob Walther zu spielen.
Als genügend geklatscht worden war, setzte er zu einer kleinen Rede an: »Für die zweite Darbietung dieses Abends, liebe Freunde des Hauses, liebe Anverwandte, haben meine Frau Gemahlin und ich keine Kosten und Mühen gescheut, um bei den Göttern ein Wesen loszueisen, das ihr absoluter Liebling ist und das sie mit einer Stimme ausgestattet haben, wie sie seit Jenny Lind, der schwedischen Nachtigall, keiner Frau mehr geschenkt ward. Nun …«
Weiter kam er nicht, denn in diesem Moment stürmte eine überaus korpulente ältere Dame in den kleinen Konzertsaal, ein Dragoner, wie die Berliner sagten. Und sofort legte sie los.
»Warum werde ich denn nicht eingeladen, wenn hier ein Konzert stattfindet? Das ist ja eine Gemeinheit ersten Grades! Wenn ich nicht durch Zufall gerade vorbeigekommen wäre, dann … Ernst Moritz, hol mir gefälligst einen Sessel!«
Derjenige, der neu war bei den Tschellos, schwieg betreten, zumal der Hausherr nun devot herumwieselte wie ein Oberkellner in einem Grand Hotel, während die Kundigen nur bedeutungsvoll schmunzelten. Sie kannten die Dame, die da wieder einmal ihren großen Auftritt hatte: Es war Emilie Ludewig, geborene Tschello, die Erbtante aus Wassersuppe am Hohennauener See. Sie hatte einen Fabrikanten aus Rathenow geheiratet und war, als der vom Herrn heimgeholt wurde in die Ewigkeit, eine reiche Frau geworden. Da sie in ihrem Testament ihren Neffen Ernst Moritz und dessen Sohn Ludolf zu ihren Erben eingesetzt hatte, konnte sie sich bei ihren Besuchen in Berlin buchstäblich alles erlauben. Sie plumpste in den Sessel, den ihr der Neffe herangeschoben hatte.
Sie sah ihn an. »Und …?«
»Ja, Tante Emilie?«, fragte Ernst Moritz Tschello schmelzend wie ein Bariton.
»Guck nicht so wie ein Schoßhündchen.« Sie lachte schrill auf. »Hol mir was zu trinken! Aber was Vernünftiges. Dass ich in Wassersuppe geboren bin, heißt ja nicht, dass ich nur Wasser trinke.«
Schon war Ludolf Tschello mit einem Glas Sekt zur Stelle.
»Zum Wohl, liebe Tante Emilie.«
»Danke.« Sie leerte das Glas mit einem Zug und rülpste ungeniert.
Auguste Tschello zuckte zusammen, denn sie wusste, dass Tante Emilie unter dem litt, was die Ärzte schamhaft als Flatulenz bezeichneten. Hoffentlich hatte sie nicht wieder Erbsen gegessen wie bei ihrem letzten Besuch.
»Dürfen wir fortfahren?«, fragte Ernst Moritz Tschello.
»Wohin denn?« Sie lachte schallend über ihren nicht eben originellen Scherz.
Ihr Neffe musste ernst bleiben. »Ins Land der Träume, liebe Tante.«
»Gut, sehr gut. Aber spielst du heute bitte mal das Instrument, das nach dir benannt worden ist?« Jetzt lachte sie so dröhnend, dass der empfindsamen Dichterin neben ihr das Trommelfell zu platzen drohte.
»Wir haben leider kein Cello zur Hand«, bekannte ihr Neffe und senkte den Blick. »Aber wenn ich dir zu Ehren ein kleines Stück von Mozart auf der Geige …«
»Ja, ich bitte darum.«
Während sich Ernst Moritz Tschello mühte, sein Bestes zu geben, schloss Tante Emilie die Augen und ließ in regelmäßigen Abständen leise einen entfleuchen. Als ihr Neffe die Extradarbietung ihr zu Ehren beendet hatte, erwachte sie und klatschte begeistert.
Ernst Moritz Tschello begann nun von vorn: »Für die zweite Darbietung dieses Abends, liebe Freunde des Hauses, liebe Anverwandte, liebste Tante Emilie, haben meine Frau Gemahlin und ich keine Kosten und Mühen gescheut, um bei den Göttern ein Wesen loszueisen, das ihr absoluter Liebling ist und das sie mit einer Stimme ausgestattet haben, wie sie seit Jenny Lind, der schwedischen Nachtigall, keiner Frau mehr geschenkt ward. Nun, eine Frau ist unsere Cécile noch nicht, aber sie singt und tanzt bereits jetzt so hinreißend, dass sie zu sehen uns jetzt schon viele Silbergroschen wert sein dürfte. Da wir aber heute Abend keinen Eintritt nehmen, möchte ich Sie bitten, das Geld, das Sie durch unsere Einladung sparen, in diesen Zylinderhut hier zu werfen. Alles kommt dem Waisenhaus zugute, das meine Frau unter ihre Fittiche genommen hat … Nun aber zu einem Stern am Theater- und Konzerthimmel, der gerade am Aufsteigen ist und in wenigen Jahren alles überstrahlen wird: unsere Cécile.«
Die Kleine war wirklich hinreißend, nur vertat sie sich bei einem von Ernst Moritz Tschello vertonten Goethe-Gedicht – Die Freude – und sang in der zweiten Strophe, wo es heißen musste: Sie schwirrt und schwebet, rastet nie, wohl irritiert vom Anblick eines vom Rost zerfressenen Säbels an der Wand, mit dem einer von Tschellos Vorfahren 1758 bei Zorndorf gekämpft hatte, ganz deutlich »rostet nie«. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den vorher ausgeteilten Text vor sich liegen hatten, lachten zwar nur verhalten und keineswegs höhnisch, doch das reichte, die junge Künstlerin die Contenance verlieren zu lassen. Sie stürzte aus dem Raum, um sich irgendwo zu verkriechen. Die Türen, die vom Flur abgingen, waren verschlossen – bis auf eine, und die gehörte zu Ludolf Tschellos Kinder- beziehungsweise Arbeitszimmer. Da man vor Beginn des Konzerts die Lampe gelöscht hatte, übersah sie die Einradbahn, die auf dem Teppich verblieben war. Ein Krachen – und Cécile hatte mit ihrem rechten Füßchen die große Erfindung der beiden Knaben zermalmt.