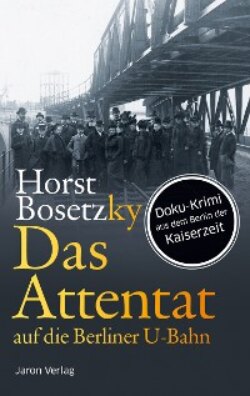Читать книгу Das Attentat auf die Berliner U-Bahn - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 8
Drei 1879
ОглавлениеWerner Siemens stand an einem bitterkalten Tag im Januar auf dem Stettiner Bahnhof und wartete auf den Generalpostmeister Heinrich Stephan, der von einer Reise nach Neustrelitz zurückkommen sollte. Man hatte sich verabredet, um noch einmal über ein Projekt zu reden, das beiden sehr am Herzen lag: die Gründung des Elektrotechnischen Vereins. Das Wort Elektrotechnik stammte von Siemens. Vieles ging ihm durch den Kopf.
Am 18. Januar 1871 war der preußische König zum Deutschen Kaiser gekrönt worden, aber nicht in Berlin, der künftigen Hauptstadt des Reiches, sondern im Spiegelsaal des Versailler Schlosses. Erst am 21. März 1871 war Berlin ins Zentrum des Geschehens gerückt, als der neugewählte Deutsche Reichstag im Abgeordnetenhaus am Dönhoffplatz zu seiner ersten Sitzung zusammenkam. Ein eigenes Domizil sollte man erst 23 Jahre später bekommen, aber langsam erfüllte sich das Wort Fontanes Wo die Kraft ist, da entsteht von selbst ein Mittelpunkt. Die Spitzen der preußischen und der Reichsverwaltung sowie die Führungskräfte von Banken, Industrie und Handel konzentrierten sich an der Spree. Unzählige ausländische Diplomaten und die Gesandten aus den achtzehn deutschen Großherzog-, Herzog- und Fürstentümern sowie den drei Hansestädten und dem »Reichsland« Elsass-Lothringen gaben sich ein Stelldichein. Der Hof residierte in Berlin und Potsdam. Staats- und Regierungschefs kamen zu Besuchen nach Berlin, und der Berliner Kongress von 1878, bei dem sich Bismarck als »ehrlicher Makler« um den Frieden auf dem Balkan bemüht hatte, stellte dabei einen ersten Höhepunkt dar, und so war Berlin auf dem besten Wege, zur wichtigsten Bühne Europas zu werden.
Die Hauptrolle in der Berliner Gesellschaft spielten die Aristokratie und das Militär mit der kaiserlich-königlichen Familie und der Hofgesellschaft. 1871 machte der Adel ein Prozent der Berliner Bevölkerung aus, während 57 Prozent der Arbeiterschaft und 42 Prozent dem Bürgertum zugerechnet wurden. Den größten Aufstieg erfuhr ein Bürgerlicher, wenn man ihn in den Adelsstand erhob, so wie es dem Historiker Leopold Ranke, dem Maler Adolph Menzel und dem Bankier Gerson Bleichröder widerfahren sollte. Irgendwann würde auch er, Werner Siemens, an der Reihe sein … Es war ein langer Weg bis zum »von« – und alles wie ein Traum.
Werner Siemens war am 13. Dezember 1816 als viertes von vierzehn Kindern in Poggenhagen zu Lenthe bei Hannover auf die Welt gekommen, wo sein Vater Ferdinand, ein Landwirt, das Pachtgut übernommen hatte. Die Familie stammte aus Goslar, und bald verschlug es sie nach Mecklenburg-Strelitz, weil dem Vater die politischen Verhältnisse in Hannover nicht behagten. So verlebte Werner Siemens seine Jugendjahre auf dem Dorfe, in Menzendorf, dessen Domäne seine Eltern betrieben. Zuerst erhielten er und sein Bruder Hans Unterricht vom Vater und der Großmutter, dann folgte ein Hauslehrer, und 1831 kam Werner Siemens schließlich nach Lübeck auf ein Gymnasium, das humanistisch-altsprachliche Katharineum. Die alten Sprachen behagten ihm gar nicht, doch schon früh zeigte sich bei ihm eine ausgeprägte Begabung für naturwissenschaftliche und technische Dinge. Zu Ostern 1834 verließ er die Schule ohne formalen Abschluss und nahm Privatstunden in Mathematik und Feldmesskunde, um die Aufnahmeprüfung an der Berliner Bauakademie zu bestehen. Als sich aber herausstellte, dass der Familie die finanziellen Mittel fehlten, um ihn dort studieren zu lassen, blieb ihm nichts anderes übrig, als zum Militär zu gehen. Denn war man Offiziersanwärter beim Preußischen Ingenieurkorps, dann konnte man sich an der Bauakademie auf Staatskosten ausbilden lassen.
»Tut uns leid, Herr Siemens«, hieß es aber beim Ingenieurcorps. »Sie haben so viele Vordermänner, dass frühestens in vier bis fünf Jahren an eine Ausbildung zu denken ist. Aber gehen Sie doch zur Artillerie, Artilleristen bekommen dieselbe Ausbildung. Eine Empfehlung können Sie gerne bekommen.«
Mit der reiste Werner Siemens zur Kommandantur der 3. Artillerie-Brigade. Der Name des Kommandeurs kam ihm bekannt vor: Oberst von Scharnhorst. Das war der Sohn des großen Generals, und dem gefiel der junge Siemens. Er versprach, beim preußischen König die Erlaubnis zu erwirken, den Ausländer in den preußischen Militärdienst aufzunehmen. »Ihr Vater muss Sie aber vom mecklenburgischen Militärdienst freikaufen.«
Beides gelang, aber um die Eingangsprüfung zu bestehen, bedurfte es guter Kenntnisse in Mathematik, Physik, Geographie und Französisch, und nach einer intensiven dreimonatigen Vorbereitung schaffte Siemens es auch, Offiziersanwärter zu werden und 1835 wunschgemäß zur renommierten Artillerie- und Ingenieurschule in Berlin entsandt zu werden. Hier lehrten neben vielen anderen die Mathematiker Martin Ohm und Carl Jacobi, der Chemiker Eilhard Mitscherlich sowie die Physiker Heinrich Gustav Magnus und Heinrich Wilhelm Dove, aber auch der Major Meno Burg, der erste jüdische Offizier in der preußischen Armee. Über Magnus kam Siemens später zur Physikalischen Gesellschaft, der auch Hermann von Helmholtz angehörte.
Nach Abschluss des dreijährigen Studiums wurde Siemens zum Leutnant ernannt und war bis 1840 in Magdeburg und dann bis 1842 in Wittenberg stationiert. Nach dem Tod seiner Eltern musste er ab 1840 auch die Sorge für seine jüngeren Geschwister übernehmen.
»Wie komme ich nur zu Geld?« Diese Frage bestimmte die nächsten Jahre und brachte ihn dazu, kreativ zu werden. Viel Zeit dazu hatte er im Jahre 1840, als man ihn zu fünf Monaten Festungshaft verurteilte, weil er einem Kameraden bei einem Ehrenhandel sekundiert hatte. Seine Zelle funktionierte er zu einem kleinen Laboratorium um und versilberte und vergoldete Blechlöffel auf galvanischem Wege. Von den schönen und so billigen Löffeln wurde bald in ganz Magdeburg gesprochen, und ein Juwelier zögerte nicht, ihm seine Methode für vierzig Louisdor abzukaufen. Als Siemens nach einem Monat begnadigt werden sollte, richtete er eine Eingabe an den Kommandanten, ihn noch in Haft zu lassen. Vergeblich.
Als man höheren Orts von dieser Episode Kenntnis bekam und realisierte, dass Siemens von Technik und Chemie gleichermaßen Ahnung hatte, reagierte man sofort und versetzte ihn zur Luftfeuerwerkerei nach Spandau, denn der Geburtstag der Zarin stand ins Haus, und zu dieser Gelegenheit sollte im Park des Prinzen Karl in Glienicke ein Feuerwerk abgebrannt werden, wie es die Welt noch nie gesehen hatte. Das Vorhaben gelang, und Prinz Karl fand es grandios.
Von 1838 bis 1849 war Werner Siemens preußischer Artillerie-Offizier, wobei er jede freie Minute nutzte, um sich fortzubilden und selbständig zu experimentieren, aber auch um eine eigene Firma zu gründen. Neben Studium und Dienst war er unermüdlich damit beschäftigt, etwas zu erfinden oder etwas bereits Erfundenes der praktischen Verwertung zuzuführen, nur um Geld zu verdienen.
Im Jahre 1845 wurde er in Berlin Zeuge einer Vorführung eines Zeigertelegraphen, den der britische Physiker Charles Wheatstone konstruiert hatte. Doch siehe da, das Ding wollte einfach nicht störungsfrei funktionieren. Das nun war für Siemens die berühmte Herausforderung, und in den nächsten beiden Jahren gelang es ihm, das Gerät durch einen automatisch gesteuerten Synchronlauf zwischen Sender und Empfänger wesentlich zu verbessern. Beim Geber wie beim Empfänger kreiste gleichlaufend ein Zeiger, und hielt man ihn bei A durch einen Fingerdruck auf eine Buchstabentaste an, so stoppte er auch bei B beim selben Buchstaben.
Der Markt für den neuen Zeigertelegraphen war groß, und so suchte Siemens nach einem kongenialen Mechaniker, der ihn auch in Serie bauen konnte. Er fand ihn schließlich in dem 1814 in Hamburg geborenen Feinmechaniker und Universitätsmechanikus Johann Georg Halske, der in Berlin mit einem anderen Mechaniker eine kleine Werkstatt betrieb und für Siemens schon verschiedene Reparaturen ausgeführt hatte.
»Sehen Sie mal, Meister Halske, was ich hier für Sie habe.« Siemens breitete seine Zeichnungen vom neuen Zeigertelegraphen auf einer Werkbank aus. Als er mit seinen Erklärungen fertig war, sah er gespannt zu Halske hinüber.
Der schüttelte den Kopf. »Det soll loofen, Herr Leutnant? Nee, det looft nie im Leben nich.«
Verstimmt ging Siemens nach Hause, verfiel aber nicht in Depressionen, sondern machte sich daran, aus Zigarrenkistenbrettern, Blech, Eisen und Kupferdraht selber ein Modell seines Zeigertelegraphen zu basteln. Es war primitiv, aber es funktionierte, und Johann Georg Halske war nun vollauf begeistert.
»Wissen Se wat, Herr Leutnant? Ick haue hier ab, und wir machen zusammen ’n telegraphischen Laden uff!«
»Ja, schon, aber …« Noch scheute Siemens davor zurück, Abschied vom Militär zu nehmen, denn er hatte weiterhin für seine Geschwister zu sorgen – und er wollte irgendwann auch heiraten, seine Cousine Mathilde Drumann. So nahm er das herrliche Modell seines Zeigertelegraphen, das Halske alsbald gebaut hatte, und ging damit in die Bendler Straße, wo der Große Generalstab eine Kommission gebildet hatte, deren Aufgabe darin bestand, die Fortschritte auf dem Gebiet der Telegraphie zu verfolgen und die Einführung der elektrischen anstelle der optischen Telegraphie vorzubereiten.
Chef dieser Kommission war General Etzel. Der war anfangs etwas ungehalten, als Werner Siemens zu längeren Ausführungen ansetzte, brach aber bald in Lobeshymnen aus. »Hervorragend, lieber Siemens! Einfach hervorragend! Damit wäre mit einem Schlag das Problem der elektrischen Telegraphie gelöst.«
Siemens winkte ab. »Bis auf die Isolierung bei unterirdischen Leitungen. Die Bodenfeuchtigkeit dringt beim Kautschuk durch die Nähte, und nehmen wir Glasröhren, bekommen wir die Verbindungsstellen zwischen ihnen nicht hermetisch abgedichtet. Ich möchte also vorschlagen, es zunächst einmal mit Leitungen über der Erde zu versuchen.«
Der General lachte. »Erlauben Sie mal! Wir werden unsere kostbaren Kupferdrähte landaus, landein in der freien Luft aufhängen, dass jeder, der gerade knapp bei Kasse ist, sich ein Stück davon klauen kann!«
»Ich bitte Sie, Herr General, doch nicht bei uns in Preußen!«
Trotzdem machte sich Siemens mit Feuereifer daran, das Problem der Isolierung von Erdkabeln zu lösen. Zu Hilfe kam ihm dabei sein Bruder Carl. Der schickte ihm aus London die Probe einer Substanz, die aus Sumatra stammte und Guttapercha genannt wurde. Sie sollte dieselben Eigenschaften wie Kautschuk haben, nur dass sie sich kneten ließ, wenn man sie erwärmte. Siemens nahm sich einen Kupferdraht und umgab ihn mit einem Mantel aus Guttapercha. Es war die vollkommene Isolierung, und die Kommission zeigte sich sehr angetan davon. Siemens entwarf eine Presse, mit der sich Drähte fabrikmäßig mit Guttapercha ummanteln ließen, und Halske baute diese Presse. Der Generalstab orderte viele tausend Meter isolierten Drahtes für eine erste große Versuchsleitung von Berlin nach Großbeeren.
Man bot Siemens die Leitung aller preußischen Telegraphenlinien an, der militärischen wie der öffentlichen. Doch er lehnte ab, denn er war schon zu sehr Unternehmer. Ihn reizte das Risiko. Aber so ganz ohne Netz wollte er, dachte er an seine Geschwister und seine künftige Frau, denn doch nicht leben, und so beschloss er, weiterhin beim Militär zu bleiben. Aber aus dieser sicheren Deckung heraus wollte er dennoch etwas wagen. Also ging er wieder einmal zu Johann Georg Halske.
»Meister Halske, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass wir gemeinsam eine Telegraphenfabrik aufmachen wollen. Ich muss aber erst für den Generalstab die Telegraphenlinien fertigstellen, ich bin kein Deserteur. Doch als stiller Teilhaber kann ich jetzt schon mitmachen. Mein Vetter, der Justizrat Siemens, will uns sechstausend Taler borgen. Schlagen Sie ein!«
Johann Georg Halske tat es, und am 12. Oktober 1847 gründeten die beiden die Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske. Das Gründungskapital bestand aus einem Darlehen von 6842 Talern, das Werner Siemens von seinem Vetter Johann Georg erhalten hatte. Der Firmensitz war Berlin, wo man in einem Hinterhaus in der Schöneberger Straße 19 eine Werkstatt für zehn Mitarbeiter angemietet hatte.
Der erste große Auftrag für Siemens & Halske kam 1848 von der preußischen Regierung, die so schnell wie möglich darüber informiert werden wollte, was in der Paulskirche von der Deutschen Nationalversammlung diskutiert und beschlossen wurde. In kürzester Zeit sollte eine Telegraphenlinie von Berlin nach Frankfurt/Main verlegt werden. Rund fünfhundert Kilometer mussten hierzu überbrückt werden, was zur einen Hälfte mit Kabeln, zur anderen mit Freileitungen geschah. Am 28. März 1849 konnte als erste wichtige Nachricht die Wahl des preußischen Königs Wilhelm IV. zum Kaiser übermittelt werden.
Der erste Rückschlag für Siemens & Halske kam schon bald, als nämlich im Sommer 1850 ein Amerikaner in Hamburg einen Telegraphenapparat vorführte, den der Kunstmaler Samuel Morse in den Vereinigten Staaten erfunden hatte. Dieser Schreibtelegraph benutzte einen Elektromagneten, mit dessen Hilfe Striche und Punkte in ein laufendes Papierband gestanzt wurden.
»Wir müssen einsehen, dass dieser Apparat unserem überlegen ist«, sagte Siemens. »Nur eignet er sich so, wie er ist, nicht für die praktische Ferntelegraphie, und unsere Chance besteht darin, ihn in dieser Hinsicht so zu verbessern, dass alle unseren Apparat kaufen wollen.«
Das gelang dann tatsächlich, und die Firma entwickelte sich prächtig, vor allem auch, weil man sich ausländische Märkte erschließen konnte. Für Russland baute man ein riesiges Telegraphennetz, man gründete eine Londoner Niederlassung und errichtete später ein eigenes Kabelwerk. Sogar durch das westliche Mittelmeer und durch das Rote Meer wurden Kabel verlegt. 1874 lief mit der Faraday das erste eigene Kabelschiff der Firma Siemens & Halske vom Stapel.
Eine wesentliche Ursache für das schnelle Aufblühen unserer Firmen sehe ich darin, sollte Siemens später in seinen Lebenserinnerungen schreiben, dass die Gegenstände unserer Fabrikation zum großen Teil auf eigenen Erfindungen beruhen … Andauernde Wirkung konnte das allerdings nur infolge des Rufes größter Zuverlässigkeit und Güte haben, dessen sich unsere Fabrikate in der ganzen Welt erfreuen.
Werner Siemens blieb rastlos. 1852 heiratete er seine erste Frau Mathilde, die ihm die Söhne Arnold und Wilhelm gebar. Für die Berliner Feuerwehr entwickelte er ein Feuermeldesystem auf der Grundlage der Telegraphie, er erfand den Doppel-T-Anker, formulierte das dynamoelektrische Prinzip und baute die erste Dynamomaschine. Bis 1878 sollte es dauern, bis deren Kinderkrankheiten überwunden waren, dann begann der Siegeszug des Starkstroms.
Während er auf dem Lehrter Bahnhof stand und wartete, konnte Werner Siemens seinen Blick keine Sekunde von den Dampflokomotiven abwenden, die ankamen und wegfuhren. Sie erinnerten ihn an vorzeitliche Drachen, die Rauch und Feuer spien. Zu dieser Assoziation passte auch, dass sie bei der Vulcan AG in Stettin gebaut worden waren.
Direkt vor ihm war eine Maschine mit Schlepptender zum Halten gekommen, eine 1B-gekuppelte Personenzuglokomotive. Die Petroleumlampen glänzten ganz harmlos, aber Siemens wich automatisch ein paar Schritte nach hinten, denn solch eine Dampflok war ja nichts anderes als ein Sprengkörper. Passte das Personal nicht auf oder versagten die Instrumente, explodierte der Kessel und riss alles in den Tod, was in seiner Nähe stand.
Es ärgerte ihn, was er da sah. Dieser Rauch, dieser Schmutz! Und überhaupt, wie konnte man mit einer Dampfmaschine auf Rädern durch die Landschaft fahren! Um wie viel sinnvoller und vor allem praktischer war es dagegen, die Energie stationär zu erzeugen, mit riesigen Dynamomaschinen in einem abgelegenen Kraftwerk, und sie dann in Form von elektrischem Strom mit Hilfe von Drähten sauber über weite Strecken zu transportieren. Eine moderne Lokomotive brauchte dann einen starken elektrischen Motor und Vorrichtungen, um sich den Strom aus den Schienen oder über der Strecke angebrachten Leitungen zuzuführen.
Im Prinzip war das alles ganz einfach, doch ihm war schon klar, dass es noch viele Jahre dauern würde, bis die elektrischen Züge wirklich fuhren und die dampfenden und feuerspeienden Ungetüme abgelöst wurden. Aber eines Tages würde ganz Europa von einem dichten Netz elektrischer Bahnen überzogen sein, und jede Stadt würde statt der Pferdebahnen elektrische Straßenbahnen haben. Nein. Schnell wurde er zum Bedenkenträger in eigener Sache, denn die Straßen würden überquellen von Motorkutschen. Vor drei Jahren hatte Nikolaus August Otto zusammen mit Eugen Langen den ersten brauchbaren Viertaktgasmotor gebaut, und man hörte, dass im Schwäbischen an schnell laufenden Benzinmotoren gewerkelt wurde. Und wenn dann die Straßen den Benzinkutschen gehörten, blieb für die elektrischen Bahnen kein Platz mehr – es sei denn, man ließ sie in einem Tunnel unter der Erde oder auf Stelzen hoch über der Fahrbahn verkehren. Das war kein Hirngespinst, denn in New York gab es solche Hochbahnen schon, wenn auch mit Dampfbahnen betrieben.
»Alles ist machbar«, murmelte Siemens. »Und am Ende des Jahrhunderts wird Berlin seine elektrische Schnellbahn haben – hoch über der Straße.«
Das Frühjahr 1879 brachte mit Gründung der Technikerhochschule und der Eröffnung der Gewerbeausstellung für Naturwissenschaften, Mathematik, Ingenieurwesen, Architektur und das Bauen eine bis dahin einzigartige Blütezeit. Man hatte die Bau- und die Gewerbeakademie zur Königlich Technischen Hochschule zusammengeschlossen und in einem Neubau in Charlottenburg untergebracht.
Auf dem Dreieck, das von der Straße Alt-Moabit, der Invalidenstraße und dem 1871 eröffneten Lehrter Bahnhof gebildet wurde, war die Gewerbeausstellung angesiedelt. Aus einer Sandwüste hatte man mit viel Geld und Arbeit einen hübschen Park gemacht, der mit seinen Wasserkünsten und den luftigen Pavillons die Berliner erfreute. Zwar sollte die Eröffnung der Stadtbahn noch einige Zeit auf sich warten lassen, aber ihre Viaduktbögen waren schon fertiggemauert, und die Gewölbe konnten genutzt werden. Die meisten von ihnen dienten als Ausstellungsräume, einige aber auch als Gaststätten.
Die Gewerbeausstellung sollte zwei Höhepunkte aufweisen, von denen der eine allerdings außerhalb des Ausstellungsareals zu bewundern war: die Installierung der ersten elektrischen Straßenlaternen. Friedrichstraße, Ecke Unter den Linden erstrahlten sie und waren um ein Vieles heller als die herkömmlichen Gaslaternen.
Die zweite Sensation war in Moabit selber zu bestaunen: die erste elektrische Schienenbahn der Welt, vorgeführt von der Firma Siemens & Halske. Die Zeitungen des Jahres 1879 schrieben, sie würde einer Grubenbahn gleichen. Hundert Jahre später hätte man einen anderen Vergleich herangezogen, nämlich den einer schmalspurigen Parkeisenbahn, wie sie überall in den Städten mit vornehmlich Kindern an Bord ihre Runden drehte. Der Fahrer thronte auf der kleinen zweirädrigen Elektrolok wie ein Turner nach einem verunglückten Sprung auf einem Bock oder Pferd. Auf den drei angehängten Wägelchen saßen auf Längsbänken je sechs Passagiere, und wer etwas längere Beine hatte, musste aufpassen, dass seine Füße nicht über den Erdboden schrammten. Mit drei Pferdestärken und einer Geschwindigkeit von sieben Stundenkilometern ging es dreihundert Meter im Kreise herum. Jede Runde kostete zwei Sechser. Jungen, denen das zu teuer war, hatten keine Mühe, nebenherzulaufen und den Zug zu überholen. Mehrere Wächter passten auf, dass die Besucher nicht auf beide Schienen gleichzeitig traten, weil das mit einem Stromschlag verbunden war.
Einer der Ingenieure, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Bahn zuständig waren, war Erich Abendroth. Er wurde des Öfteren gefragt, ob er Engländer sei, denn er beherrschte die fremde Sprache nicht nur nahezu perfekt, sondern hatte auch etwas von einem echten Lord an sich. Jedenfalls in der Vorstellung der Berliner. Schlank war er und fiel durch vollendete Manieren auf. Verwunderlich war das aber nicht, hatte er doch im Auftrage der Firma Siemens & Halske einige Jahre in London verbracht und sich mit der Verlegung von Seekabeln befasst. Wieder in Berlin zurück, war er, gerade einmal 34 Jahre alt, zum Oberingenieur aufgestiegen und hatte endlich eine Familie gründen können. Man hatte in der Großbeerenstraße eine geräumige Wohnung gemietet, trug sich aber mit dem Gedanken, hinaus in einen der Vororte zu ziehen, wenn diese erst besser mit der Bahn zu erreichen waren.
Dorothea Abendroth kam aus Landsberg an der Warthe, der idyllischen Kreis- und Emidiatstadt in der Neumark, wo ihr Vater als Apotheker zu den Honoratioren gehörte. Sie war durch und durch höhere Tochter, fast schon bis zur Parodie, und passte insofern bestens zum Herrn Oberingenieur. Etwas müde war sie heute, denn sie hatte am Morgen schon Lawn Tennis gespielt. Das schickte sich für eine Dame, die etwas auf sich hielt. Dennoch hatte sie daran festgehalten, ihrem Mann auf der Gewerbeausstellung einen Besuch abzustatten, denn für den Nachmittag hatte sich auch Werner Siemens angemeldet, und den wollte sie sich nicht entgehen lassen. Ihn zu kennen erhöhte ihr Ansehen sowohl im Tennisclub wie auch im Kreise ihrer Freundinnen. Um ihm zu gefallen, hatte sie ein Kostüm aus dem Schrank geholt, das an sich für diese Gelegenheit viel zu schick war. Es war aus schwarzem broschiertem Atlas geschneidert, durch und durch mit schwarzer Seide gefüttert und sehr reich mit Guipure-Spitze garniert. Hinten war der Stoff zu einer faltigen Puffe aufgerafft und mit Agraffen versehen. Das eigentliche Kleid bestand aus moosgrünem Satin Merveilleux, besetzt mit gleichfarbiger Spitze. Dazu trug sie einen Manila-Hut mit Einfassung und Schleier aus grünem Samt, Stahlschnalle und drei Federn.
Ihre jüngere Freundin Hertha Mahlgast war etwas weniger aufwendig gekleidet, aber sie war ja auch nicht darauf aus, Eindruck auf den obersten Vorgesetzten ihres Mannes zu machen. Man hatte sich während der Sommerfrische beim Badeleben in Heringsdorf kennengelernt und danach gemeinsame Spaziergänge im Victoria Park unternommen – wohnte man doch nahe beieinander.
Fröhlich drehten die beiden eine Runde mit der Siemens-Bahn. Dann standen sie an einem Bierausschank und warteten, bis Dorotheas Mann einen Augenblick Zeit für sie hatte. Gesprächsthemen gab es genug. Da war zuerst die Angst vor der Pest. Würde sie bis nach Berlin kommen, war die bange Frage. Im russischen Astrachan war sie ausgebrochen und schon bis nach St. Petersburg vorgedrungen. Im Reichstag hatte der Sanitätsrat Dr. Georg Christian Thilenius erklärt, die Seuche sei auf eine Luftvergiftung durch klitzekleine Tierchen zurückzuführen, auf sogenannte Bakterien – und war von den Vertretern aller Parteien ausgelacht worden. In Berlin hatte man große Mengen an Chemikalien in die Gewässer geschüttet, um die Pesterreger abzutöten.
»Die BZ hat geschrieben: Wir sehen in der Tat einem chlorreichen Sommer entgegen«, sagte Hertha Mahlgast. »Ist das nicht drollig?«
Dorothea Abendroth lachte. »Noch drolliger ist, dass Erich demnächst nach Pest fahren soll, weil die Ungarn an einer elektrischen Bahn interessiert sind, wie Siemens sie projektiert.«
»Möchtest du eine Bulette essen?«, fragte Hertha Mahlgast.
Dorothea Abendroth schüttelte sich. »Nein, wo doch das Gerücht geht, dass wieder viel Pferdefleisch als Rinderfilet verkauft wird.«
»Meine Köchin sagt, det is allens ejal, wenn man nich die Droschkennummer rausschmeckt.«
»Man könnte in Schwermut verfallen«, stöhnte Dorothea Abendroth.
»Du bist doch nicht Sissi.« Die schöne Kaiserin, 42 Jahre alt, litt an Schwermut.
»Hör auf, darüber spottet man nicht. Sie feiern doch in diesem Jahr ihre Silberhochzeit.«
Hertha Mahlgast wechselte das Thema. »Hast du schon die Züricher Novellen von Gottfried Keller gelesen?«
»Nein. Der grüne Heinrich war mir damals zu langatmig. Wie Schweizer eben sind. Da ist doch Dostojewski von ganz anderem Temperament. Mein Buchhändler will mir so schnell wie möglich Die Brüder Karamasow besorgen.« Und Dorothea Abendroth hatte noch eine andere kulturelle Neuigkeit zu vermelden. »Bruckner soll eine neue Symphonie haben, die 6., in A-Dur. Und wir haben schon …«
Sie brach ab, denn in diesem Augenblick kam ihr Mann mit Werner Siemens an der Seite auf sie zu. Sie war sehr befangen, als ihr der berühmte Erfinder und Fabrikant vorgestellt wurde. Da ihr die Worte fehlten, nahm sie zu Goethe Zuflucht und bemühte den Schüler aus dem Faust, wenn auch ein wenig abgeändert: »Ich bin heute nach Moabit gekommen, um einen Mann zu hören und zu kennen, den alle mir mit Ehrfurcht nennen. Mein Erich ganz besonders.«
Werner Siemens war ein zu sachlicher Mensch, als dass er mit der Gattin eines seiner Untergebenen einen Dialog geführt hätte, wie man ihn aus französischen Theaterstücken gewohnt war. Die Sätze zu drechseln war ihm zu mühsam. Er brauchte seine Energien für anderes.
Er beließ es daher bei einer knappen Verbeugung. »Ihre Worte ehren mich, Gnädigste, aber was Ihren Mann betrifft, so weiß ich ihn auch ohne Ihre Schmeichelei zu schätzen. Ich darf mich bei dieser Gelegenheit auch gleich bei Ihnen dafür entschuldigen, dass Sie ihn in nächster Zeit womöglich seltener zu Hause sehen werden als bisher, denn er ist von der Idee eines Netzes elektrischer Schnellbahnen für Berlin ebenso fasziniert wie ich, und nachdem vor einem Jahrzehnt meine ersten Pläne in den Papierkorb der Obrigkeit gewandert sind, werden wir in nächster Zeit unsere Bemühungen verstärken, um zum Zuge zu kommen. Dies im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich zum elektrisch angetriebenen Zug. Unsere Bahn hier«, er zeigte auf die kleine Bahn, die ohne Unterlass ihre Runden drehte, »unsere Bahn hier gibt ja zu den schönsten Hoffnungen Anlass.«
»Meinen herzlichen Glückwunsch dazu«, sagte Hertha Mahlgast. »Und mich freut das ganz besonders, war es doch mein Schwager, der an ihrer Entwicklung maßgeblich beteiligt war.«
Werner Siemens überlegte einen Augenblick. Dann verdüsterte sich sein Gesicht. »Sie meinen Germanus Cammer?«
»Ja.«
»Schrecklich! Er ist und bleibt verschwunden. Sie können versichert sein, dass ich all meine Beziehungen zur Polizei habe spielen lassen, um sein Schicksal aufklären zu lassen, doch vergeblich. Dabei hätte ich ihn so gern dabei, wenn wir zur nächsten Attacke gegen Baurat Hobrecht blasen.«