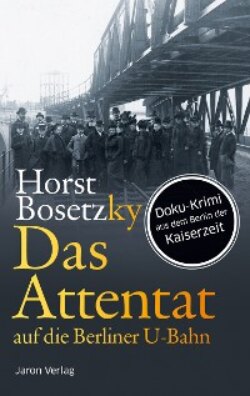Читать книгу Das Attentat auf die Berliner U-Bahn - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 9
Vier 1880
ОглавлениеJames Friedrich Ludolf Hobrecht war ein Mensch, der allein schon wegen seines Geburtstages etwas ganz Besonderes war, hatte er doch zu Silvester das Licht der Welt erblickt, genauer gesagt am 31. Dezember 1825. Dies war in Memel geschehen, dem vorgeschobenen Außenposten Preußens. Zur höheren Schule war er dann in Königsberg gegangen, ohne aber auf dem Collegium Fridericianum das Abitur zu schaffen. Irgendwie stand er immer im Schatten seines älteren Bruders. Beider Schicksal aber hieß Berlin.
Als sie es im jugendlichen Alter zum ersten Mal besuchten, stank es in der preußischen Metropole erbärmlich. Das lag daran, dass alle häuslichen und gewerblichen Abwässer sowie der Regen in Rinnsteinen entsorgt wurden, die bis zu einem Meter breit waren und einen Meter tief zwischen Straßenrand und Bürgersteig verliefen. Die Bürger hatten sie auf Brettern und Bohlen zu überwinden. Für die Fäkalien gab es zwar Abtritte auf den Hinterhöfen, aber die wurden nicht immer wie vorgeschrieben abgeschöpft, denn die Brühe in besondere Jauchewagen umzufüllen und vor die Stadt zu schaffen war äußerst lästig. Viel einfacher war es da, die Nachteimer heimlich in den Rinnstein zu entleeren. Müll und Abfall kamen hinzu. Gab es dann starken Regen, liefen die Rinnsteine über, und in der ganzen Stadt breitete sich ein fürchterlicher Fäulnisgestank aus. Ratten huschten auch am Tage über die Straße. Die Spree, in der sich schließlich alles sammelte, war zu einer großen Kloake geworden, und das Grundwasser war so unrein, dass die Infektionskrankheiten ständig zunahmen und Seuchen wie Typhus und Cholera drohten.
»Dass die Berliner selber nicht merken, was ihre Stadt für ein Drecknest ist«, sagte James.
Arthur lachte. »Die sind so, dass sie einen von außerhalb brauchen, der die Dinge wieder in Ordnung bringt.«
»Ja, dich.«
»Nein, dich.«
Schließlich waren sie beide es, die diese Aufgabe übernehmen sollten, der eine, Arthur, als Berliner Oberbürgermeister von 1872 bis 1878, der andere, James, als Stadtbaurat. Eine moderne Kanalisation für Berlin, das war eine Vision von ihm, eine funktionsgerechte und lebenswerte Stadt eine andere.
Am 1. April 1845, als Zwanzigjähriger also, kam James Hobrecht nach Berlin. Die Primarreife hatte er geschafft und eine Feldmesserausbildung abgeschlossen, nun begann er an der Allgemeinen Baufachschule der Bauakademie sein Studium. 1849 legte er sein Examen als Bauführer ab und trat dem Architektenverein bei. So sehr hing er dann doch nicht an Berlin, dass er seinetwegen eine lukrative Stelle ausgeschlagen hätte, und so zog er nach Stettin, weil man an der Oder jemanden suchte, der eine großstädtische Stadtentwässerung aufbauen sollte. Von 1862 bis 1869 arbeitete er in Stettin und wurde dort zum königlichen Baurat ernannt.
Auch in Berlin hatte man derweilen nicht geschlafen. Besonders Rudolf Virchow, 1821 in Pommern geboren, hatte die Leute aufgerüttelt. Hauptberuflich als Pathologe an der Charité tätig, war er sowohl Mitbegründer der liberalen Deutschen Fortschrittspartei als auch Mitglied der Berliner Stadtverordnetenversammlung und forderte ständig den Bau von Krankenhäusern für die unteren Stände sowie die Beseitigung der hygienischen Missstände bei der Abwasserentsorgung. Anhand der Erfahrungen, die man in der englischen Stadt Croydon gemacht hatte, wies er den Zusammenhang zwischen der Anzahl von Typhus-Toten und dem Grad der Kanalisierung nach.
Seine Gedanken brachten den Baumeister Friedrich Eduard Salomon Wiebe dazu, dem Berliner Magistrat einen detaillierten Entwurf für die Planung eines Kanalisationsnetzes vorzulegen. Von Hause aus war Wiebe Mathematiker und Physiker und hatte sich beim Ausbau des Eisenbahnnetzes vom Rhein bis nach Ostpreußen einen Namen gemacht. Die größte Gefahr für die Gesundheit der Berliner sah er in den Abtrittsgruben, die selten und meist nur unzulänglich geleert wurden. Sie waren durch Wasserklosetts zu ersetzen, wie er sie auch in England und Frankreich kennengelernt hatte, und die Entsorgung der Fäkalien wie des Regenwassers sollte nicht mehr mittels der nach oben offenen Rinnsteine erfolgen, sondern durch Rohrleitungen und Kanäle tief unter der Straße. Unterhalb von Charlottenburg sollte dann das angesammelte Abwasser in die Spree abgeleitet werden.
1860/61 hatte Wiebe seine Pläne entwickelt, aber das Vorhaben sollte in den nächsten zehn Jahren nicht recht vorankommen, weil zum einen die Berliner nicht willens waren, für die Hausanschlüsse zu zahlen, und zum anderen Stimmen laut wurden, die meinten, dass es nicht anginge, die Spree zum Abwasserkanal zu machen. Viel klüger sei doch die Feldberieselung, also die Abwässer nach mechanischer Grobreinigung auf Felder weit außerhalb der Stadt zu pumpen. Dort konnten Sand und Pflanzen die Schmutz- und Dungstoffe herausfiltern und die im Erdreich befindlichen Mikroorganismen die Abwasser biologisch reinigen.
Um die Sache voranzutreiben, beauftragten die Berliner Behörden James Hobrecht, der auf einem eigens dafür gepachteten Gelände Feldversuche zur Verrieselung anstellen sollte. Als diese zur Zufriedenheit des Magistrats verliefen, wurde James Hobrecht 1869 zum Chefingenieur der Berliner Kanalisation ernannt. Er übernahm Wiebes Ideen, wobei er jedoch die zentrale Einleitung der Abwässer in die Spree durch ihre Verbringung auf eine Reihe von Rieselfeldern ersetzte. In seinem Gutachten plädierte er für die Einrichtung mehrerer autarker Kanalnetze, sogenannter Radialsysteme. Zwölf dieser Systeme sollten, jeweils mit einem eigenen Pumpwerk versehen, über das Stadtgebiet verteilt installiert werden.
Berlin stand ein gewaltiger Kraftakt bevor, und nach langen politischen Diskussionen bildete die Stadt Berlin 1873 eine Baukommission, deren Leitung Rudolf Virchow und James Hobrecht übertragen wurde. Im selben Jahr noch begann man, Hobrechts Pläne umzusetzen. Die Stadt Berlin kaufte die Güter Osdorf und Friederikenhof, um dort Rieselfelder anzulegen. Ende 1878 wurde das erste Radialsystem mit 2415 angeschlossenen Grundstücken und einer Fläche von rund 390 Hektar in Betrieb genommen, und bis 1881 sollte die gesamte Berliner Innenstadt mit knapp 10 000 Hausanschlüssen kanalisiert sein.
Aber nicht nur die Berliner Kanalisation lag James Hobrecht am Herzen, sondern auch die sinnvolle Strukturierung der wild wuchernden Stadt und der ringsum liegenden selbständigen Gemeinden, deren Größe vom vergleichsweise riesigen Charlottenburg bis zum kleinsten Dörfchen reichte. Berlin war ein Flickenteppich. Fabriken wie die von August Borsig oder Louis Schwartzkopff wurden gegründet, aber es gab für sie keine richtige Infrastruktur. Sandwege, Stadtmauer und fehlende Bahnanschlüsse verhinderten eine weitere Expansion. Und wenn die Arbeitskräfte von den Feldern in die Werkhallen abwanderten, dann mussten sie einigermaßen menschenwürdig untergebracht und in die Lage versetzt werden, in annehmbarer Zeit ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Straßen waren zu bauen, Bauordnungen mussten erlassen werden, und nach einem vernünftigen Gleichgewicht zwischen Wohnen, Gewerbe, Erholung und Verkehr war zu suchen. Dieses Werk sollte nun James Hobrecht in Angriff nehmen.
»Ich will keine große, zentrale Stadt, bei der alles auf das Schloss ausgerichtet ist«, erklärte er seinem Bruder. »Mein Ziel sind einzelne Stadtteile, in denen sich ein Mensch heimisch fühlen kann. Kleine Straßen und Plätze sollen das Leben bestimmen, und ein Karree soll für einen Park freigehalten werden.«
Arthur Hobrecht war nicht ganz so begeistert von dieser kleinteiligen Lösung. »Wie sollen wir da mit Paris konkurrieren können? Wo sind die Champs-Élysées?«
»Magistralen brauchen wir auch, die den Verkehr aufnehmen, da muss ich dir recht geben. Die sollen dann durch breite, ringförmig angelegte Straßen miteinander verbunden werden.«
»Und die Industrie?«, fragte der Bruder.
James Hobrecht hatte da seine Vision. »Die großen Fabriken gehören vor die Stadt, sonst setze ich aber auf die Berliner Mischung.«
Arthur lachte. »Hört sich nach Bonbons an.«
»Gemeint ist: Keine Separation der einzelnen Lebensbereiche, sondern Arbeiten und Wohnen an einem Ort – und dies in einer echten Gemeinschaft.« James Hobrecht wollte mit seiner Idee die Klassengegensätze aufheben, zumindest aber die sozialen Spannungen mindern. »In der Mietskaserne gehen die Kinder aus den Kellerwohnungen über denselben Hausflur in die Freischule wie die Rats- oder Kaufmannskinder, die auf dem Weg ins Gymnasium sind. Schusters Wilhelm aus der Mansarde und die bettlägerige Frau Schulz im Hinterhaus, deren Tochter durch Nähen oder Putzarbeiten den notdürftigen Unterhalt besorgt, werden im ersten Stock bekannte Persönlichkeiten. Hier gibt es einen Teller Suppe zur Stärkung, da ein Kleidungsstück, dort die wirksame Hilfe zur Erlangung freien Unterrichts oder dergleichen und alles das, was sich als Resultat der gemütlichen Beziehungen zwischen den gleichgearteten – wenn auch noch so verschieden situierten – Bewohnern herausstellt, eine Hilfe, welche ihren veredelnden Einfluss auf den Geber ausübt. Und zwischen diesen extremen Gesellschaftsklassen bewegen sich die Ärmeren aus dem zweiten oder vierten Stock, Gesellschaftsklassen von höchster Bedeutung für unser Kulturleben, der Beamte, der Künstler, der Gelehrte, der Lehrer und so weiter, und wirken fördernd, anregend und somit für die Gesellschaft nützlich. Und wenn es nur ihr Dasein und stummes Beispiel für diejenigen wäre, die neben ihnen und mit ihnen untermischt wohnen.«
Der Bruder lächelte. »Du mit deiner Sozialromantik.«
»Nenne es Utopie, aber die Menschheit wäre am Ende, wenn es keine Utopien mehr geben würde.«
Jetzt lächelte Arthur Hobrecht nicht nur, jetzt grinste er. »Schlimm wird es nur, wenn ein anderer auch seine Visionen hat und sich die beiden Visionen überhaupt nicht vertragen.«
»Wen meinst du damit?«
»Diesen Siemens. Er wird dich in den nächsten Tagen heimsuchen. Ich beneide dich nicht.«
Berthold Blumenthal war mit Leib und Seele Beamter. Für ihn stand fest, dass jeder Mensch von Natur aus ein Tier war, das gezähmt werden musste – und dies schaffte nur ein starker Staat mit seinen Gesetzen und einem Apparat, der imstande war, diese Gesetze auch durchzusetzen und die zu bestrafen, die gegen sie verstießen. Aber noch etwas hatte der Staat mit seinen Beamten zu leisten: die Sorge für die Bürger, die im Leben zu kurz gekommen waren oder für ihre Arbeit zu wenig Lohn bekamen. Das war Blumenthals soziale Ader, und nicht umsonst hing er sozialdemokratischen Werten an, ohne sich indes offen zur Sozialdemokratie zu bekennen – wollte er doch auch Karriere machen. Er war kein ausgesprochener Gegner der Monarchie – schließlich stabilisierten Kaiser und König die deutsche Gesellschaft –, aber eine Republik mit demokratisch gewählten Führern hätte er ihr allemal vorgezogen. Seine klammheimliche Sympathie galt der Pariser Kommune, gleichzeitig hatte er aber auch Angst vor jeder radikalen Umwälzung. Jede legal zustande gekommene Hierarchie war eine heilige Sache für ihn, und was auch immer sein Vorgesetzter von ihm verlangte, er führte es aus, ohne zu räsonieren, sofern es nicht gegen die Gesetze verstieß. Anders konnte eine Bürokratie nicht funktionieren.
Er war im Jahre 1840 im havelländischen Nauen als Sohn des Stadtkämmerers geboren worden und hatte nach seiner Zeit beim Militär in Berlin mit heißem Bemühen, aber wenig erfolgreich versucht, Architektur zu studieren. Nach einem kräftigen Donnerwetter seines Vaters war er schließlich zur Jurisprudenz gewechselt, ohne jedoch die geringste Affinität zum Amt des Richters oder des Staatsanwalts zu entwickeln, auch Advokat mit eigener Kanzlei wollte er nicht werden. Ein Studium der Nationalökonomie wäre ihm lieber gewesen, aber das hätte sein Vater nicht unterstützt. Dessen Kontakte hatten ihm schließlich zu einer Planstelle bei der Berliner Magistratsverwaltung verholfen. Nach einer gewissen Rotation zu Beginn seiner Laufbahn war er schließlich als Referent im Stadtbauamt gelandet und galt als rechte Hand von James Hobrecht.
Verheiratet war er mit Magdalena, der Tochter eines evangelischen Pfarrers. Es war eine gute Ehe, obwohl seine Frau ihm ab und an ein wenig zu sehr frömmelte. Vier Kinder hatten sie, drei Knaben und ein Mädchen, ihre Elisabeth, das Nesthäkchen.
Sie wohnten in einem alten, aber gerade renovierten kleinen Haus in der Kurstraße, das ihnen von einer Tante vererbt worden war.
Wie so oft kam auch an diesem Abend sein Bruder zu Besuch. Theodor, zwei Jahre älter als Berthold, war Redakteur von Beruf und hatte sich in den letzten Jahren mehr und mehr der Politik verschrieben. Als junger Mann hatte er sein Elternhaus verlassen, um zur See zu fahren. Alles war ihm zu eng gewesen und drohte ihm den Atem abzuschnüren. »In Nauen das Grauen!«, hatte er ausgerufen. Bald hatte er aber die Erfahrung machen müssen, dass ein Landarbeiter in Preußen, so elend dessen Existenz auch sein mochte, immer noch besser lebte als ein Matrose auf einem Segelschiff. Wir werden gehalten wie Galeerensklaven, schrieb er an seinen Bruder. In New York stahl er sich dann von Bord, um sein Glück in den Vereinigten Staaten zu machen. In einer deutschen Tischlerei in Milwaukee stieg er auch schnell vom Hilfsarbeiter zum Prokuristen auf, schaffte es aber nicht, sich bei Beginn des Bürgerkrieges vom Wehrdienst freizukaufen, und flüchtete über die Grenze nach Kanada.
Nach Preußen zurückgekehrt, schloss er sich der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei an, die 1869 in Eisenach unter der Führung von August Bebel und Wilhelm Liebknecht gegründet worden war. Lange Zeit machte man Front gegen Ferdinand Lassalles Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, stimmte aber im Mai 1875 in Gotha doch für die Vereinigung beider Parteien zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. Theodor Blumenthal brachte es aufgrund seiner organisatorischen Fähigkeiten und seiner rhetorischen Begabung bald zum Funktionär und Abgeordneten. Am 19. Oktober 1878 aber billigte der Reichstag mit 221 gegen 149 Stimmen das von Kaiser Wilhelm I. erlassene »Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie«. Jeder, der verdächtigt wurde, mit den Sozialdemokraten zu sympathisieren, konnte verfolgt und verhaftet werden. Die neun sozialdemokratischen Abgeordneten durften zwar ihr Reichstagsmandat weiterhin ausüben, der Partei waren jedoch alle Versammlungen verboten.
Theodor Blumenthal war heute so fröhlich, dass sein Bruder aus dem Staunen gar nicht mehr herauskam.
»Du, du wirst lachen, aber die Arbeit im Untergrund macht Spaß. Hier, lies das mal!« Er schob Berthold einen engbeschriebenen Bogen hinüber.
»Was ist denn das?«
»Ein Polizeibericht.«
»Wie kommst du denn an den?«
»Man hat so seine Beziehungen.«
Berthold Blumenthal überflog den Text.
Was die Organisation der Sozialisten anbelangt, so werden hier täglich an den verschiedensten Orten, in Privatwohnungen, Werkstätten, auf Spaziergängen, in Schanklokalen, oft sogar in dunklen Räumen, kleine Zusammenkünfte von sechs bis sieben Personen abgehalten, bei denen Mitteilungen und Anweisungen von den bald hier, bald dort erscheinenden Führern gemacht resp. erteilt werden. Man errichtet Lesezirkel, Gesangsvereine, arrangiert Tanzkränzchen. Alles zu dem Zweck, um unter der harmlosen Maske einer geselligen Unterhaltung ernste Beratungen über Parteiangelegenheiten pflegen zu können.
»Wie findest du das?«, fragte Theodor Blumenthal.
»Bebel hat recht, das Sozialistengesetz wird euch entscheidend stärken.«
Die illegal gewordene Partei hatte sich schnell den neuen Bedingungen angepasst. Die Organisationspyramide war nur unsichtbar geworden, es gab sie aber dennoch. Man traf sich zumeist in den Hinterzimmern von Gaststätten, deren Wirte als zuverlässig galten.
»Das läuft alles bestens«, erklärte Theodor Blumenthal. »Schwierigkeiten haben wir nur, wenn eine Vollversammlung der Vertrauensleute ansteht, eine Corpora, wie wir das nennen, denn das sind zu viele Leute für ein Kaffeekränzchen oder eine Billardrunde.«
Ihr Dialog wurde abrupt unterbrochen, als im Wohnzimmer der Gong geschlagen wurde. Sie sprangen auf, denn Magdalena ließ nicht mit sich spaßen, wenn jemand zu spät zu einer Mahlzeit kam. Die drei Knaben saßen bereits ordentlich aufgereiht am Tisch, während die Köchin dabei war, die Suppe aus der Terrine zu schöpfen und auf die Teller zu verteilen. Das Baby lag in seinem Bettchen und schlief.
Magdalena sprach das Tischgebet, dann konnte munter drauflosgeplaudert werden, obwohl wegen der Kinder bestimmte Themen ausgeschlossen waren, etwa die Verhaftung einiger »lüderlicher Dirnen«, die bei der Ausübung ihres Gewerbes ihre Freier bestohlen hatten.
Theodor, der unverehelicht war, berichtete vom Schaufrisieren der Berliner Friseur- und Barbierinnung im Buggenhagener Kaisersaal. »So manche Barbierstube dient der Partei als geheimer Treffpunkt, und so ist es kein Wunder, dass ich eingeladen worden bin. Was mich aber am meisten begeistert hat, waren nicht die preisgekrönten Frisuren der Damen, sondern die Büste des Kaisers: Die war nämlich aus Seife geformt. Ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass … Aber lassen wir das!« Mit Blick auf die Knaben und seine Schwägerin verbot er sich, seiner Phantasie freien Lauf zu lassen.
Magdalena Blumenthal stieß dennoch ein warnendes Hüsteln hervor und zitierte aus dem Brief des Paulus an die Römer den Anfang des 13. Kapitels: »Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung; die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen.«
Theodor Blumenthal nickte. »Sicher, denn die herrschenden Werte sind immer die Werte der Herrschenden, da muss ich Karl Marx recht geben, und da die herrschende Klasse immer auch für die Götter zuständig ist, wird sie die von ihr erdachten Götter auch in ihrem Sinne handeln lassen.«
»Lieber Schwager, ich möchte dich doch ernsthaft bitten, die Harmonie unseres Gastgebots nicht in Gefahr zu bringen. Du weißt ja, ich sehe die Stachelschrift nicht gern in meinem Hause.«
»Bitte, Magdalena …«
»Nein, schweige bitte, wer politisiert, ist nur allzu leicht ein Haberecht. Und du verböserst die Sache nur noch.« Sie sah ihren Ältesten an. »Benedikt, erfreue du uns lieber mit den neuesten Hervorbringungen der Herzenszähmerin.«
»Mutter, darf ich vorher noch aufstehen und hofieren?«, fragte Benjamin, der dem Alter nach hinter Benedikt kam.
Theodor Blumenthal musste sich sehr beherrschen, nicht loszuprusten, glaubte er doch, aus den Worten seines Neffen einen leichten Spott an der altertümelnden Sprache seiner Mutter herauszuhören. Doch der Junge schien es ernst zu meinen und eilte, als er die Erlaubnis dazu bekam, auf die Toilette.
Magdalena Blumenthal gehörte einem Verein an, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, dem Tod altdeutscher Wörter entgegenzutreten. Wörter wurden geboren, Wörter welkten dahin und starben – das aber wollten sie und ihre Mitstreiter verhindern. Das Gastgebot war ein feierlicher Schmaus, den man den Gästen bot. Ein Haberecht war ein Rechthaber und die Herzenszähmerin die Dichtkunst. Hofieren war deckungsgleich mit dem lateinischen Wort cacare und meinte: seine Notdurft verrichten.
»Gut, dass der Junge sich rechtzeitig gemeldet hat«, sagte Theodor Blumenthal, »denn Harnverhaltung ist eine schlimme Sache, der große Tycho Brahe ist sogar daran gestorben. Vielleicht wird Benjamin ja mal Harnprophet.« Das hatte er so ernsthaft gesagt, dass seine Schwägerin nicht verstimmt sein konnte. Er wusste, dass Harnprophet eigentlich ein Spottname für die Ärzte der alten Schule war, die angaben, in den meisten Fällen Krankheiten aus der Beschaffenheit des Harns erkennen zu können.
Berthold Blumenthal hatte das Geplänkel zwischen seinem Bruder und Magdalena ziemlich genossen, fürchtete aber, dass seine Frau langsam doch zornig werden würde, und ergriff daher selber das Wort, um das Gespräch auf Themen zu lenken, die weniger verfänglich waren.
»Weil wir uns in der Kanzlei immer wegen der Rechtschreibung streiten, habe ich mir bei meinem Buchhändler das Vollständige Orthographische Wörterbuch der deutschen Sprache von Konrad Duden bestellt.«
»Ja, ich habe mich gerade mit meinem Chefredakteur gestritten, ob man nun Satire oder Satyre schreibt«, fügte Theodor Blumenthal hinzu.
»Der Deutsche schreibt am besten Stachelschrift«, merkte Magdalena Blumenthal an.
»Diesmal muss ich dir recht geben, liebe Schwägerin. Das mit den Stacheln ist nicht schlecht, und wenn ich einmal eine Satire-Zeitschrift gründe, dann nenne ich sie Stachelschwein.«
In diesem Augenblick kam die Köchin herein und hielt einen Gegenstand in der Hand, von dem sie offensichtlich annahm, dass er jeden Augenblick explodieren könne. »Wat solln die hier: ’ne Kartätsche bei mir inne Küche? Wer hat ’n die einjeschleppt?«
»Ich, werte Dame.« Theodor Blumenthal deutete eine leichte Verbeugung an. »Für die gnädige Frau. Statt Blumen.«
»Wolln Se ma vergackeiern?«
»Nein, um Gottes willen. Dies ist eine ganz neue Erfindung: die Konservenbüchse. In ihr kann man Fleisch und Gemüse über lange Zeit hinweg frisch und genießbar halten. Probieren Sie es morgen bitte einmal aus!«
»Gott, wenn das unsere Künftigkeit sein soll!« Die Hausfrau rang die Hände. »Nicht mehr auf den Markt gehen, nicht mehr selber kochen … Mit diesem Geschenk beleidigst du mich, lieber Theodor.«
»Das lag mir wirklich fern, liebe Magdalena. Ich weiß doch, wie köstlich du selber kochen kannst.«
»Du Federleser, du!«
»Ich – und ein Schmeichler? Oh, wenn ich das nur besser könnte!« Theodor Blumenthal legte seinen Löffel in den Teller und wischte sich den Mund ab. »Wisst ihr, wen ich gestern zufällig auf der Schlossbrücke getroffen habe?«
»Nein.« Seine Schwägerin sah ihn hochachtungsvoll an.
»Doch nicht etwa Seine Majestät?«
»Nein, nur den Grasmuck. Den kennt ihr auch, der hat ein Fuhrgeschäft in Rixdorf, züchtet aber vor allem Pferde für unsere Droschken und Pferdebahnen. Und der sagt, dass die Droschken billiger werden, weil es immer mehr Pferdebahnen gibt.«
Berthold Blumenthal lachte. »In einigen Jahren wird es den Pferdebahnen genauso ergehen: Da werden auch die billiger werden müssen, weil die Leute mit den elektrischen Bahnen fahren.«
»Das möge unser Herrgott verhindern!«, rief Magdalena Blumenthal. »Denn die Elektrizität ist vom Valant.«
»Wovon?«, fragte ihr Schwager.
»Vom Teufel.«
»Warum denn das? Der Blitz ist doch auch ein Stück Natur.«
Magdalena Blumenthal ließ sich nicht beirren. »Aber nicht die Ströme, die der Mensch selbst erzeugt. Mein Arzt hat mir erklärt, dass sie in das Hirn des Menschen eindringen und uns krank machen. Darum flehe ich dich an, Berthold, des Glückes unserer Kinder wegen: Nutze deine Stellung bei Baurat Hobrecht, und tue alles, um diese elektrischen Bahnen, dieses Teufelszeug, zu verhindern, ob sie nun auf, über oder unter der Straße fahren sollen!«
Was blieb Berthold Blumenthal anderes übrig, als zu nicken und ihr zu versprechen, sein Bestes zu tun. Um seine Frau von diesem heiklen Thema abzulenken, kam er auf das zu sprechen, was die Berliner Verwaltung derzeit stark beschäftigte: unter anderem, dass die Charlottenburger sich mit Händen und Füßen dagegen wehrten, eingemeindet, also vom Moloch Berlin verschluckt zu werden.
Theodor Blumenthal lachte. »Sind wir ja selber schuld dran«, sagte er.
In diesem Augenblick fing im Nebenzimmer ihre Jüngste an, fürchterlich zu schreien, und Magdalena ging auf ihren Mann los. »Siehst du, Berthold, ich hab dir ja gleich gesagt, dass sie davon krank werden wird.«
»Wovon denn krank?« Berthold Blumenthal konnte sich keinen rechten Reim auf alles machen.
»Na, gestern im Rathaus, als ich dich besucht habe.«
»Was war denn da?«
»Da habe ich mit dem Kind eine Weile unter den Sedan-Birnen gestanden.« Das war die volkstümliche Bezeichnung für die elektrische Beleuchtung, die man 1878 zur Erinnerung an die glorreiche Schlacht von Sedan, die auf den 1. und 2. September des Jahres 1870 datierte, im Berliner Rathaus installiert hatte. »Zehn Minuten nur – und das hat schon gereicht, das Kind … Meine arme Betti!« Sie stürzte aus dem Zimmer.
Formal lag die Entscheidung, ob eine Hoch- oder Untergrundbahn gebaut werden durfte, bei der Baupolizei, die streng über die Einhaltung aller Vorschriften und Bauordnungen wachte, aber natürlich verständigte sich der Polizeipräsident vorher mit dem Magistrat, so dass Baurat Hobrecht sofort in Rage geriet, als Werner Siemens den ersten Entwurf einer elektrischen Schnellbahn vorgelegt hatte.
»Ich lasse mir doch von diesem Elektrotechniker mein schönes Stadtbild nicht verschandeln!«
»Sehr wohl …« Berthold Blumenthal konnte nicht anders, als seinem Vorgesetzten grundsätzlich recht zu geben, aber er wagte auch, ein klein wenig zu räsonieren. »Andererseits wäre es nicht schlecht, ein Pendant zur Stadtbahn zu schaffen. Wenn die in zwei Jahren eröffnet wird, haben wir in Ost-West-Richtung eine ausgezeichnete Bahnverbindung und können die Menschenmassen mühelos vom Schlesischen Bahnhof nach Charlottenburg befördern, in Nord-Süd-Richtung aber verbleiben wir auf dem Stande der Droschken und Pferdebahnen.«
James Hobrecht reagierte unwirsch. »Blumenthal, das ist doch ein unzulässiger Vergleich! Die Stadtbahn hat eine eigene Trasse, ihre Züge dampfen nicht durch enge und belebte Straßen.«
»Darum will Siemens ja auch in die Höhe gehen.«
Das Konstruktionsbureau von Siemens & Halske hatte eine sogenannte Pfeilerbahn geplant, die vom Weddingplatz über Chaussee- und Friedrichstraße zum Belle-Alliance-Platz führen sollte. Nach dem Vorbild New Yorks sollte die Bahn nach Richtungen getrennt rechts und links des Fahrdamms angelegt werden, und zwar an der »Trittoirkante«. Der Bahnkörper ruhte dabei auf 4,50 Meter hohen Pfeilern, einstieligen Stützen.
»Durch eine Plattform sollen diese Stützen zu einem durchgehenden Schienenstrang verbunden werden«, erläuterte Blumenthal den Entwurf.
»Und wenn ein Wagen entgleist?«, fragte Hobrecht, um gleich selbst die Antwort zu geben. »Dann stürzt der ganze Zug auf die Straße, und wir haben Dutzende von Toten, Fußgänger wie Fahrgäste. Alle zerquetscht und verstümmelt.«
»Auch Schiffe können untergehen – und trotzdem wagen sich die Leute mit ihnen auf die Ozeane hinaus«, wagte Blumenthal einzuwenden. »Und für die Sicherheit ist gesorgt, denn der gesamte Unterbau wird aus Eisen gefertigt. Die Stützen werden aus Gusseisen sein und mit Blütenkapitellen verziert. Alles aus der Schinkel-Bötticher-Schule.«
»Schön und gut, aber …« James Hobrecht zeigte sich von alldem wenig beeindruckt. »Die Pfeilerbahn nimmt den Geschäftsleuten das Licht und ihren Läden jede Wirkung. Jeder blickt nur nach oben, wo die Bahn dahinzieht, und nicht mehr in ihre Schaufenster. Schlimmer noch: Sie müssen unter Umständen ihre Ladenlokale aufgeben, wie auch die Mieter in den ersten Etagen ihre Wohnungen.«
Das bezog sich auf die Angaben, die Siemens im Hinblick auf die Gestaltung der Haltestellen gemacht hatte: Was das Aufsteigen an den Stationen betrifft, so würde es wohl das Beste sein, dass man an den geeigneten Stellen einen Laden in erster oder zweiter Etage mietete. Dieser würde ein Wartezimmer bilden und durch eine Brücke mit der Bahn verbunden werden. Da nicht mehr als fünfzehn Personen in einem Wagen Platz haben sollten, sei mit größeren Publikumsansammlungen nicht zu rechnen. Deshalb bräuchten keine großen Warteräume eingerichtet zu werden. Auf freien Plätzen würde man in leichter Eisenkonstruktion eine Treppe oder Galerie anlegen können, die als Perron diene.
»Und alles versperrt einem die Sicht!«, rief Hobrecht. »Und wenn man flaniert, leidet man unter dem Höllenlärm, den die Züge machen. Nein, mein Lieber, diese Pfeilerbahn ist reine Narretei. Und wozu all dieser Aufwand und all diese Beeinträchtigungen, wenn ein Wagen nur fünfzehn Menschen aufnehmen kann! Das ist doch absoluter Unsinn, das schafft man doch auch mit dem Pferdebus und der Pferdebahn.«
»Zu wenige Passagiere, sagen Sie …« Berthold Blumenthal reizte es, seinen Vorgesetzten ein wenig aus der Fassung zu bringen – und das gelang ihm immer am besten, wenn er Hobrechts heilige Kuh, seine Kanalisation, ins Spiel brachte. »Wesentlich mehr Menschen kann man natürlich befördern, wenn man lange Züge unter der Erde fahren lässt, wie man das in London seit Jahren praktiziert.«
Da schlug James Hobrecht mit der flachen Hand auf den Tisch. »Nur über meine Leiche! Ich lasse mir doch meine ganze herrliche Kanalisation nicht durch diese Röhrenbahnen verderben!«
»Soll also der Antrag der Firma Siemens & Halske abschlägig beschieden werden?«, fragte Blumenthal routinemäßig, obwohl das völlig unnötig war.
»Selbstverständlich. Und wenn ich den Namen Siemens aus Ihrem Mund noch einmal höre, sind Sie in den nächsten zehn Jahren von jeglicher Beförderung ausgeschlossen.«