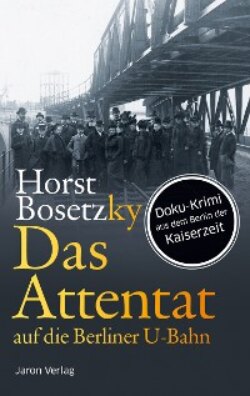Читать книгу Das Attentat auf die Berliner U-Bahn - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 7
Zwei 1878
ОглавлениеGeorg Grasmuck war 1840 als Sohn eines Großbauern in Radensleben geboren worden. Nahebei, in Wustrau, lag das Schloss des legendären Reitergenerals Hans Joachim von Ziethen, der Friedrich dem Großen zu manchem Sieg verholfen hatte. So zog es denn auch Grasmuck zu den Husaren, und während seines Militärdienstes entdeckte er seine Liebe zu den Pferden. Er pflegte, streichelte und liebkoste sie weit mehr, als es zu seinen Pflichten gehörte, und er besaß das, was die Leute einen Pferdeverstand nannten. Es gab kein Trinkgelage, bei dem nicht darüber gespottet wurde, dass er es gelegentlich sogar mit seiner Lieblingsstute triebe wie mit einem Weibe. Das mit der Sodomie war zwar nichts weiter als üble Nachrede, aber Grasmuck begriff schnell, dass er sich dagegen nur wehren konnte, wenn er zum einen heiratete und zum anderen seinen Mitmenschen verständlich machte, dass ein Pferd für ihn nichts anderes sei als ein Gegenstand, mit dem sich Geld verdienen ließ. So stürzte er sich in die Pferdezucht und schaffte es nach einigen Jahren, ein Gestüt in der Nähe von Neuruppin und eines im Dorf Lübars im Norden Berlins sein Eigen zu nennen. Aber damit nicht genug, er erwarb Anteile an den Pferdebahnen, die ab 1865 überall in Berlin und seinen Vororten gegründet wurden.
Kurzum, Georg Grasmuck war so gut im Geschäft, dass es zu einem stattlichen Haus am Kupfergraben gereicht hatte. Zu dem, was er mit Pferden und Pferdebahnen verdiente, kamen noch die Einnahmen aus einem Fuhrgeschäft, und wenn sich die Dinge weiter so entwickelten wie bisher, konnte er durchaus damit rechnen, an seinem fünfzigsten Geburtstag zum Kommerzienrat ernannt zu werden. Aber schon heute hatte er allen Grund, mit stolzgeschwellter Brust Unter den Linden zu flanieren. Er war halt wer.
Seine Frau war seit Ostern zur Kur in Karlsbad, um ihre chronisch werdende Bronchitis auszukurieren, und Grasmuck nutzte ihre Abwesenheit, um wie ein Junggeselle durch die Stadt zu schlendern und nach hübschen weiblichen Wesen Ausschau zu halten.
Doch wem lief er gegenüber der russischen Botschaft in die Arme? Keiner der marchandes d’amour, sondern seinem Intimfeind Germanus Cammer. Seit Jahren schon kämpften sie um die Vorherrschaft im Berliner Musikantenbund »Äolsharfe«. Jeder wollte das Sagen haben, und ihr Streit war bereits so weit eskaliert, dass sie sich in aller Öffentlichkeit Prügel androhten. Man hatte sie auch flüstern hören, den anderen eines Tages umbringen zu wollen. Sie hätten sich längst duelliert, wäre das noch möglich gewesen.
»Sie hier?«, fragte Grasmuck. So einfach aneinander vorbeigehen konnte man auch nicht, die Form musste schließlich gewahrt werden.
»Ich konnte doch nicht wissen, dass Sie auch …« Cammer war sichtlich verlegen und fürchtete, sich lächerlich zu machen, wenn er jetzt die Flucht ergriff.
»Kommen Sie nächsten Dienstag zur Chorprobe?«, fragte Grasmuck, denn ein wenig Konversation gehörte dazu, wenn gebildete Menschen sich trafen. Früher hatte man sich geduzt, dann aber in kurzen Briefen den anderen gebeten, bitte wieder zum Sie zurückzukehren.
Cammer verbeugte sich mit leichter Selbstironie. »Ja, selbstverständlich. Ich kann doch die ›Äolsharfe‹ nicht ihres besten Tenors berauben.«
Schon fühlte sich Grasmuck getroffen. »Wer der beste Tenor ist, sollten wir die Fachleute beurteilen lassen, und ich glaube, die sprächen sich einvernehmlich …«
Weiter kam er nicht, denn drüben auf der anderen Straßenseite wurden Hochrufe laut. Kaiser Wilhelm I. fuhr in einem offenen Wagen vorüber. Beide rissen ihre Hüte hoch, um in den Jubel der anderen Passanten einzustimmen.
Da fielen plötzlich Schüsse. Dreimal knallte es kurz und trocken. Alles schrie auf: »Der Kaiser!«
Doch der war nicht getroffen worden, und trotz des unbeschreiblichen Getümmels hatte man den Attentäter schnell ergriffen. Schutzleute stürzten herbei.
Auch Grasmuck und Cammer waren schockiert. Jeder wurde augenblicklich in den Strudel der Emotionen gerissen.
»Dass es dazu kommen musste!«, rief Grasmuck.
»Man darf es nie so weit kommen lassen, dass man den anderen derart hasst«, sagte Cammer. »Wir beide sollten das als Zeichen des Himmels nehmen und zusehen, dass wir unseren Frieden miteinander machen.«
Gottfried Ruppin fragte sich immer wieder, ob es wirklich eine kluge Entscheidung gewesen war, von Wolfshagen nach Berlin zu gehen. Als Kossät hatte er in der Prignitz ein elendes Leben geführt – zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel –, aber wenigstens hatte er in frischer Landluft schuften dürfen, während es in Berlin mit dem Mief immer schlimmer wurde, seit die Fabriken wie Pilze aus dem Boden schossen. Das wäre nun das Letzte für ihn gewesen, bei Schwartzkopff oder Borsig Tag für Tag in der Fabrikhalle zu stehen – dann schon lieber Straßen- oder Hochbau.
Mit seinem Kollegen Carl Eichstädt kniete er an diesem Tage am Droschkenhalteplatz vor dem Stettiner Bahnhof, um Schäden im Pflaster zu beseitigen. Sie hatten ihren Arbeitsplatz auf Geheiß eines Schutzmannes mit einigen Dachlatten ordnungsgemäß abgesperrt, bildeten aber gerade dadurch für alle Fußgänger ein erhebliches Hindernis und wurden von den Gepäckträgern und ankommenden Reisenden teils übel beschimpft.
»Passt bloß uff, ihr …!«, drohte Carl. »Sonst begehe ick heute noch mein ersten Mord!«
Gottfried Ruppin machte eine Handbewegung, die seinen Kollegen beschwichtigen sollte. »Nich so laut!« Der andere hatte nämlich schon einige Male wegen verschiedenster Roheitsdelikte im Zuchthaus gesessen, und bei der letzten Verhandlung hatte der Richter ihm angedroht, ihn für immer einzubuchten, sollte er sich noch einmal etwas zuschulden kommen lassen.
»Ach, halt’s Maul!« Carl warf eine schwere Gehwegplatte so heftig in den lockeren weißen Sand, dass diese viel zu tief einsackte und er sie wieder anheben und neuen Sand aufschütten musste, um den Schaden zu beheben.
Gottfried Ruppin konzentrierte sich auf sein kleinteiliges Pflaster. So einfach, wie es den Eindruck machte, war es nämlich gar nicht, einen Bürgersteig so herzurichten, dass er halbwegs glatt aussah. Nicht jede Unebenheit ließ sich später mit einer Walze oder einem Stampfer wieder ausgleichen. Und waren die Fugen zwischen den Steinen zu groß, kippten die Steine, wenn sie stark belastet wurden, zur Seite, und es gab bald ein großes Loch, denn kein richtiger Junge ließ sich die Gelegenheit entgehen, Steine aufzuklauben, wenn sie locker waren. Man konnte mit ihnen etwas bauen, man konnte sie als Wurfgeschosse benutzen. Dies ging Ruppin durch den Kopf, während er nach passenden Steinen suchte und sie dann mit einem leichten Hammerschlag zu den anderen in den Boden versenkte, immer abgelenkt durch die Menschen, die an ihm vorübereilten: Männer, die sich wichtig machten, Frauen, die zu schön waren, als dass er sie nicht bestaunt hätte. Wer auf dem Stettiner Bahnhof ankam und viel Gepäck bei sich trug, musste sich bei einem Schutzmann eine Droschkenmarke aus Blech beschaffen. Ohne Gepäck hatte man eine Marke 1., mit Gepäck eine 2. Klasse zu verlangen. Das aufgegebene Gepäck besorgte dann der Gepäckträger und rief am Droschkenhalteplatz laut die Nummer der Droschke. Die Marke hatte man dem Kutscher nach Besteigen des Gefährts auszuhändigen.
»Mistsau, du!«, fluchte Carl, denn eines der Droschkenpferde hatte, bevor es lostrottete, noch schnell abgeprotzt und eine fette Ladung Mist neben ihm aufs Pflaster gesetzt. Es spritzte bis zu seinen Hosenbeinen.
»Wenn die richtigen zu teuer sind, bleiben uns nur die Pferdeäppel«, sagte Gottfried Ruppin und legte dann, indem er sich ein wenig aufrichtete, die Hand an den Mützenschirm, denn den jungen Bankangestellten, der da aus der Bahnhofshalle kam, kannte er gut. »Hallo, Herr Bernstein!«
Eduard Bernstein, der später als Theoretiker des revisionistischen Flügels der SPD bekannt werden sollte, freute sich über das Echo der arbeitenden Masse und grüßte zurück.
Gottfried Ruppin hatte ihn im Frühjahr als Dozenten im Arbeiterbildungsverein in der Seydelstraße 8 erlebt, gleich am Spittelmarkt. Der Verein der Freunde der Gerechtigkeit, den die meisten als Mohren-Club kannten, weil er in einem Bierlokal in der Mohrenstraße tagte, hatte ihn gegründet, durchweg linksliberale Studenten und Referendare.
Schon früh tauchte der Name Gottfried Ruppin in den Akten der Abteilung VII auf, der politischen Polizei, genauer gesagt am 31. Juli 1872. Damals war er, gerade siebzehn Jahre alt geworden, im Berliner Osten im wahrsten Sinne des Wortes auf die Barrikaden gegangen. Er hatte in der Kleinen Andreasstraße gewohnt und wie alle Arbeiter ringsum unter den elenden Wohnungen, dem Mietwucher und den Zwangsräumungen gelitten. An der Ecke Blumen- und Krautstraße hatten sich viertausend Arbeiter zusammengefunden – »zusammengerottet«, wie es in den Polizeiberichten hieß –, um gegen die Hauswirte zu protestieren. Als man einigen von denen die Scheiben eingeworfen hatte, war die Polizei angerückt – und mit einem Steinhagel empfangen worden. 159 Demonstranten waren durch Säbelhiebe verletzt, 80 verhaftet worden, unter den Letzteren auch Gottfried Ruppin. Vor Gericht war er nicht gekommen, aber ein Stellmacher, ein Droschkenkutscher, ein Maurer, ein Schlosser und ein Appreteur waren zu je viereinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt worden.
Glück hatte er auch am 18. März 1873 gehabt, dem 25. Jahrestag der Berliner Märzrevolution. Damals war er zusammen mit zwanzigtausend Lassalleanern vom Gartenlokal der Aktienbrauerei Friedrichshain zum Friedhof der Märzgefallenen gezogen und hatte mit entblößtem Haupt die »Arbeiter-Marseillaise« gesungen. Da die Obrigkeit die Demonstration nicht genehmigt hatte, gab es am Landsberger Thor eine Säbelattacke der berittenen Polizei. Die Arbeiter flüchteten zwar, konnten aber die Polizisten mit einem Steinhagel in Schach halten. »Ich bin jetzt mehr Steinwerfer als Steinsetzer«, sollte Gottfried Ruppin am Abend erklären.
Sein drittes großes Recontre mit der Polizei hatte er am 19. März 1877 an der Landsberger, Ecke Lichtenberger Straße. Angefangen hatte alles am Alexanderplatz, wo polnische Arbeiter dabei waren, zu Niedrigstlöhnen die Schienen der neuen Pferdebahn zu verlegen. Das wollten sich die Berliner Arbeitslosen nicht gefallen lassen. Etwa zweitausend von ihnen, darunter auch Gottfried Ruppin, besetzten den Platz, um die Gleisbauarbeiten zu verhindern. »Wir wollen Arbeit haben!«, riefen sie. »Lieber lassen wir uns einsperren, als dass wir verhungern!« Wieder war die berittene Polizei zur Stelle und trieb die Menge vor sich her.
»Feierabend!«, rief Carl Eichstädt und machte sich daran, die Gerätschaften in eine kleine Bude zu tragen und einzuschließen. »Kommste mit, ’n Bier saufen?«
»Nee danke, ich treff mich mit Paula.«
Carl lachte. »Steck ’n schönen Gruß mit rein!«
Gottfried Ruppin wusste darauf nichts zu erwidern, zog seine Jacke über und machte sich auf den Heimweg. Der Stettiner Bahnhof war von der Parochialstraße nicht so weit entfernt, als dass er den Weg nicht zu Fuß geschafft hätte. Das Geld für die Pferdebahn sparte er gern. Das Haus, in dem er Stube und Küche gemietet hatte, war ein schmales Handtuch, hatte nur einen winzigen, lichtlosen Hof und hätte eigentlich schon längst abgerissen werden müssen. So ärgerte er sich auch über den Sonntagsmaler, der vor seiner Haustür hockte und versuchte, die Parochialstraße mit der Nikolaikirche im Hintergrund auf die Leinwand zu bringen.
»Wir müssen hier in den Rattenlöchern vegetieren, und Sie kommen her und …« Die richtigen Worte fehlten ihm an dieser Stelle, und er hoffte, dass sie ihn und einige begabte Genossen im neuen Arbeiterbildungsverein auch schulen würden, um bessere Redner aus ihnen zu machen. »Rhe … Rhe …?« Er kam nicht darauf, wie der Fachbegriff dafür hieß.
Der Maler, offenbar ein Lehrer, ließ sich nicht davon abbringen, für sein Motiv zu schwärmen. »Das müssen Sie verstehen, mein Herr, das ist doch hier viel schöner als auf dem Montmartre mit seiner Kirche Sacré-Cœur.«
Gottfried Ruppin ging weiter, freute sich aber, dass die wackere Mutter Scholz mit ihrem Krückstock in einen frischen Haufen Hundekacke fuhr und ihn dem Kunstmaler vor die Nase hielt: »Kacke am Stock is ooch ’n Bukett. Det malen Se mal!«
Er wollte gerade in seine Haustür treten, als er Paula die Straße heraufkommen sah, einen Einkaufskorb in der Hand. Mit beiden Armen winkte er ihr zu. »Das ist ja eine Überraschung!«
Paula Plötzin stammte aus einer zwölfköpfigen Familie und war in einem Hinterhof im Wedding groß geworden. Jetzt hatte sie eine Anstellung bei einem Arzt, der seine Praxis und seine Wohnung in der Klosterstraße hatte. Sie wusste, dass sie hübsch war und durchaus Chancen hatte, den Herren aus den höheren Ständen den Kopf zu verdrehen, doch seit dem letzten Frühjahr war sie mit ihrem Gottfried verbandelt und hoffte, dass der es einmal zum Bauunternehmer bringen würde, fleißig und strebsam, wie er war.
Sie konnten nur ein paar Worte miteinander wechseln, denn Paula war auf dem Weg zu einem Kranken, um ihm die Medizin direkt nach Hause zu bringen. Das duldete keinen Aufschub. Ein kurzer Kuss nur, dann eilte sie weiter. An ihrem freien Abend wollten sie wieder einmal tanzen gehen.
Beschwingt sprang Gottfried Ruppin die Treppe hinauf, so dass sich die morschen Stufen unter seiner Last gefährlich bogen und krächzten. Er schloss seine Wohnungstür auf, zog sich bis auf die Unterhose aus und warf sich erst einmal auf sein Bett, seine Schweinebucht, das in einer Nische stand. Die Arbeit im Straßenbau war schwer, und er brauchte immer einige Zeit, um wieder zu Kräften zu kommen. Schon nach einigen Atemzügen war er eingenickt, nur um wenige Minuten später wieder hochzufahren, denn draußen wurde an die Tür gebummert.
»Aufmachen, Polizei!«
Draußen standen zwei Kriminalschutzleute, die ihn sofort in die Mangel nahmen. Der Mann, der auf den Kaiser geschossen hatte, war schnell als der arbeitslose Schreiner Emil Max Hödel identifiziert worden – und in Hödels Notizkalender hatte sich auch der Name Gottfried Ruppins befunden.
»Sie geben zu, diesen Hödel zu kennen?«
»Ja. Wieso, was ist mit dem?«
»Erst einmal wollen wir von Ihnen wissen, was Sie mit Hödel zu tun haben.«
Gottfried Ruppin ahnte, dass Hödel etwas Verbrecherisches getan hatte, denn er galt als politischer Wirrkopf. Also war er entsprechend vorsichtig. »Ich habe mit Hödel nie direkt zu tun gehabt, sondern ihn nur hin und wieder mal gesehen … aus der Ferne.«
»Und wo war das?«
»Auf der Straße …« Gottfried Ruppin versuchte, ruhig zu bleiben.
»Nicht etwa in einem sozialdemokratischen Verein?«, kam die Frage mit einiger Schärfe zurück.
»Hödel war doch bei Ludolf Stoecker.« Gottfried Ruppin gab sich naiv und versuchte, die beiden Kriminalbeamten auf eine falsche Spur zu locken. Ludolf Stoecker war evangelischer Hof- und Domprediger und erklärter Feind der Sozialdemokratie. Seiner Meinung nach war die Lage der Industriearbeiter allein durch christliche Nächstenliebe zu verbessern, so dass man nicht der Sozialdemokratie auf den Leim gehen, sondern sich mit den religiös und monarchistisch ausgerichteten Parteien verbünden sollte.
»Lassen Sie den Unfug, Ruppin, Sie sind doch in denselben sozialdemokratischen Vereinen gesehen worden, in denen auch Hödel verkehrt hat, zuletzt bei der Versammlung mit diesem Bernstein.«
»Ich habe nie ein persönliches Wort mit Hödel gewechselt!«, betonte Gottfried Ruppin. »Was in Gottes Namen hat er denn Schreckliches getan?«
»Er hat auf Seine Majestät, unseren Kaiser Wilhelm I., geschossen«, verriet ihm der ältere der Kriminalschutzleute.
Gottfried Ruppin musste sich an seinem Bettpfosten festhalten. Sie würden Hödel hängen oder mit der Guillotine köpfen und seine Komplizen lebenslang einsperren. »Ich habe nichts damit zu tun!«, rief er.
»Nein, nein!«, höhnte der zweite Kriminalbeamte. »Und das hier?« Er zeigte zur Wand, an der drei Strophen der Freiheitshymne hingen, gesungen am Heldengrabe im Friedrichshain am 4. Juni 1848.
Georg Grasmuck und Germanus Cammer hatten im eleganten Restaurant »Vier Jahreszeiten« Versöhnung gefeiert und waren dann in einer von Grasmucks eigenen Droschken nach Rixdorf gefahren, wo er in der Richardstraße einen Pferdestall und ein Fuhrgeschäft besaß. Dort stand zurzeit ein Holsteiner Hengst, den ihm ein insolvent gegangener Gutsbesitzer aus dem Fläming in Zahlung gegeben hatte, und für dieses Pferd interessierte sich Cammer. Schon lange träumte er davon, an den Abenden und Wochenenden einfach aufzusteigen und durch den nahen Thiergarten zu reiten.
»Du weißt ja, dass ich vom Lande komme«, sagte er zu Grasmuck, während sie durch die Hasenheide fuhren und den Rollkrug schon in Blickweite hatten. Man duzte sich nun wieder. »Aus der Uckermark. Mein Vater war dort Gutsverwalter, und ich hab täglich auf einem unserer Pferde gesessen.«
»Und warum bist du dann nicht zu den Ulanen gegangen?«, fragte Grasmuck.
»Ja, warum eigentlich? Meine Liebe zur Technik ist wohl meine größte Leidenschaft. Darum die Artillerie. Das war bei mir genauso wie bei Werner Siemens.«
»Hör auf mit dem Namen Siemens!«, rief Grasmuck. »Wenn dessen elektrische Bahnen kommen, kann ich mich aufhängen.«
»Oh, Entschuldigung.« Cammer merkte, dass er sich auf gefährliches Terrain begeben hatte und die eben neu besiegelte Freundschaft schnell wieder in Feindschaft umschlagen konnte. Also bemühte er sich abzuwiegeln, auch wenn er sich dabei gehörig verstellen musste. »Keine Angst, Georg, das dauert ja alles noch seine Zeit. Und bis in Berlin die ersten elektrischen Bahnen rollen, bist du Großvater geworden und hast deine Schäfchen schon lange im Trockenen.«
Grasmuck schwieg. Für ihn ging die Welt unter, wenn das Pferd aus dem Straßenbild verschwand. Pferd und Mensch gehörten zusammen. Pferde waren Leben, von Gott gewollt, Dampflokomotiven und elektrische Bahnen aber waren Teufelszeug und brachten den Menschen nur Tod und Elend. Und genau dafür stand Germanus Cammer, er war ein Diener des Dämons Technik, und schon reute es Grasmuck, mit ihm Frieden geschlossen zu haben. Besser wäre es gewesen, er hätte ihn über den Haufen geschossen. Tat er es, verzögerte sich das Aufkommen elektrischer Bahnen womöglich um Jahre, denn so schnell konnte man bei Siemens & Halske einen Fachmann wie Cammer bestimmt nicht ersetzen. Nur fünf Jahre Aufschub – und Hunderte von Pferden konnten aufgezogen und eingesetzt werden. Aber immerhin wollte Cammer ja etwas von ihm kaufen – und noch dazu ein Pferd. Dennoch …
Während sie den Rollkrug passierten und in die Bergstraße kamen, begann Grasmuck zu zittern wie vor einem epileptischen Anfall. Er hatte Angst vor sich selber, Angst davor, dass der nächste Schub seiner Krankheit kam und er nicht mehr wusste, wer er war und was er war. In einem solchen Zustand war er völlig unberechenbar. Bei seinem letzten Anfall hatte er sich auf seinen Kohlenhändler gestürzt und versucht, ihn zu erwürgen, weil er ihn für den Teufel hielt. Hinterher hatte er dem Mann viel Geld gezahlt, um zu verhindern, dass Anzeige erstattet wurde. Zu einem Arzt wagte Grasmuck nicht zu gehen, weil er fürchtete, ins Irrenhaus zu kommen.
Als sie vor dem Fuhrgeschäft in der Richardstraße angekommen waren, hatte Grasmuck seine Krise aber wieder überwunden. Er rief nach Krischan, doch die Stallwache saß wieder einmal im Krug. Es war ja auch nicht zu erwarten gewesen, dass Grasmuck heute noch nach Rixdorf kam.
»Jetzt reicht’s mir aber.« Grasmuck war verärgert. »Dabei hab ich ihm gesagt, dass er rausfliegt, wenn das noch mal passieren sollte.«
»Wir haben uns unsere Leute längst erzogen«, sagte Cammer. »Absolute Disziplin ist das A und O in jeder Fabrik.«
»Bei meiner Pferdebahn auch – der Fahrplan muss ja eingehalten werden. Hier im Stall sehe ich das nicht so eng, aber einer hat immer hier zu sein. Wenn ein Tier eine Kolik bekommt, wenn ein Feuer ausbricht …« Grasmuck sah sich um, aber es war noch so hell, dass er keine Stalllaterne anzünden musste.
Cammer wurde ungeduldig. »Wo steht denn nun der Hengst, den du mir …? Und wie heißt er eigentlich?«
»Ares«, antwortete Grasmuck. »Der Züchter hatte ein Faible für römische Götter.«
Cammer korrigierte ihn. »Ares war zwar ein griechischer Gott, aber das wäre kein Hinderungsgrund für mich, ihn zu erwerben. Wo steht er denn nun?«
»Dahinten am Fenster.« Grasmuck ging voran. »So ein edles Tier gehört eigentlich auf die Weide, aber ich komme erst nächste Woche wieder nach Neuruppin. Hast du denn einen Stall bei dir in der Nähe?«
»Ja, bei uns im Nebenhaus gibt es noch einen.« In diesem Augenblick erblickte Cammer das Pferd und war sofort hellauf begeistert. »Diese Blesse, genauso wie bei meinem Lieblingspferd früher auf dem Gut.«
Der Hengst wieherte und stieg ein wenig hoch, so dass Grasmuck Mühe hatte, ihn zu beruhigen und das Zaumzeug anzulegen. »Ares, wirst du wohl! Es geht doch nicht zum Abdecker, es geht doch nur auf den Hof.« Das Tier beruhigte sich, und er konnte es wagen, Cammer die Zügel in die Hand zu drücken. »Mach dich schon mal mit ihm vertraut, ich muss mal schnell auf den Abtritt. Das gute Essen vorhin …« Es pressierte, und Grasmuck rannte fast zu dem windschiefen, hölzernen Verschlag in der rechten hinteren Ecke des Platzes. Kaum hatte er die Tür hinter sich zugeschlagen, saß er auch schon auf dem Donnerbalken. Es war eine Erlösung, und er ließ ein wohliges Stöhnen hören.
Gerade hatte er sich gesäubert, als er vom Hof her ein kräftiges Schnauben und Wiehern hörte. Cammer fluchte. Dann schrie er auf, während der Hengst panisch über den Platz fegte und durchgehen wollte. Als Grasmuck die Toilettentür aufgestoßen hatte, sah er, wie Ares mit dem Leib gegen eine Bretterwand krachte. Offenbar hatte er Cammer abgeworfen, denn der Ingenieur lag regungslos neben dem ausgehöhlten Baumstamm, der als Tränke diente. Grasmuck riss sich die Hosen hoch und rannte hin. Fast wäre er selbst von dem Hengst umgerissen worden. Noch im Laufen entdeckte er die gewaltige Wunde, die Cammer rechts oben am Kopf hatte. Wahrscheinlich war er mit dem ungeschützten Kopf gegen den Baumstamm geknallt. Oder aber Ares hatte ihn mit einem Huf getroffen.
Eine Peitsche lag am Boden. Grasmuck riss sie hoch und ließ sie mehrmals knallen, um sich den Hengst vom Leibe zu halten. Cammer war jetzt wichtiger. Er kniete neben ihm nieder.
»Was ist mit dir?«
Eine Antwort bekam er nicht. Cammer sah aus, als wäre er mit einer Axt erschlagen worden.
»Himmel!« Grasmuck erstarrte. Wenn ihn hier jemand fand, dann glaubte man doch sofort, er hätte den Ingenieur erschlagen. Alle wussten von ihrer Feindschaft, aber keiner von ihrer Versöhnung. Jeder Kriminale würde ihn für einen Mörder halten.
Da kam Cammer wieder zu sich und tastete stöhnend nach seiner Wunde. In derselben Sekunde wurde Grasmuck von einer ungeheuren destruktiven Kraft erfasst, gegen die er nicht ankommen konnte. Eine herrische Stimme befahl ihm, zur Axt zu greifen: Wenn er noch nicht tot ist, dann töte ihn jetzt! Und er tat es.
Als er sich umwandte, stand Krischan im Tor. Erst fing er den Hengst ein, dann kam er zu Grasmuck und Cammer herüber.
»Ich hab alles gesehen«, sagte er und grinste.
Liesbeth Cammer wartete ungeduldig darauf, dass ihre beiden Kinder die Wohnung verließen, denn sie wollte endlich mit dem Schreiben beginnen, doch sowohl Franz wie auch Anna Luise liebten es zu trödeln. Ihr Großer, der Nikolaus, war da ganz anders, aber der weilte zu Studien in London. Das Haus Siemens hatte sich sehr zuvorkommend gezeigt und unterstützte ihn mit einer erheblichen Summe.
»Franz, du musst zu deiner Mathematik-Nachhilfestunde!«
Ausgerechnet in der Domäne seines Vaters zeigte der Untersekundaner erhebliche Schwächen. Das lag weniger an mangelnder Intelligenz als vielmehr an seinem ostentativen Desinteresse an der Mathematik und den naturwissenschaftlichen Fächern, wollte er doch nichts anderes als Schauspieler werden. Seine Mutter bekam leuchtende Augen, wenn er davon sprach, denn seinen Vornamen hatte er in Anlehnung an Franz Grillparzer erhalten, dessen Dramen Liesbeth Cammer überaus schätzte.
»Anna Luise, würdest du dich bitte beeilen, Fräulein Hofstetter wartet nicht ewig auf dich!«
Die Tochter, gerade dreizehn Jahre alt geworden, hasste die Klavierstunden bei dem ältlichen Fräulein und hätte sich viel lieber mit ihren Freundinnen getroffen, um tüchtig herumzualbern. Obwohl sie Anna Luise hieß, wie die berühmte Karsch, wollte sie weder Dichterin noch Pianistin werden, sondern, zum Entsetzen ihrer Mutter, nichts anderes als Krankenschwester und – O Gott! – Ärztin.
Endlich verabschiedeten sich die Kinder und polterten die Treppe hinunter.
»Und seid pünktlich zum Abendessen zurück!«, rief sie ihnen noch hinterher. »Vater schimpft sonst wieder mit euch.«
Sie sah den beiden noch kurz hinterher, dann machte sie sich an die Arbeit. Woran sie derzeit schrieb, war eine dünne Monographie mit dem Arbeitstitel Deutsche Dichterinnen, die im nächsten Jahr im Verlag von Oskar Bonde in Altenburg erscheinen sollte. Nicht nur, dass sie dem Publikum ihre berühmten, aber oft schon lange vergessenen Kolleginnen mittels längerer Lebensläufe nahebringen wollte, sie hatte auch vor, charakteristische Texte nachzudrucken.
Sie wandte sich einer Liste mit Namen zu, die alle noch zu bearbeiten waren. Sophie Bernhardi geb. Tieck (1775 – 1833), Dorothea Schlegel geb. Mendelssohn (1764 – 1839), Karoline Luise von Klenke geb. Karschin (1754 – 1802), Bettina von Arnim geb. Brentano (1785 – 1859), Gisela von Arnim (geb. 1827).
Womit sollte sie beginnen? Noch ehe sie sich entschieden hatte, wurde am Klingelzug gerissen. Nach der Kraft zu urteilen, mit der das geschah, konnte es nur ihr Sohn sein. Und richtig, Franz stand vor der Tür und bekundete, fürchterlichen Hunger zu haben.
»Wir warten mit dem Abendessen, bis Vater kommt«, beschied sie ihn. »Du weißt doch, wie sehr er es liebt, mit uns zusammen zu speisen.«
»Wann kommt er denn heute?«
»Bald. Er wollte am Nachmittag in die russische Botschaft Unter den Linden, um dort etwas zu besprechen, dann aber sofort nach Hause kommen.«
Doch es wurde bereits sechs Uhr, ohne dass er gekommen wäre, und auch nach Einbruch der Dunkelheit war er noch nicht zurück.
»Das verstehe ich nicht«, sagte Liesbeth Cammer. »Langsam mache ich mir wirklich Sorgen um ihn.«
»Wenn doch das Telephonnetz schon fertig wäre!«, rief Franz. Er wusste von seinem Vater, dass man bei Siemens & Halske schon im letzten Jahr mit den technischen Versuchen begonnen hatte, aber derzeit hatten lediglich 48 Berliner einen Anschluss, und noch nicht einmal sie selber.
Da fiel Anna Luise ein, dass der Vorgesetzte ihres Vaters schon einen Apparat zu Hause stehen hatte. »Herr Abendroth, der hat schon ein Telephon, der kann sich doch mal umhören, wo Vater steckt.«
»Eine gute Idee.«
Liesbeth Cammer und ihre Tochter machten sich zu Fuß auf den Weg zu Erich Abendroth, während Franz zu Hause blieb, um den Vater in Empfang zu nehmen, falls dieser doch noch innerhalb der nächsten halben Stunde eintreffen sollte.
Doch Abendroth wusste auch nur, dass Cammer in der russischen Botschaft etwas wegen der Moskauer Firmenniederlassung klären sollte. »Und dann wollte er Feierabend machen. Aber vielleicht ist er Unter den Linden einem alten Freund begegnet, und die beiden sind noch einen kleinen Schoppen trinken gegangen. Machen Sie sich mal keine Sorgen, liebe Frau Cammer.«
Max Fleischfresser war so hässlich, dass viele meinten, sie würden sich eine Hose über den Kopf ziehen, wenn sie so aussähen wie er, und auch die Kinder auf der Straße riefen »Arschgesicht kommt!«, wenn er an ihnen vorüberlief. Sogar seine Vorgesetzten sprachen davon, dass er eine »vermanschte Visage« hätte. Das war eine reine Gemeinheit der Natur, obwohl er allen weiszumachen suchte, sein Aussehen sei Folge einer Verletzung, die er im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 davongetragen hatte, als bei der Schlacht von Orleáns dicht vor ihm eine Kartätsche eingeschlagen sei. Sein Name tat ein Übriges, um ihn unsympathisch erscheinen zu lassen, assoziierten doch viele mit ihm, dass er Kannibale sei. Von Jahr zu Jahr wurde er verbitterter und härter im Zupacken, so dass er von allen Berliner Kriminalschutzleuten am meisten gefürchtet war und bei den Ganoven als Bluthund galt. Dass er jemals ein Weib zum Heiraten finden würde, schien ausgeschlossen, und auch die Dirnen verlangten einen Aufpreis, wenn sie ihm die Beiwohnung gestatteten.
Das Polizeipräsidium am Molkenmarkt war wahrlich kein Gebäude, das man errichtet hatte, um herzlich zu lachen. Wer aber das Zimmer betrat, in dem Fleischfresser seinen Dienst versah, konnte sich ein inniges Schmunzeln kaum verkneifen, denn der Mann, der ihm am Schreibtisch gegenübersaß, war ein ausgesprochener Gemütsathlet. Ferdinand Kublank, seit Ewigkeiten mit seiner Karoline glücklich verheiratet und Vater mehrerer Kinder, hielt es mit Fontane: Je älter ich werde, je mehr sehe ich ein: laufen lassen, wo nicht Amtspflicht das Gegenteil fordert, ist das allein Richtige. Wohlbeleibt war er und durch und durch ein echter Berliner.
Man saß beim Frühstück, und Kublank fragte sich, ob er nicht schnell noch zum Friseur gehen solle.
»Doch nicht im Dienst!«, rief Fleischfresser.
»Warum denn nicht?«, fragte Kublank. »Die Haare wachsen doch auch im Dienst.«
»Ich bitte Sie, wir haben Bereitschaft.«
Kublank gab sich zerknirscht. »Entschuldigen Sie, det ick jeboren bin, et soll nich wieda vorkomm.« Damit griff er sich eine alte Ausgabe des Berliner Lokal-Anzeigers, die auf dem Aktenbock lag. »Aber auf den Abtritt darf ich doch gehen – ich meine, während der Dienstzeit?«
»Ja, aber die Zeitung lassen Sie hier.«
Kublank lachte. »Die will ick doch nich lesen, die brauche ick für hinterlistige Zwecke.«
»Ja, eben darum!«, rief Fleischfresser und wurde noch um einiges dienstlicher. »Sehen Sie denn nicht, dass da Seine Majestät drauf abgebildet ist?«
Kublank winkte ab. »Sie tun ja so, als würde ick uff ihn schießen wollen. Wie der Hödel. Nee, ick nich.« Damit riss er die Seite mit dem Photo Wilhelms I. aus der Zeitung, legte es Fleischfresser auf den Schreibtisch und entfernte sich mit den übrigen Seiten. »Ach ja: Rosen, Tulpen und Narzissen, / det janze Leben is een Traum. / Man müsste sich det Hemd zerreißen / und mitten in die Stube … scheint der Mond.«
Fleischfresser begann, sein Frühstück auszupacken. Da er sich seine Brote immer selber schmierte und belegte, hielt sich seine Überraschung in Grenzen, als er seine Stullenbüchse öffnete. Landleberwurst. Was sonst? Er schnupperte daran. Gerade wollte er hineinbeißen, als plötzlich an die Tür geklopft wurde. Unwirsch rief er »Herein!«, nahm dann aber Haltung ein, denn es erschien nicht nur eine Dame, sondern auch der Herr Stellvertretende Polizeipräsident. »Bitte sehr, zu Diensten …«
»Wir haben hier eine Frau Cammer, und die möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Ihr Mann ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen.«
Fleischfresser hatte keine Scheu zu räsonieren. »Pardon, Herr von … aber wir hier sind für Mord und Totschlag zuständig und nicht für verschwundene Personen.«
Daraufhin brach Liesbeth Cammer in Tränen aus, und der Stellvertretende Polizeipräsident flüsterte Fleischfresser ins Ohr, dass er ein Trampel sei.
»Sie ziehen sofort los und suchen Cammer. Sonst …« Zum einen wollte er Siemens nicht verärgern, zum anderen hatte er zusammen mit Germanus Cammer viele Jahre in der »Äolsharfe« musiziert.