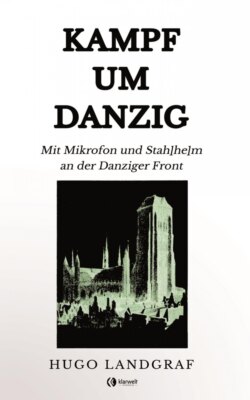Читать книгу Kampf um Danzig - Hugo Landgraf - Страница 6
Danzig
Оглавлениеine neue Woche beginnt. Wird sie die Entscheidung bringen? Ich gehe zum Bahnhof, um nach Berliner Zeitungen zu fragen. Plakate verkünden, dass der Zugverkehr eingeschränkt ist und Zivilpersonen keinen Anspruch auf Beförderung haben. Es fährt aber, wie man mit Erstaunen feststellt, immer noch ein Zugpaar durch den Korridor. Nur sehr wenige freilich getrauen sich, die Fahrt anzutreten. Jeden Augenblick kann die Grenze gesperrt werden. Dann sitzt man in der Mausefalle.
Grade jetzt, im Zustand politischer Hochspannung, spürt es hier jedermann am eignen Leibe, wie unmöglich das Bestehen eines Korridors ist, der die ganze Provinz vom Mutterland brutal abschneidet. Was ist dieser Korridor andere als das Messer Polens an der Kehle von Ostpreußen?!
Ins Quartier zurückgekehrt, finden wir die Weisung vor: nach Danzig!
Eine neue feige Mordtat der Polen hat das Maß fast bis zum Überlaufen gebracht. Zwei brave Grenzschutzmänner sind ihren meuchlerischen Kugeln zum Opfer gefallen. Danzig wird seine Toten mit einem Staatsbegräbnis ehren, der Rundfunk die Feiern übertragen.
Wir fahren über Tiegenhof durch die fruchtbare, marschenähnliche Niederung und passieren zwischen Rothebude und Käsemark die Stromweichsel auf der neuen Schwimmbrücke, die erst kürzlich, am 19. August, eingeweiht wurde. Noch stehen die Aufbauten der Tribüne, von der Senatsvizepräsident Huth den Danziger Arbeitern zurief: „Diese Brücke ist zugleich ein Symbol. Unsichtbar und unzerstörbar steht in unser aller Herzen aufgerichtet die Brücke der Liebe zum deutschen Mutterland und zu unserm Führer.“ Und in Tiegenhof sagte Gauleiter Fenster: „Ihr wisst, dass diese Brücke nicht nur für Ausflugsfahrten gebaut wurde.“ Sie ist der einzige Weichselübergang, der polnischer Kontrolle und polnischem Zugriff entzogen ist.
Gegen Mittag erreichen wir Danzig. Wie nimmt uns in dieser Stunde die Herrlichkeit der alten deutschen Hansestadt gefangen! Der wuchtige, kraftvolle Ernst ihrer gotischen Bauten, der ehrwürdigen Zeugen mittelalterlicher Herbheit und Größe! Und dies paart sich zu köstlicher Einheit mit der Helle und Schlankheit der schmalen, fensterreichen Patrizierhäuser aus der Barockzeit und ihren kecken, hochragenden, kühn geschwungenen Giebeln, die sich in fröhlichem Gewimmel drängen wie die Masten und Segel der Schiffe auf der Mottlau und im Kaiserhafen.
Die ganze Stadt prangt im Flaggenschmuck, den sie zu Ehren des Besuches der „Schleswig-Holstein“ angelegt hat. Das Schulschiff der deutschen Kriegsmarine ist in Danzig erschienen, um die Toten des Kreuzers „Magdeburg“ zu ehren, der vor 25 Jahren seine Basis in Danzig hatte. Am 27. August 1914 strandete er im Nebel bei einem Vorstoß in die Finnische Bucht und wurde von feindlichen Streitkräften zusammengeschossen. Die zum Teil schwer verwundete Mannschaft wurde damals nach Danzig gebracht. Die Toten der „Magdeburg“ ruhen auf dem Soldatenfriedhof vor dem Olivaer Tor.
Die „Schleswig-Holstein“, armiert mit vier 28-cm- und zehn 15-cm-Geschützen, vier 8,8-cm-Flak und vier MG-Flak, ist draußen in Neufahrwasser gegenüber der Westerplatte vor Anker gegangen. Mit unendlichem Jubel hat man die Ankunft des deutschen Kriegsschiffs begrüßt. „Ihr Besuch, Herr Kommandant“, sagte Danzigs Stadtoberhaupt, Gauleiter Forster, „grade in diesen spannungsreichen Tagen ist für die Danziger Bevölkerung ein besonderer Beweis für den unabänderlichen Entschluss unseres Führers Adolf Hitler, dem deutschen Danzig, besonders in diesen Tagen, beizustehen.“ So hat ganz Danzig die Anwesenheit des stolzen Kriegsschiffs verstanden und seiner Mannschaft aus übervollem Herzen mit einem Meer von Hakenkreuzflaggen gedankt.
Das ist schon einige Tage her. Aber niemand geht daran, die Fahnen wieder einzuziehen. Im Gegenteil, sie vermehren sich von Tag zu Tag, als ob noch Größeres bevorstände, von dem niemand spricht — an das aber alle denken.
Goldene Girlanden winden sich um die vielen Fenster der Giebelfronten der alten Häuser in der Langgasse und am Langen Markt. Festlich sind die Ufer der Mottlau geschmückt und das uralte Krantor. Die Schiffe haben über die Toppen geflaggt. Es ist eine einzige hinreißende Demonstration: Danzig ist deutsch und will zu Deutschland!
Vom Langgasser Tor zum Grünen Tor pulsiert das Leben mit der ungebrochenen Kraft des alten deutschen Gemeinwesens, das noch jede Schicksalsprüfung überstand. „Venedig des Nordens“ hat man Danzig genannt. Sein Campanile ist der Rathausturm, dess’ schlanker Schaft gleich einer jubilierenden Fanfare in die Höhe schießt — ein ritterlicher Degen, ein stolzer Kavalier, der seinen vielgezackten kecken Helm mit soldatischer Grazie selbstbewusst und siegessicher trägt. Hoch oben im Gemäuer steckt eine polnische Geschützkugel. Sie erinnert an den 13. Juni 1577, als König Stephan Bathory die Stadt mit einer polnischen Streitmacht berannte. Vom Bischofsberg richteten die Polen ihre Kanonenrohre auf den hochgereckten Rathausturm. Sie wollten den Turmhelm, das Zeichen Danziger Bürgerstolzes und Danziger Freiheit, herunterholen. Es kam anders. Die Stadt triumphierte über polnische Anmaßung.
Wird sie auch diesmal wieder triumphieren?
Noch gehen polnische Briefträger durch die Straßen, noch fahren die roten polnischen Postautos hin und her, noch tragen polnische Eisenbahnbeamte und Zöllner den polnischen Adler an der Mütze, und von ihren Direktionsgebäuden mitten in der Stadt weht die polnische Flagge.
Wie lange noch?
Es kann nur noch Tage dauern, das fühlt ein jeder. Die Zeit ist reif!
So ist, trotz des Ernstes der Lage, eine frohe Erwartung auf allen Gesichtern und hochgestimmtes, freudig erregtes Leben in der ganzen Stadt, nach dem Danziger Wahlspruch: „Nec temere, nec timide“.
Leben und Tod sind nah beieinander. Am Nachmittag wird der Danziger Grenzschütze Joseph Wessel auf dem Ehrenfriedhof vor dem Olivaer Tor zu Grabe getragen. Acht Kinder stehen weinend und schluchzend an der Gruft. Die Danziger Landespolizei, die SS-Heimwehr und der Grenzschutz der SA geben dem toten Kameraden das letzte Geleit, Gauleiter Forster an ihrer Spitze.
Die Danziger Polizei meldet, dass es ihr gelungen ist, eine große Terrororganisation der Polen, die durchweg aus polnischen Eisenbahnern in Danzig bestand, aufzudecken. Die Angehörigen dieser Organisation wurden bereits vor Monaten zu „Sportkursen“ zusammengerufen, in Wirklichkeit aber militärisch ausgebildet. Besonders wurde der Einsatz von Waffen im Straßenkampf geübt. Die Bewaffnungen besorgte die polnische Eisenbahndirektion. Die wichtigsten polnischen Gebäude sollten Sitz der einzelnen Terrortrupps sein.
Immer deutlicher zeichnete sich die feindliche Front ab. Dass sie im Ernstfalle mitten durch Danzig laufen würde, war nun jedermann klar. Gleichzeitig wird amtlich bekannt gegeben, dass die Schiffe des Seedienstes Ostpreußen bis auf weiteres Zoppot nicht mehr anlaufen. Damit ist auch die letzte Verbindung zum Reich abgerissen.
Am Nachmittag des nächsten Tages steht unser Mikrofon wieder auf einem Friedhof, diesmal weit draußen vor den Toren der Stadt, in Bohnsack, auf der Nehrung zwischen See und Strom.
In der alten Schifferkirche hat man den erschossenen Grenzschutzmann Johann Rusch aufgebahrt. Ein Schiffsmodell, das an der Balkendecke hängt, schwebt grade über seinem Sarg. Die Türen der Kirche sind weit geöffnet. Von draußen schimmert das Wasser vom breiten Strom der Toten Weichsel, und der Wind von See rauscht in den Bäumen am Deich. Die ganze Dorfgemeinde — alles Fischers, wie er selbst einer war — erweist ihm die letzte Ehre. Die SA-Kameraden seines Sturms tragen den Sarg und senken ihn in die Erde seiner Heimat, für die er das Leben gelassen. Drei Ehrensalven hallen über den Strom.
Nach der Beisetzung lassen wir uns mit einem der kleinen Dampfschiffe nach Danzig zurückbringen. Nur wenige Menschen sind mit uns. Ein keckes Mädchen aus der Stadt, vollbusig und mit blanken, vielversprechenden Augen, scherzt mit dem sturmerprobten Kapitän. Der Steuermann linst vergnügt aus dem Ruderhaus. Ein alter Matrose hört schmunzelnd zu. Schließlich kommt auch noch der Heizer herauf, denn es ist höllisch warm unter Deck, und beteiligt sich, halben Leibes in der Luke sichtbar, am Gespräch. In Neufahr, wo der Weichseldurchbruch den Blick auf die See freigibt, nimmt der Schiffer eine Ladung Milchkannen an Bord. Draußen sieht man Fischkutter ihre Netze ziehen. Es ist schwül, und die Fische springen.
Über der Stadt, der wir uns langsam nähern, ballt sich drohend ein Gewitter zusammen. Als ob eine Riesenfaust einen schwarzen Vorhang vor den hellen Abendhimmel zöge, verfinstert sich der Horizont im Westen bis hoch hinauf zum Zenit. Es ist ein packendes, schauriges Schauspiel.
Wollen die Mächte der Finsternis die Stadt verschlingen, die dort mit ihren stolzen Türmen, dem tragenden Schichaukran und dem kühnen Gerüst der Hellige so sicher gegründet steht?!
Ein paar Regentropfen fallen, ein wenig kühlt die schwüle Luft sich ab. Aber kein Blitz bricht aus dem Wolkengrau. Das Dunkel verfließt. Die Abendsonne leuchtet wieder. Von mildem Glanz umstrahlt, empfängt uns die Stadt.
Wir machen an der Langen Brücke fest, dem Bollwerk der Mottlau, wie es schon seit mehr als einem halben Jahrtausend die Schiffer tun, die von See kommen. Beim Anblick des alten Krantors in seiner behäbigen, unerschütterlichen Kraft wird uns ganz warm ums Herz. Das hat schon manchen Sturm überstanden und manche glanzvolle Stunde von Danzigs Seegeltung erlebt.
Wir müssen — das liegt wohl in der Luft — an den Danziger Kapitän Paul Beneke denken, „en hart Sevogel“, wie ihn die alten Chroniken nennen, der auch eines schönen Tages — es war im Jahre 1473 — hier anlegte mit seinem großen Kraweel, dem stolzen „Peter von Danzig“, und sich bei den Ratsherren von Kaperfahrt auf England zurückmeldete. Diesmal brachte er besonders fette Beute mit. Er hatte das berühmte Gemälde von Hans Memling, „Das Jüngste Gericht“, auf einer englischen Galeere, die von Shiro nach London segelte, angesichts der englischen Küste gekapert. Unter Glockengeläut hielt er seinen Einzug in die Stadt. Es war der einzige Seekrieg, den eine deutsche Macht vor 1914 mit England geführt hat. Danzig bewahrt noch heute in der Dorotheenkapelle der Marienkirche das kostbare Beutestück als Zeichen des Siegen.
Am nächsten Tage lassen wir unser Mikrofon durch die Stadt wandern und machen einen größeren Bericht von der Stimmung und Vorfreude unter der Bevölkerung. Wir fahren auch nach Zoppot hinaus.
Es ist der 30. August.
Das Weltbad ist von seinen Gästen verlassen. Nur ein paar Eingesessene lustwandeln auf den prächtigen, noch im vollen Blumenschmuck der Sommersaison prangenden Promenaden- und Brückenanlagen. Leer sind die großen Hotels, ausgestorben die Gaststätten, von Menschen verlassen der Strand, zu dem wir hinuntergehen.
Wir sieben neben einem der herrenlosen Strandkörbe und blicken nach Norden, dorthin, wo Gdingen liegt, wo der Pole sitzt.
Seltsam ist die Stille, die Einsamkeit an dieser Stelle, wo noch vor wenigen Tagen Tausende von Badegästen aus aller Welt sich sorglos ihres Lebens freuten.
Spiegelglatt liegt die See, eingefasst vom Saum der weiten Bucht, wie in einer Schale.
Heiß, wie alle Tage, brennt die Sonne.
Da drüben also sitzt der Pole.
Wir blicken lange herüber.
Fahren da nicht Schiffe? Eins, zwei, drei hellgrau gestrichene Kriegsfahrzeuge?
Patrouillieren die Polen ihr Hoheitsgebiet ab?
Sie wenden, fahren in Kiellinie weiter hinaus auf die hohe See — verschwimmen im Sonnendunst — entschwinden unsern Blicken.
Ohne es zu wissen, hatten wir, wie wir nachher erfuhren, die drei polnischen Zerstörer „Grom“, „Blyskawica“ und „Bursza“ auf ihrer Flucht aus der Danziger Bucht zum letzten Male gesehen. Nur einer, der Zerstörer „Wicher“, war zurückgeblieben. Die andern nahmen Höchstfahrt laufend Kurs auf den Sund und verließen bald nach Mitternacht die Ostsee, um sich in den Schutz der englischen Flotte zu begeben. — Was uns hoffen lässt, dass sich ihr Schicksal doch noch erfüllen wird, nämlich ebenso vernichtet zu werden wie alle übrigen polnischen Kriegsfahrzeuge, die die Polen in der Danziger Bucht beließen.
Die zwischen Zoppot und Gdingen verkehrenden polnischen Autobusse haben am gestrigen Nachmittag den Verkehr eingestellt. Offenbar sind die Wagen von polnischer Seite für militärische Zwecke beschlagnahmt worden. Auch die zwischen Danzig und Gdingen über Zoppot fahrenden Züge werden von den Polen nicht mehr ordnungsmäßig bedient. Sie kommen von Gdingen mit verringerter Wagenzahl und defekten Lokomotiven zurück. Der D-Zug nach Berlin ist am heutigen Vormittag von den polnischen Staatsbahnen nicht übernommen worden. Die Polen haben weder Lokomotive noch Begleitpersonal gestellt. Man rechnet also drüben bereits fest mit dem Ausbruch der .Feindseligkeiten. Danzig ist bereit!
*
Noch ein Tag des Wartens vergeht. Am 31. abends sitzen wir um den Lautsprecher und vernehmen, dass auch das letzte großmütige Angebot des Führers von den Polen in den Wind geschlagen worden ist. Sie wollen es also auf den Krieg ankommen lassen!
Wir sitzen erregt zusammen — Berichterstatter aller Herren Länder, Männer der Presse, der Wochenschauen, Bildreporter — alle, die immer dabei sind, wenn etwas in Europa passiert. Nur der Engländer fehlt. Er ist heute abgereist!
Wir kommen spät ins Bett, denn von Minute zu Minute wartet man auf neue Nachrichten. Die Entscheidung liegt in der Luft und kann jeden Augenblick fallen.