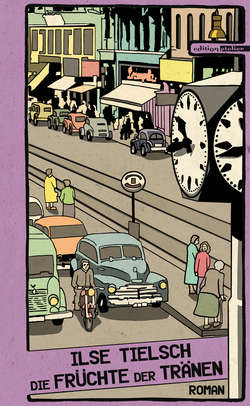Читать книгу Die Früchte der Tränen - Ilse Tielsch - Страница 10
4
ОглавлениеDer fünfte Winter nach dem Ende des Krieges war kalt. Eine böse Zeit für jene, die noch in Notunterkünften saßen, keine warme Kleidung, keine festen Schuhe hatten, kaum Brennmaterial und die nötigsten Lebensmittel kaufen konnten. Zwei Jahre nach der Währungsreform war im Westen Deutschlands die Rationalisierung der Lebensmittel zum großen Teil aufgehoben worden, trotzdem spürte man den Mangel überall, denn es fehlte an Arbeitsplätzen und damit auch an Geld. Ein Ei kostete achtzehn Pfennig, die Butter konnte man um zwei Mark fünfzig für das halbe Kilo kaufen, ein Kilo Brot kostete eine Mark. Hedwig hatte mit hundertvierzig Mark im Monat für die Familie auszukommen. Sie war eine der 469.000 Kriegerwitwen, die zu versorgen waren.
Obwohl man den Flüchtlingen und Vertriebenen in Deutschland Renten und Unterstützung gewährte, konnten diese, bei den herrschenden Verhältnissen, nur niedrig sein. Auch die Arbeitslosigkeit war im Steigen begriffen. Im deutschen Bundesgebiet erreichte die Zahl der Menschen, die ohne Beschäftigung waren, die Zweimillionengrenze, in Nürnberg allein waren 13.180 Arbeitslose gezählt worden, die Schlangen vor den Arbeitsämtern wurden von Tag zu Tag länger. Von den Unternehmern wurden nur voll einsatzfähige Arbeitskräfte beschäftigt, Angestellte, die auf Grund ihres schlechten Gesundheitszustandes den Anforderungen nicht entsprechen konnten, wurden in den meisten Fällen entlassen. Ständig kamen neue Arbeitsuchende hinzu, Heimkehrer, illegale Grenzgänger, auf verschiedenen Wegen Zugezogene. Die allgemeine Not war groß, beinahe katastrophal. Trotzdem schrieb die New York Times, sich auf Berichte aus Frankfurt berufend, die Deutschen äßen jetzt besser, als sie je nach dem Krieg gegessen hätten, und sie hätten vor, IM NEUEN JAHR ZU GUT ZU LEBEN. Die Administratoren, hieß es, seien besorgt, daß die deutsche Bevölkerung sich AN EIN ZU UMFANGREICHES MENU GEWÖHNEN könnte und daß es eines Tages zu neuerlichen Einschränkungen kommen würde, etwa dann, wenn die mögliche Einstellung der amerikanischen Hilfe mit einer schlechten Ernte zusammenfiele. Dies würde dann EINE RÜCKKEHR ZUM MAGEREN TISCH bedeuten.
(Hier ist daran zu erinnern, daß Annis Großeltern, Josef und Anna, mit ihrer Tochter Hedwig und deren beiden Kindern Heidi und Günter nach ihrer Vertreibung von Haus und Hof und einer Zwischenstation im nördlichen Niederösterreich in ein sehr kleines Dorf bei Erlangen gebracht wurden, wo sie in einem Häuschen zwei Dachkammern bewohnten. Heidi und Günter erklären, daß der Tisch der Familie in jenen Jahren mehr als mager gedeckt gewesen sei. Sie waren zu diesem Zeitpunkt, von dem hier die Rede ist, sieben und zehn Jahre alt und können sich nicht daran erinnern, damals GUT UND REICHLICH gegessen zu haben.
Präsente, die man den Großen machte, spiegeln die Lage der Zeit deutlicher als der zitierte Zeitungsbericht. Zum vierundsiebzigsten Geburtstag des Bundeskanzlers Adenauer stellten sich die Länder mit Lebensmittelgeschenken ein. Bayern soll sechs Hühnereier, Schleswig-Holstein ein halbes Pfund Butter gespendet haben.)
Der Winter also war kalt, und die Familie fror, obwohl Großvater Josef Holz aus dem Wald heranbrachte und der kleine eiserne Ofen, der in einer der beiden Kammern stand, geheizt werden konnte. Die Wände blieben kalt, und durch die Fugen der klapprigen Fenster pfiff ein eisiger Wind.
Großmutter Anna war schon mehrmals schwer krank gewesen, sie war über siebzig Jahre alt und geschwächt. Hedwig hatte die Sorge um die tägliche Nahrung für die fünfköpfige Familie und zu ihrem Kummer um den in Rußland verschollenen Mann Richard auch noch jene um die kranke Mutter zu tragen.
Die Schwägerin in Wien versuchte zu helfen, sie stellte ein Weihnachtspaket zusammen und gab es einer Frau mit, die zu Verwandten nach Nürnberg fuhr. Irgendwann um die Weihnachtszeit kam dann der von der Zensurstelle geöffnete und wieder verklebte Brief, in dem Hedwig mitgeteilt wurde, daß das Paket unter einer genannten Adresse in Nürnberg zu holen sei.
Hedwig war bis zu diesem Zeitpunkt noch nie in der nahen Stadt Nürnberg gewesen, die Gelegenheit hatte sich nicht ergeben, jetzt mußte sie diese Fahrt unternehmen, obwohl die Mutter wieder erkrankt war und sie dringend gebraucht hätte. Das Paket und sein Inhalt waren wichtig, und sie entschloß sich zur Reise.
Sie zog den Mantel an, den eine befreundete Frau ihr aus einem alten Männerrock und einer Jacke genäht hatte. Nein, einen richtigen Mantel habe sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehabt.
(Wenig später wurde in Nürnberg ein Winterschlußverkauf eröffnet, in den zwischen den Ruinen errichteten Behelfsläden gab es Damenwintermäntel aus umgearbeiteter US-Ware, BESTE, STRAPAZIERFÄHIGE QUALITÄT, mit Webpelzfutter, sie kosteten fünfundzwanzig bis dreißig Mark.
Das hätte mir auch nichts genützt, auch wenn ich es gewußt hätte, sagt Hedwig. Soviel Geld habe ich für mich nicht ausgeben können, soviel Geld habe ich gar nicht gehabt.
Arbeitsjacken aus Wolle kosteten drei Mark fünfundsechzig, Gummiüberschuhe drei Mark fünfzehn bis vier Mark fünfzig. Die Ware war liegengeblieben, die Leute hatten sie nicht gekauft. Überall machte sich Geldnot bemerkbar.
Mit der Währungsreform, heißt es allgemein, habe der Konsum begonnen. Die Leute hätten die Geschäfte gestürmt und gekauft, was kaufbar gewesen sei.
Das ist ein Märchen, sagt Hedwig, davon sind nur sehr wenige betroffen gewesen. Die meisten Leute sind vor den Geschäften gestanden und haben in die Auslagen geschaut und die Sachen bestaunt, die es schon wieder gegeben hat. Wirklich kaufen konnten die wenigsten. Alles spricht von dem Aufschwung, sagt ein Geschäftsmann, der Ende der fünfziger Jahre nach Amerika ausgewandert ist, niemand spricht von der FLAUTE nach der Währungsreform.
Das zu Unrecht erworbene Geld der Schwarzhändler und Schieber war abgeschöpft worden, das durch Schwarzhandel und Betrug erworbene Geld, Haufen von Papiergeld waren zu wenigen Scheinen geschmolzen oder zu einem Häuflein Münzen, die Währungsreform hatte die neuen Reichen wieder arm gemacht, aber die Armen waren dadurch nicht reicher geworden.)
Hedwig bestieg den ungeheizten Zug, der sie nach Forchheim bringen würde, sie hockte frierend auf der Holzbank und sah die Landschaft vorüberziehen, die sie kannte. Vier Jahre lebte sie mit den Ihren nun schon in dieser Gegend, in Forchheim war sie wiederholt gewesen, auch Erlangen kannte sie schon, Nürnberg noch nicht. Ein Jahr hatte sie in Österreich verbracht, hatte dann weiterziehen müssen, zum zweitenmal vertrieben, zum zweitenmal gezwungen, sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen, schon Gewohntes aufgeben zu müssen, eine junge Frau, die Kinder geboren und wieder begraben hatte. Ein kleines Grab war auf einem niederösterreichischen Dorffriedhof zurückgeblieben. Ihr Mann Richard war aus Rußland nicht wiedergekommen, sie hatte sich dazu entschließen müssen, die Todeserklärung zu beantragen, Kriegerwitwen stand eine zusätzliche Rente zu, sie hatte das Geld gebraucht, um die beiden ihr noch verbliebenen Kinder und die alten Eltern ernähren zu können, obwohl sie insgeheim immer noch hoffte, Richard würde eines Tages wiederkommen, über das Rote Kreuz oder über die in Wien lebende Schwester ihren Aufenthaltsort erfahren. Immer wieder hatte sie sich in Tagträumen ausgedacht, wie er eines Tages vor der Tür stehen, wie sie ihm öffnen würde, wie die Kinder auf ihn zustürzen würden, wie er sie, Hedwig, in die Arme schließen würde. Immer wieder hatte sie in den Nächten von ihm geträumt, eine junge Frau, die ohne ihren Mann zu leben gezwungen war, die sich sehnte und wach lag, wenn die Alten und die Kinder schon in ihren Betten schliefen, eine immer noch schöne junge Frau, die trotz ihrer Armut nicht hätte allein bleiben müssen, es jedoch blieb, weil sie nicht aufhören konnte, auf ein Wunder zu hoffen.
In Forchheim hielt der Zug, Hedwig stand längere Zeit frierend auf dem Bahnsteig, stieg dann in einen anderen Zug um, saß wieder auf einer Holzbank im ungeheizten Abteil, kam endlich in Nürnberg an.
Hatte sie sich vor der Fahrt in die Stadt, von der sie schon so viel gehört hatte, die sie von Bildern und Büchern her kannte, gefürchtet oder hatte sie sich darauf gefreut? Sollte sie diese Fahrt mit dem Gefühl angetreten haben, vom Dorf in eine große Stadt zu fahren, in eine stark zerstörte, aber immerhin von Leben erfüllte Stadt, sollte sie sich, trotz der quälenden Sorgen, auf eine Abwechslung gefreut haben, dann jedenfalls wurde sie grausam enttäuscht.
Als sie den Zug verlassen hatte, sah sie Ruinen, wohin sie auch blickte, sauber zur Seite geräumten, aber in hohen Haufen liegenden Schutt. Aus den Trümmern ragten bizarre Reste von Türmen, Mauern, Gewölben. Nackte Fensterbogen sah sie, mit schwarz verkohlten Stuckrosetten, einzelne, noch erhalten gebliebene Schornsteine ragten wie Nadeln empor, von Fensterlöchern durchbrochenes Mauerwerk hob sich gegen den Winterhimmel ab. Hedwig hatte viel über die zerstörten Städte Deutschlands gehört und gelesen, überall war darüber geschrieben und auch gesprochen worden, so aber hatte sie sich die Wirklichkeit doch nicht vorgestellt. Auch in B. waren zu Kriegsende Bomben gefallen, auch dort hatten Häuser gebrannt, auch die Stadt Wien hatte furchtbare Zerstörungen aufzuweisen gehabt. Aber das, sagt sie, muß man erlebt haben, man muß es gesehen haben, um zu wissen, wie es wirklich gewesen ist.
Sie sei, sagt Hedwig, immer weitergegangen, wie von selbst hätten sich ihre Füße bewegt. Auf einem freien Platz, mitten unter den Trümmern, sei auf einem Sockel eine dunkle Figur in wallendem Umhang gesessen, in der einen Hand einen Schreibblock, in der anderen eine Feder, als sie nahe genug herangekommen sei, habe sie das Denkmal von Hans Sachs erkannt. Ob es unversehrt geblieben war oder ob man es inzwischen wieder aufgestellt hatte, kann sie nicht sagen. Der Anblick aber habe sie verstört und traurig gemacht. Eine ganze Weile stand Hedwig vor dem Denkmal, dann ging sie weiter. Aus den Kellern der zerstörten Häuser lugten Ofenrohre hervor, sie schloß daraus, daß in den erhalten gebliebenen Kellerräumen Menschen lebten, wohnten und schliefen. Da und dort sah sie einen Mann, eine Frau aus einer dieser unterirdischen Höhlen hervorkommen oder darin verschwinden, die Vorstellung HÖHLENBEWOHNER drängte sich ihr auf, sonst begegneten ihr nur wenige, in der Hauptsache ältere Leute. Mühsam fragte sie sich zu der von der Schwägerin angegebenen Adresse durch, stand schließlich vor einem zur Hälfte zerstörten Haus, konnte sich nicht vorstellen, daß in der erhalten gebliebenen Hälfte noch Menschen lebten, betrat dann doch zögernd den Flur und ging die Treppe hinauf, fand schließlich die Tür, an der ein Schild mit dem angegebenen Namen befestigt war. Die Wohnung, die sie betreten habe, sagt Hedwig, habe aus einem einzigen Zimmer bestanden, das nur von der Mauer des Treppenhauses und von den Außenmauern gestützt worden sei, die weiteren Räume hätten gefehlt. Sie habe in diesem Zimmer das Gefühl gehabt, in der nächsten Minute durch den Fußboden durchzubrechen, abzustürzen und in die Tiefe gerissen zu werden. Sie habe Angst gehabt. Sie habe das Paket in Empfang genommen, sich bedankt, sei dann sehr rasch wieder gegangen, sei mit dem Paket in der Hand, das ziemlich schwer gewesen sei, ziellos durch die Straßen gelaufen und habe nach der Innenstadt gesucht, irgendwo zwischen den Ruinen habe sie einen Polizisten getroffen und ihn nach dem Weg gefragt.
Können Sie mir den Weg in die Innenstadt zeigen, fragte Hedwig.
Der Polizist sah sie erstaunt an. Sie sind ja hier mitten in der Innenstadt, sagte er. Das hier ist die Nürnberger Innenstadt.
Er beschrieb mit dem Arm einen Kreis und wies auf die umliegenden Ruinenfelder. Sie befinden sich, sagte er, mitten im Zentrum von Nürnberg. Oder, setzte er hinzu, in dem, was das Zentrum von Nürnberg einmal gewesen ist.
Sie habe, sagt Hedwig, plötzlich furchtbar gefroren. Das war eine Kirche, sagte der Polizist und wies mit der Hand auf einen Trümmerhaufen, aus dessen Mitte ein Steinblock ragte, aus dem Steinblock ein großes, schwarzes Kreuz.
Nur schwarz berußte Trümmer, sagt Hedwig, darauf das Kreuz, sie habe gar nicht daran gedacht, daß dies einmal eine Kirche gewesen sei, aber der Anblick dieses einsam ragenden Kreuzes über den Trümmern habe sie mit einem furchtbaren Entsetzen erfüllt. Trotz allem, was sie selbst habe erleben müssen, was sie vorher schon gesehen und erlebt hatte, sei dies eine ihr bis dahin noch unbekannte Art des Entsetzens gewesen, von dem sie ergriffen worden sei.
Ist Ihnen schlecht? fragte der Polizist und blickte Hedwig erschrocken an.
Nein, sagte Hedwig, ihr sei nicht schlecht, nur sehr kalt.
Sie habe am ganzen Körper gezittert, aber nicht nur wegen der äußeren Kälte, eher wegen jener, die von innen gekommen sei. Sie sei sehr schnell davongegangen, sie habe das Paket fest an sich gedrückt, sie sei fast gelaufen, die kalte Nässe sei durch ihre schon schäbigen Schuhe gedrungen, sie habe noch zwei- oder dreimal nach dem Weg fragen müssen, obwohl das auch nicht leicht gewesen sei, weil sie nur so wenige Leute getroffen habe. Schließlich sei sie auf dem Bahnhof angekommen, habe sich dort auf einen Stein gesetzt und geweint. Nein, daran, was in dem Paket gewesen sei, erinnere sie sich nicht. Wahrscheinlich Lebensmittel, sagt sie, obwohl die Schwägerin in Wien ja auch nicht viel gehabt hat, und wahrscheinlich einige Kleidungs- oder Wäschestücke für die Kinder. Sie seien ja damals über jedes Stück, das man ihnen geschenkt habe, glücklich gewesen.
Aber monatelang habe sie von der zerstörten Stadt Nürnberg geträumt, in diesen Träumen, aus denen sie immer wieder aufgeschreckt sei, in Schweiß gebadet, dabei zitternd vor Kälte, sagt Hedwig, in diesen Träumen habe sich die Zerstörung jedoch später nicht mehr ausschließlich auf Nürnberg bezogen, schließlich sei der Begriff Nürnberg darin überhaupt nicht mehr vorgekommen, sie habe nur endlose Trümmerwüsten gesehen, zerstörte Häuser und Schuttberge, sie habe geträumt, daß sie zwischen diesen Trümmern und Schuttbergen hindurchlaufen müsse, sie habe sich dabei sehr allein gefühlt, von allen verlassen, sie habe zwischen den Ruinen und in den Kellerlöchern nach ihren Kindern gesucht und sie nicht gefunden, habe auch nach ihrem Mann Richard gerufen, und immer wieder habe sie diesen Steinhaufen gesehen und das große, schwarze Kreuz darauf. Immer wieder dieses Kreuz zwischen den Trümmern, sagt Hedwig, diese Träume hätten sie lange verfolgt und ganz krank gemacht.
(Fünf Jahre vorher, am 2. Jänner 1945, an einem schneefreien, diesigen Wintertag, hatte der schwerste Angriff auf die Stadt Nürnberg stattgefunden, er dauerte dreiundfünfzig Minuten und forderte zweitausend Menschenleben, Hunderttausende wurden obdachlos. Etwa tausend Flugzeuge warfen rund eine Million Stab- und Phosphorbomben, etwa hundert Minen und sechstausend Brandbomben ab. In der bis dahin schon schwer getroffenen Stadt lebten, wie man anhand der Lebensmittelkarten errechnet hatte, die ausgegeben worden waren, nur noch 259.000 Menschen, von denen allerdings auch schon viele in die umliegenden Landgebiete gezogen waren. Die Tage und Nächte seit dem Weihnachtsfest waren ruhig verlaufen, man hoffte schon auf ein baldiges Ende des Krieges, wenn es auch ein Ende mit Schrecken sein würde. Wohl hatte es am Nachmittag des 2. Jänner dreimal Voralarm gegeben, aber als die Dämmerung hereinbrach, waren die Straßen trotzdem belebt, die Straßenbahnen wegen des Schichtwechsels in den Fabriken überfüllt, auch zu den Kinos und zum Opernhaus strömten die Menschen, die Abendvorstellungen waren wegen der drohenden Alarmgefahr vorverlegt worden. Gegen achtzehn Uhr wußte man bereits, daß große Bomberverbände im Anflug auf Hamburg und Aachen waren. Dann schwebten CHRISTBÄUME über der Stadt, in der Mitte einer in grüner Farbe, die Türme von Sankt Lorenz und der Kaiserburg, die Giebel der noch unversehrten Fachwerkhäuser waren in fahles Licht getaucht, im Südosten erglänzte der grelle Blitz einer Mine, gefolgt von einem dröhnenden Donnerschlag, dann kamen die Bomber.
Anfangs sollen sie nur aus Südost gekommen sein, dann aus Ost und West, schließlich aus allen Himmelsrichtungen. Die erste Bombe fiel siebenundvierzig Minuten nach achtzehn Uhr, dreiundfünfzig Minuten später war alles vorbei. Eine riesige Wolke aus Ruß und Rauch hing über der Altstadt, die den Flammen rettungslos ausgeliefert war. Es war unmöglich, das Feuer einzudämmen, denn es herrschte totaler Wassermangel. Über hunderttausend Menschen, die das Inferno lebend überstanden hatten und obdachlos geworden waren, stürmten am nächsten Tag die wenigen intakt gebliebenen Bahnhöfe der Umgebung und versuchten, im umliegenden Land ein Obdach zu finden.
Fünf Tage nach der Katastrophe fiel Schnee in dichten Flocken und legte eine weiße Decke über Nürnbergs zerstörte Altstadt und über die Toten, die unter den Trümmern lagen.)
Hedwig erreichte ihr Dorf in den Abendstunden, müde und deprimiert ging sie den Weg vom Bahnhof hinauf, die Straße war mit Eis bedeckt, auch der Weiher unterhalb des Schlößchens war mit einer dicken Eisschicht überzogen. Nur wenige Leute hatten wie sie den Zug verlassen und strebten jetzt ihren Häusern und Wohnungen zu. Sie merkte erst jetzt, wie schwer das Paket war, das die Schwägerin geschickt hatte, sie merkte erst jetzt, daß ihre Füße in den nassen Schuhen vor Kälte gefühllos geworden waren, daß sie Hunger hatte. Sie schleppte sich bis zu dem Haus, in dem Eltern und Kinder auf ihr Heimkommen warteten, öffnete die Haustür vorsichtig, um die Hausleute nicht auf ihr Kommen aufmerksam zu machen, und ging dann leise die Treppe hinauf. Sie hörte die Stimmen ihrer Kinder und empfand plötzlich etwas wie Dankbarkeit dafür, daß sie ein geheiztes Kämmerchen betreten durfte, so elend es auch war, daß sie nicht in einem Kellerloch zwischen Ruinen hausen mußte.
Es hat Leute gegeben, denen es noch schlechter gegangen ist als uns, sagt Hedwig, und das sind nicht einmal Flüchtlinge oder Vertriebene gewesen. Auch hier hat es so viele gegeben, die alles verloren haben wie wir, sagt sie. NUR DIE HEIMAT HABEN SIE NICHT VERLOREN.
Zwölf Millionen Heimatvertriebene stellten nicht nur ein deutsches, sie stellten ein internationales Problem dar, mit dem man sich zu beschäftigen hatte. Zwölf Millionen Heimatvertriebene waren eine Zahl, mit der man rechnen mußte und mit der man auch rechnete, eine Menge, die zu einer Macht werden konnte, auf deren Bedürfnisse einzugehen, die zu respektieren war. Zwölf Millionen, man hätte sie sicherlich auch gerne aus dem eigenen, mit Obdachlosen und Arbeitslosen überfüllten, armen, zerstörten Land wieder in ihre Heimatgebiete zurückgebracht, wenn dies möglich und menschlich vertretbar gewesen wäre. Hat man dies in Deutschland, fünf Jahre nach dem Ende des Kriegs, noch für möglich gehalten, und wenn dies so gewesen sein sollte, hat man ihnen Hoffnungen gemacht oder hat man sie in der Hoffnung auf eine Rückkehr bestärkt?
Josef und Anna, auch Hedwig verfolgten die Tagespolitik, aber auch und vor allem alle Berichte zum Flüchtlingsproblem in der Zeitung, die in ihrem Dorf gekauft und gelesen wurde, dem ERLANGER TAGEBLATT, der HEIMATZEITUNG FÜR ERLANGEN UND UMGEBUNG. Sie konnten dieser Zeitung am 10. Oktober desselben Jahres über den am vorhergegangenen Sonntag im ganzen Bundesgebiet abgehaltenen TAG DER HEIMAT einen genauen Bericht entnehmen, Zitate aus den bei diesem Anlaß an vielen Orten gehaltenen Ansprachen und Reden waren wiedergegeben.
EINE ENTWURZELTE UND HOFFNUNGSLOSE BEVÖLKERUNG VON 12 MILLIONEN IN DER MITTE EUROPAS WIRD IMMER EIN ELEMENT DER UNSICHERHEIT UND UNRUHE DARSTELLEN, UND ES GEHT NICHT AN, SO ZU TUN, ALS OB DIESES PROBLEM ÜBERHAUPT NICHT EXISTIERE. Dies hatte der Kirchenpräsident der evangelischen Landeskirche, Martin Niemöller, in einer Rede gesagt, die auch vom australischen Rundfunk ausgestrahlt worden war, das Erlanger Tageblatt hatte sie in Auszügen abgedruckt. AUCH WENN ES KEINERLEI TENDENZEN ZUM KOMMUNISMUS BEI DIESEN LEUTEN GIBT, WERDEN SIE DOCH IMMER EINE NEIGUNG ZUM EXTREMISMUS HABEN.
Wir sind keine Extremisten, ereiferte sich die kleine, zarte Großmutter Anna, wir sind friedliche Leute. Auch wenn es uns jetzt schlecht geht, auch wenn wir in Not sind, werden wir keine Unruhe stiften.
(Sie sollte recht behalten. Was man befürchtet hatte, daß die Vertriebenen einen Unruheherd in Europa darstellen könnten, trat nicht ein.)
In Düsseldorf, lasen Josef und Anna in ihrer Zeitung, habe der Bundesminister für Flüchtlingsfragen erklärt, daß er für eine friedliche Rückführung der Ostvertriebenen arbeiten würde.
Der Präsident des Deutschen Bundesrates bezeichnete die Wiedergewinnung des deutschen Ostens als eine Angelegenheit der gesamten europäischen Politik und Zivilisation.
Ein Redner der Sudetendeutschen Landsmannschaft forderte die Rückgabe des Sudetenlandes an Deutschland auf Grund des 1938 auch von England und Frankreich sanktionierten Münchner Abkommens.
In Dortmund sagte ein Staatssekretär, NICHT AUSWANDERN, SONDERN RÜCKWANDERN sei die Parole. Nur in Stuttgart betonte ein Redner aus Riga, die Flüchtlinge müßten sich von ihren Träumen befreien und in den Westzonen eine Adoptivheimat schaffen.
Es gibt nur eine Heimat, sagte Josef, eine Adoptivheimat gibt es nicht.
Du wirst sehen, sagte seine Frau Anna, bald fahren wir wieder in die Heimat zurück.
Der amerikanische Hochkommissar McCloy, stand in der Erlanger Zeitung, habe zum Problem der Heimatvertriebenen gesagt, wenn man in dieser Beziehung geschickt vorginge, könnte diese Massenwanderung eines Tages zu einer wirtschaftlichen Blüte für Deutschland führen, wie sie Amerika bei der Einwanderung der Pioniere erlebt habe.
Das ist auch wahr, sagte die kleine Großmutter Anna. Unsere Leute sind fleißig, das wissen die Amerikaner, viele von ihnen stammen ja selbst von Sudetendeutschen ab.
Sie dachte an ihren Bruder Ferdinand, der zu Beginn des Jahrhunderts nach Amerika ausgewandert, von dort jedoch niemals zurückgekommen war.
Einmal, sagte die kleine Großmutter, ist man drüben vor der Entscheidung gestanden, ob Deutsch oder Englisch die Sprache der Vereinigten Staaten werden soll, so viele Deutsche hat es damals dort als Einwanderer gegeben. Das hat man bis heute nicht vergessen, das kann man ja gar nicht vergessen haben. Unsere Leute haben Amerika mit aufgebaut, wie es heute ist, sie könnten auch hier in Deutschland viel leisten, aber man gibt ihnen ja nicht die Gelegenheit dazu.
Wenn man endlich erkannt haben wird, daß das falsch gewesen ist, dann werden wir längst nicht mehr hier sein. Aber, sagte die kleine Großmutter Anna, in der Heimat wird es für uns auch sehr viel Arbeit geben, wenn wir zurückkommen. In der Heimat wird auch viel wieder aufzubauen sein.
Die Sehnsucht der Alten war groß, und die Heimat war weit entfernt, nur wenige, die aus der Umgebung von B. stammten, hatte es in die Föhrenwälder rund um Erlangen verschlagen. Sie legten an Sonntagen oft weite Fußwege zurück, um einander beim Kirchgang zu treffen. Nach dem Gottesdienst standen sie dann auf der Straße beisammen und besprachen die politische Lage. Manchmal hatte auch der eine oder der andere einen Brief erhalten, in welchem Wissenswertes aus anderen Landesteilen oder über in anderen Gegenden Deutschlands lebende Bekannte mitgeteilt wurde, ein Kind war geboren worden, ein Verschollener hatte sich über das Rote Kreuz gemeldet, ein Mädchen aus einer heimatvertriebenen Familie hatte einen einheimischen Mann geheiratet, dies allerdings kam selten vor, noch seltener gab man einem der besitzlosen Vertriebenen ein einheimisches Mädchen zur Frau. Erst 1955 stellte man anhand von Statistiken fest, daß die Neigung der Vertriebenen, untereinander zu heiraten, nachgelassen habe, daß die Verschwägerung zunehme, daß DIE ZEIT MITHELFE, DEN STROM DES ZUSAMMENLEBENS ZU VERBREITERN. Man zog zu diesem Zeitpunkt die Folgerung, daß das soziologische Aufgehen der Vertriebenen in die größere Gruppe des einheimischen Gesamtvolkes als allmählicher Prozeß nicht mehr aufzuhalten sei.
Wenn ich an jene Zeit zurückdenke, sagt Heidi, wenn ich mich daran erinnere, wie der Großvater bei jedem Wetter den weiten Weg nach Röttenbach zur Kirche gegangen ist, um die Leute, die er gekannt hat, zu treffen und mit ihnen zu sprechen, wenn ich mich daran erinnere, wie sie bei jedem Wetter vor der Kirche beisammengestanden sind, auch wenn es geregnet hat, auch im Winter, wenn es sehr kalt gewesen ist, dann verstehe ich die Fremdarbeiter, die sich auf den Bahnhöfen treffen. Weil sie miteinander in ihrer Sprache reden wollen, weil sie Sehnsucht nach ihren Heimatländern haben. Gerade wir Heimatvertriebenen, sagt Heidi, die sich heute als Nürnbergerin fühlt, gerade wir, die wir unter der Fremdheit gelitten haben, als wir hierherkamen, müßten diese Leute besser als andere verstehen.