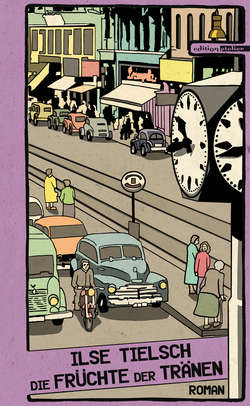Читать книгу Die Früchte der Tränen - Ilse Tielsch - Страница 11
5
ОглавлениеIch weiß nicht, was du dir vorgestellt hast, sagte Hedwig, als ich in ihrem Wohnzimmer in Nürnberg saß, aber was sollte diese Frau für ein Interesse daran gehabt haben, mit dir in Verbindung zu treten?
Ich hatte ihr von dem Telefongespräch in Waldkraiburg und von der ablehnenden Reaktion der Frau aus dem Adlergebirge erzählt.
Wenn es sich um eine nahe Verwandtschaft gehandelt hätte, sagte Hedwig, aber nur, weil diese Frau so heißt wie du?
Wahrscheinlich, sagte sie, ist sie mißtrauisch gewesen und hat überhaupt nicht verstanden, was du von ihr willst.
Ich weiß selbst nicht, was ich von ihr gewollt habe, sagte ich.
Alles, was du über die Landschaft und über die Leute aus dem Adlergebirge wissen willst, kannst du wahrscheinlich aus Büchern erfahren, sagte Hedwig. Man ruft keine wildfremden Leute an, wenn man keine guten Gründe dafür hat.
Da hast du wahrscheinlich recht, sagte ich.
Spurensuche, die Sucht, Altes und Gegenwärtiges zu einem Ganzen zu fügen, wie sollte ich das meiner Tante, wie sollte ich es mir selbst erklären?
Im Museum der Adlergebirgler, in Waldkraiburg, hatte ich alte Kalender gesehen, in einem dieser Kalender ein Kinderlied, ich hatte es wieder und wieder gelesen, der Leiter des Museums, der die Sammlung zusammengetragen hat, hat mir den Kalender geschenkt. Die Melodie, zu der es gesungen worden ist, kennt heute niemand mehr.
Schloof, Kendla, schloof,
dr Voatr hitt de Schoof,
schloof Kendla, sisse,
doas Schoof hoot weiße Fisse,
schloof ock, Kendla, lange,
dr Tuud hockt off dr Stange,
a hood a lemta Jackla oa
on schmeißt gebacken Bärna roa.
Hat dieses Liedchen, frage ich mich, das in einer Mundart abgedruckt worden ist, die niemand von den Jungen heute noch wirklich sprechen kann, Anna Josefa, die Großmutter meines Großvaters väterlicherseits, ihren zehn Kindern als Schlaflied vorgesungen? Hat ihr Sohn Josef es seinen eigenen Kindern aus dem Dorf Tschenkowitz nach Schmole mitgebracht, wo er Färber und Leinendrucker gewesen ist? Der Tod hockt auf der Stange und hat ein Jäcklein aus Leinen an, das in der alten Heimat gesponnen und gewebt worden ist, manche von denen, die heute auf dem Waldfriedhof liegen, sind noch in diesem Leinen begraben worden. Die Jungen aber kaufen ihre Hemden in bayrischen Geschäften, sie wissen nicht mehr, wie der Flachs auf den kargen Äckern ihrer Großeltern gediehen ist, wie er sich gegen den Spätsommer zu goldbraun färbte, wie die Körner der runden Samenkapseln schmeckten, wenn man sie aus der Kinderhand leckte. Aber auch meine Kinder wissen das ja nicht mehr.
Fünfzig Adlergebirgler liegen schon auf dem Waldfriedhof, früher hat man die Herkunftsorte auf die Grabsteine geschrieben, die Jungen tun das nicht mehr.
Ich, Anna, Urenkelin Josefs, der Färber in Schmole gewesen ist und ein Sohn Johann Wenzels aus Tschenkowitz war, versuche mir zu erklären, warum mich das mit Trauer erfüllt.
Heute interessiert sich niemand mehr für den anderen, sagte Hedwig, heute leben die Leute alle für sich, sie schließen sich ab, sie wohnen miteinander Tür an Tür und wollen doch nichts voneinander wissen. Früher ist das anders gewesen. Früher hat einer den anderen gebraucht, da war einer auf den anderen angewiesen. Es hat nicht so viele Einsame gegeben wie heute, weil einfach zu wenig Platz war, weil die Leute aneinander-gedrängt leben mußten, weil diese entsetzliche Wohnungsnot war.
Die Not überhaupt, sagte Hedwig, sie hat dazu beigetragen, daß die Menschen nicht so einsam wie heute gewesen sind. Ich meine die Zeit nach dem Krieg, sagte Hedwig. Das hat länger gedauert, als man es heute wahrhaben will, hier bei uns jedenfalls hat es sehr lang gedauert. Bis es erst einmal so weit gewesen ist, daß man von einem Dorf, in das man eingewiesen worden ist, in eine größere Stadt ziehen durfte. Bis man die Zuzugsgenehmigung bekommen hat. Und wenn man sie dann endlich hatte, wenn man sich einen Raum suchen durfte, in den man einziehen konnte, bis man dann einen solchen Raum überhaupt gefunden hat.
Uns ist das erst neunundfünfzig gelungen.
(Neunundfünfzig waren Großmutter Anna und Großvater Josef schon tot, in fremder Erde begraben, ohne die Heimat wiedergesehen zu haben.)
Der Mann, der uns damals zwei Zimmer in seiner Nürnberger Wohnung vermietet hat, ist freilich sehr einsam gewesen, sagte Hedwig. Sie erzählte mir die Geschichte von Karl Kodnik, der überallhin, wo es ihm möglich war, seinen Namen schrieb.
Auf jedes Ei, das er gekocht hat, sagte Hedwig, schrieb er: gekocht am soundsovielten, dann das Monogramm, K. K., Karl Kodnik. Neben den Lichtschalter schrieb er mit Tintenblei: nach rechts drehen. Karl Kodnik. Auf den Geschirrschrank schrieb er: Geschirr. Karl Kodnik. Wenn er ausging, legte er einen Zettel auf den Küchentisch: bin ausgegangen, Karl Kodnik. Überall schrieb er seinen Namen an, weil ihn sonst niemand geschrieben hat, sagte Hedwig, weil ihn auch niemand ausgesprochen hat, weil ihn niemand bei seinem Namen gerufen hat. Er hat keine Kinder gehabt, keine Verwandten oder Bekannten, er hat überhaupt niemals Post bekommen. Er hat mich oft mit allen möglichen Ausreden in der Küche zurückgehalten, nur um mit mir, der Flüchtlingsfrau, sprechen zu können. Er war schon sehr alt, aber das war nicht der Grund, er hat uns auch später noch, als wir ans andere Ende von Nürnberg gezogen sind, oft besucht, auch dann noch, als er nur noch auf Krücken gehen konnte.
Nachdem mir Hedwig die Geschichte von Karl Kodnik erzählt hatte, erzählte ich ihr die Geschichte des alten Schmieds von Mühlfraun. Als ich damit zu Ende gekommen war, weinte sie.
Du könntest mit dem Wagen nach Bubenreuth fahren, sagte Hedwig, das ist nicht weit von hier, gleich bei Erlangen, es wird dich interessieren. In Bubenreuth sind die Geigenbauer aus Schönbach zu Hause.
Nur versprich mir, daß du nicht wieder im Telefonbuch nach Verwandten suchst.
Im Egerland hatten wir keine Verwandten, sagte ich.
Auch die Geigenbauer von Schönbach im Egerland waren, wie die Adlergebirgler, auseinandergerissen, in verschiedene Richtungen verstreut worden. Auch sie brauchten erst wieder einen Ort, um sich zu sammeln. Sie waren aufeinander angewiesen, was die Arbeit betraf, in der alten Heimat hatten sie einander in die Hände gearbeitet, jeder war ein Spezialist auf seinem Gebiet gewesen, die Meistergeigen aber wurden von einem Geigenbauer in allen Teilen allein erzeugt.
Nun saßen sie in verschiedenen Gegenden Deutschlands, die Boden- und die Deckenmacher, die Boden-und Deckenleimer, die Schachtelmacher, die Korpusmacher, die Griffbretterzeuger, die Wirbeldreher und die Stegmacher, die Saitenspinner und die Bogenmacher, die Geigenbauer, welche die Teile zusammensetzten, die fertigen Instrumente zuletzt lackierten und polierten. Nur einen Teil von ihnen hatte es in ein Lager bei Erlangen verschlagen, dort saßen sie jetzt, fingen einzeln wieder in bescheidenstem Rahmen zu arbeiten an, hofften im übrigen, daß man ihnen die gemeinsame Ansiedlung eines Tages doch noch gestatten würde.
WIR BRAUCHEN KEINE DEVISEN, WIR BRAUCHEN UNSERE WIESEN, hatte man in dem Ort Möhrendorf gerufen, als in einer Gemeinderatssitzung die wirtschaftliche Bedeutung als Argument für eine mögliche Ansiedlung in die Waagschale geworfen worden war.
Seit Jahrhunderten hatten sie Geigen hergestellt, und sie waren für die Qualität ihrer Instrumente in der Welt bekannt und berühmt gewesen, nun standen sie als Bettler vor Leuten, die nichts von Geigen verstanden und zu denen ihr Ruf nicht gedrungen war. Niemand kümmerte sich um sie, man wies ihnen elende, halb verfallene Baracken zu, sie mußten die wertvollen Hölzer, die sie im Fluchtgepäck mitgenommen hatten, zur Ausbesserung der Löcher in den Barackenwänden verwenden.
WAS ABER EIN RICHTIGER GEIGENBAUER IST, DER LÄSST DAS GEIGENBAUEN NICHT, sagte der Bürgermeister von Bubenreuth, als ich in seinem Wohnzimmer saß. Er war, als er hierher kam, elf Jahre alt. Schon in den Baracken fingen sie wieder mit ihrer Arbeit an. In einem Stall schmiedete ein Werkzeugmacher aus Eisenstücken, die er gesammelt hatte, die ersten Werkzeuge. Tag und Nacht arbeitete er, es waren harte Jahre, ABER JETZT HABEN WIR WIEDER EIN DAHEIM, UND WIR SIND DANKBAR DAFÜR.
Nein, niemand wollte diese Flüchtlinge haben, niemand wollte sie aufnehmen, man verglich sie mit den Besenbindern eines Nachbardorfes, das war das Erbärmlichste, was an Vergleich möglich war, denn es bedeutete, daß sie nicht nur arm waren, sondern daß man ihnen nicht traute.
Scheinbar kleine Begebenheiten, die verletzt haben, sind im Gedächtnis geblieben. Wie die Einheimischen zum Beispiel bei den Fronleichnamsprozessionen in der Reihe aufgeschlossen haben, GROSSER GOTT, WIR LOBEN DICH, wenn sich ein Vertriebener einreihen wollte. WIR SIND MENSCHEN DRITTER KLASSE GEWESEN.
Die nur 695 Einwohner des Nachbardorfes Bubenreuth hatten damals einen klugen Bürgermeister, er schätzte die Situation richtig ein, die Bewohner seines Dorfes schlossen sich seiner Meinung an.
Ob es damit zu tun hatte, daß die Bubenreuther vielleicht musikalischer waren als die Bewohner der umliegenden Gemeinden? (Es ist immerhin vorstellbar, daß es so gewesen ist.) Oder haben sie nur die Argumente begriffen, mit denen man ihnen die Vorteile einer positiven Entscheidung dargelegt hat? (Auch wenn dies vorwiegend der Fall gewesen sein sollte, wären sie zu loben, denn sie haben zweifellos richtig entschieden.)
Großvater Josef, der eine besondere Beziehung zu Musik hatte und seine Flöte im Fluchtgepäck mitgenommen hatte, las die Berichte von der Grundsteinlegung zur neuen Siedlung in Bubenreuth, die am 20. Oktober 1949 stattfand und über die ausführlich geschrieben wurde, er schnitt sie aus dem Erlanger Tageblatt aus und bewahrte sie auf. Den Satz, der bei der Grundsteinlegung gesprochen wurde, las er den Seinen vor: GOTT ZUR EHRE, DEN GEIGENBAUERN ZUR FREUDE, ZUM GLÜCK FÜR BAYERN UND REICH.
Vergelt’s Gott, sagte die kleine Großmutter Anna gerührt, daß man unseren Leuten wenigstens erlaubt, hier zu zeigen, was sie können.
Die meisten der Vertriebenen aus den im Süden Mährens gelegenen Gebieten waren fromm, sie dankten ihrem Herrgott, wenn ihnen etwas Gutes widerfuhr.
Aber, fügte sie nachdenklich hinzu, was wird aus dieser Siedlung, wenn die Geigenbauer wieder nach Schönbach heimgekehrt sind?
(Am Beginn des großen WUNDERS trugen sich die kleinen Wunder zu, sie ereigneten sich, eines hier, eines dort. Die Not hatte in den aus ihrer Heimat Vertriebenen Energien freigesetzt, die dazu beitrugen, die Länder, in die man sie gebracht hatte, zu verändern. Ihre Kraft mischte sich unter die in diesen Ländern vorhandenen Kräfte. Mit dem verzweifelten Wunsch, eine neue Heimat zu schaffen, in der man wieder leben, in der man arbeiten konnte, halfen sie wesentlich mit, die Heimat der anderen, denen dieses Land gehörte, aus dem Schutt und aus den Trümmern zu graben. Dies ist einer der Gründe dafür, daß von den Anfängen heute immer noch gesprochen wird.)
JEDE GEIGE HAT EINEN ANDEREN KLANG. Das wußten die Schönbacher schon, als in Italien die berühmten Meister Amati, Stradivarius und Guanerius wirkten. Schon im 16. Jahrhundert wurden im Egerland Geigen gebaut, eine mehrjährige Wanderzeit war den Gesellen streng vorgeschrieben, sie vervollkommneten ihre Kunst bei den italienischen Meistern, der eine oder der andere von ihnen ist vielleicht in Italien geblieben, unter den Lautenmachern von Brescia und Bologna sollen Schönbacher Namen vorgekommen sein. Die älteste im Egerland hergestellte Bratsche, 1664 gebaut von Johann Adam Pöbel in Bruck, einem zur Pfarre Schönbach gehörigen Dorf, wird im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg aufbewahrt.
Durch den freundlichen Ort Bubenreuth bei Erlangen gehend, habe ich, Anna, die ersten Häuser gesehen, die dort gebaut worden sind. Ich bin im Wohnzimmer des Bürgermeisters gesessen, das zugleich als Arbeitszimmer gebaut worden ist, wie es daheim in Schönbach so üblich war, ich habe mir die Geschichte der Geigenbauer aus Schönbach erzählen lassen.
Dankbar gedenkt man dort der Leute, die damals geholfen haben. Immer wieder wird im Zusammenhang mit dem Bau der Siedlung der Name eines Landrats genannt, Höhnekopp habe er geheißen, er habe alles vorangetrieben und zustande gebracht. Auch der Name des Bürgermeisters von Altbubenreuth, Paulus, der ein großes Stück Grund zur Verfügung stellte und letzten Endes für die Ansiedlung war, ist unvergessen geblieben. Das Geld habe die St.-Josephs-Stiftung gegeben.
Der Bürgermeister von Bubenreuth ist Geigenbauermeister, seine Instrumente gehen nach England und Korea, nach Japan und in die Schweiz. Die Frau Bürgermeisterin ist perfekt im Lackieren. Und die Gitarren, die jener Meister baut, der mich durch das Museum führte, gehören zu den besten der Welt.
Noch vor Weihnachten neunundvierzig zogen die ersten Familien in die neu erbauten Wohnhäuser ein. Bald arbeiteten sie wieder, die Boden- und Deckenmacher lieferten die Böden und Decken, die Schachtelmacher leimten die Zwischenteile auf die Böden auf, die Korpusmacher fügten die Decken hinzu, die Griffbrett- und die Saitenhaltermacher, Hals- und Schneckenschnitzer, Wirbeldreher und Stegschnitzer lieferten die von ihnen hergestellten Teile, die Geigenbauer endlich fügten die Teile zusammen, jeder arbeitete in seinem eigenen Haus. Man baute auch das Cello, die Bratsche, den Streichbaß, die Laute, man baute auch Zupfinstrumente, vor allem die immer moderner werdenden Gitarren.
Ja, auch heute noch werden Geigen nach dieser alten Methode in Arbeitsteilung gebaut, man kann nach Bubenreuth fahren und den Handwerkern in ihren Werkstätten zusehen, das sind aber vor allem die Schülergeigen, die auf diese Weise entstehen.
Wer eine Meistergeige besitzen will, kauft sie bei einem Geigenbauermeister seines Vertrauens, direkt in Bubenreuth.
Sechzig Meister leben und arbeiten in Bubenreuth und in den nahe gelegenen Orten, auch die Bogenbauer gehören dazu.
Auch Yehudi Menuhin hat eine Meistergeige aus Bubenreuth gekauft.
Die Schönbacherstraße, die Sudetenstraße, der Werkstättenweg. Als ich, Anna, in Bubenreuth bei Erlangen war, marschierte abends ein langer Zug Männer und Frauen in egerländischer Tracht durch die Gassen hinaus aus dem Ort, um die Sonnenwende zu feiern. Ich blieb stehen auf einem kleinen, von Bäumen überschatteten Platz, eine riesige, uralte Eiche breitete ihre Äste, dort steht der Geigenbauer, wie einst in Schönbach, er steht auf einer steinernen Weltkugel, die auf steinernen Schnecken ruht, er hält die bronzene Geige nicht so hoch, wie sein Vorgänger in der alten Heimat, er blickt nicht so selbstsicher geradeaus ins Land hinein, er hat den Blick gesenkt und blickt versonnen auf das Instrument herab, das in seinen Händen liegt.
Hier ist meine Geige, scheint der Mann auf dem Denkmal in Schönbach zu sagen, ich habe sie für euch gebaut, euch zur Freude, spielt sie, tanzt zu ihrer Musik. Sein Nachfolger in Bubenreuth bei Erlangen scheint nicht an Tanz zu denken, ein inniger Ausdruck liegt über seinem Gesicht und in seiner Haltung. Hier ist meine Geige, scheint er zu sagen, ich gebe sie euch und vertraue darauf, daß ihr sie lieben werdet, wie ich sie liebe, die Arbeit an ihr hat mir Heimat gegeben in einem Land, in das ich als ein Fremder gekommen bin. Nicht alle Geigenbauer hat man aus Schönbach vertrieben, einige hat man nicht weggehen lassen, auch wenn sie lieber mit den anderen gegangen wären, man hat sie zur Weitergabe ihrer Kenntnisse gebraucht.
Das Schönbacher Geigenbauerdenkmal steht noch, sagte mir ein Mann in Bubenreuth.
Ob die Aufschrift darauf noch deutsch ist?
Das weiß ich nicht, sagte der Mann. Schönbach, das immer deutsch gewesen sei, heiße jetzt Luby. Das soll Zarge heißen, sagte er.
(Dej mi rot, dej mi blau, sollen die tschechischen Arbeiter in den ehemals deutschen Betrieben der Glasstadt Gablonz noch lange nach der Vertreibung der Deutschen gesagt, sie sollen die deutschen Worte für sich übernommen haben.)