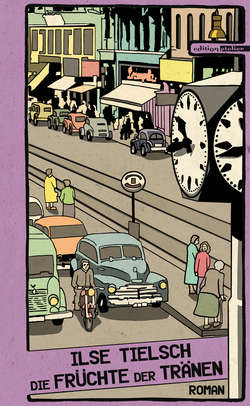Читать книгу Die Früchte der Tränen - Ilse Tielsch - Страница 12
6
ОглавлениеNatürlich werde ich kommen, hatte ich gesagt und Judiths Beerdigung in Nürnberg gemeint. Als wir beide den Telefonhörer wieder aufgelegt hatten, Christian in Frankfurt und ich in Wien, dachte ich über diese spontane Zusage nach. Jahrzehntelang hatte ich nichts mehr von Judith gehört, ich hatte nicht einmal ihre Adresse gekannt, sie hatte mir keine Briefe geschrieben. War das, was uns verbunden hatte, wirklich Freundschaft gewesen? Ich stellte mir diese Frage, und wie mir sofort bewußt wurde, stelle ich sie mir um mehr als dreißig Jahre zu spät. Plötzlich wußte ich, daß ich, was mein Verhältnis zu Judith betraf, mit dem Wort Freundschaft leichtfertig umgegangen war.
War Judith meine, war ich Judiths Freundin gewesen? Hatten wir nicht, wie dies häufig der Fall ist, in derselben Gegend verbrachte Kinderjahre, Gymnasialjahre an derselben Anstalt, gemeinsame Erinnerung an Orte, Begebenheiten und Personen, hatten wir dies alles nicht nur irrtümlich mit jener viel tieferen Art der Beziehung gleichgesetzt, die zwischen Menschen besteht, die einander in Freundschaft verbunden sind? Was hatte ich für Judith, was hatte Judith für mich getan, was wären wir, wäre dies notwendig geworden, bereit gewesen, füreinander zu tun? Waren wir nicht in vielerlei Hinsicht geteilter, ja gegensätzlicher Meinung gewesen? Was überhaupt hatten wir wirklich voneinander gewußt, wieweit hatten wir einander wirklich gekannt?
Nachdem Judith Wien verlassen hatte, war keine Nachricht mehr von ihr gekommen, sie hatte mit Absicht jede Verbindung, nicht nur zu mir, auch zu allen anderen, die sie gekannt hatte, unterbrochen. Ihr Vater war bald gestorben, wenige Monate nach ihrer Abreise starb auch die Mutter, andere Verwandte kannten wir nicht. Jene Cousine ihres Vaters, die der Familie nach dem Krieg in Wien Unterkunft gewährt hatte, war nicht mehr am Leben. Es gab niemanden, der uns Auskunft geben konnte.
Ich lag schlaflos in dieser Nacht und dachte an Judith, wie sie damals gewesen war. Ich erinnerte mich daran, was sie sagte, als wir einander in Wien wieder trafen. Man muß die Vergangenheit begraben, hatte sie gesagt, man muß unter alles, was gewesen ist, einen Strich ziehen und ein ganz neues Leben beginnen. Man muß einfach vergessen, das ist die einzige Möglichkeit.
Das muß man aber auch können, hatte ich gesagt.
Dazu muß man sich zwingen, hatte sie geantwortet, eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
Schon Judiths Weg nach Wien unterschied sich von vielen anderen Wegen, von denen wir wußten. Ihre Mutter stammte aus der Stadt Bodenbach an der Elbe, sie war mit der Tochter vor Weihnachten vierundvierzig dorthin zu ihrer Schwester gezogen, deren Mann gefallen war, der Vater, kurz vor dem Ende des Krieges frontuntauglich geworden, kehrte ebenfalls dorthin zurück, es gelang der Familie, beisammenzubleiben, was in jenen Monaten keine Selbstverständlichkeit war. Im Juli fünfundvierzig, berichtete Judith, habe man sie eines Nachts gegen zwei Uhr geweckt und zum Bahnhof getrieben, dort habe man sie in offene Kohlenwaggons gepreßt und über die Grenze nach Sachsen gebracht.
Wahrscheinlich, sagte Judith, hätten wir nach Mecklenburg in ein Lager gebracht werden sollen, aber der Vater wollte nicht in ein Lager, er wollte auch nicht nach Mecklenburg, er habe mit dem Wort LAGER Vorstellungen von Zwang und Gefangenschaft verbunden, habe während der Fahrt ununterbrochen auf die Frau und auf deren Schwester eingeredet, sie schließlich davon überzeugt, daß sie den Zug heimlich verlassen, daß sie abspringen, sich auf eigene Faust durchschlagen, einen Ort finden müßten, wo sie bleiben konnten und wollten, er habe sie schließlich überzeugt und so weit gebracht, daß sie sich dazu entschlossen, sie sei ohnedies sofort und von Anfang an für den Plan des Vaters gewesen, nur die Mutter und die Tante hätten sich gefürchtet, hätten Angst gehabt. Nicht vor dem Abspringen allein, sagte Judith, vorne auf dem Bremserhäuschen hinter der Lokomotive sei ein russischer Wachtposten mit einer Maschinenpistole gestanden, bereit, zu schießen, wenn er etwas gemerkt hätte.
Er habe aber zum Glück nichts bemerkt.
Judith erinnerte sich an den Ort LOMATSCH, dort sprangen sie vom fahrenden Zug, es war dunkel, sie rollten eine Böschung hinunter, liefen ein Stück, lagerten in einem Gebüsch, bis es hell wurde, gingen dann weiter, von Dorf zu Dorf. Dem Vater gelang es, einen Handwagen aufzutreiben, darauf hätten sie ihr geringes Gepäck gelegt.
Von Ort zu Ort zogen sie, bis sie schließlich in einer Kleinstadt, nahe der Stadt Chemnitz, Unterkunft und Arbeit fanden.
Dann, wiederum eines Nachts, seien sie über die GRÜNE GRENZE gegangen, der Vater habe nicht bleiben wollen, die Zustände seien unerträglich gewesen, er wollte nach Österreich, dort hätten sie ja Verwandte gehabt. Nur die Schwester der Mutter habe nicht mehr mitgehen wollen, die sei geblieben.
Eigentlich sind wir ja nicht gegangen, sagte Judith, sondern gekrochen, eine Hochspannungsleitung entlang, so hatte man uns den Weg beschrieben, GEROBBT, beinahe nichts von dem, was wir noch hatten, konnten wir mitnehmen, alles mußte zurückbleiben. Sie hätten dann die Orientierung verloren oder sie verloren zu haben geglaubt, sie hätten es auch dann noch nicht gewagt, sich aufzurichten, aufrecht zu gehen, als sie sich schon längst auf westdeutschem Gebiet befunden hätten, der Vater habe es schließlich gewagt, an die Tür eines Bauernhauses zu klopfen und nach dem Weg zu fragen. Die Bäuerin habe sofort Bescheid gewußt, Sie sind schon im Westen, habe sie gesagt, nicht weit hinter Plauen sei das gewesen, in der Nähe der Stadt Hof.
Sie sind nicht die ersten, sagte die Bäuerin, und Sie werden nicht die letzten sein.
Sie habe ihnen etwas Milch und zu essen gegeben.
Ich habe schon einen Blick dafür, wo die Leute herkommen, die bei uns anklopfen, sagte sie.
(Jahrzehnte später der Anblick der MAUER in Berlin, die elektrisch geladenen Zäune, die Wachttürme, die TODESSTREIFEN.
Hunderttausende, sagt eine Berlinerin, Hunderttausende sind in der Zeit, von der Sie reden, in den Westen gegangen.)
Zu Fuß zogen sie weiter, in WEIDEN hätten sie einen Zug erreicht, seien mit diesem Zug ein Stück gefahren, dann wieder zu Fuß gegangen, schließlich hätten sie Schärding erreicht, hätten mit einem Boot den Inn überquert, ein amerikanischer Posten habe sie aufgehalten, dann aber weitergehen lassen.
Er hat wohl ein Mädchen bei sich gehabt, sagte Judith, als sie mir dies erzählte, irgendwo im Gebüsch versteckt hat sicherlich ein Mädchen auf ihn gewartet, er hat die längere Unterbrechung einer Liebesstunde befürchtet oder gar deren Verhinderung, er hat mit seinem Gewissen gekämpft, sich dann aber für die Liebe entschieden. Er hat sich einfach umgedreht und uns gehen lassen. Wiederum überquerten sie, nachts und in einem bezahlten Boot, in der Nähe von Urfahr, die Donau. Ihr Ziel war Wien.
(Ein Stück weiter südöstlich, bei Mauthausen, hat Anni zwei Jahre vorher, um das Weihnachtsfest mit den wiedergefundenen Eltern verbringen zu können, die Donau ebenfalls in einem Boot, ebenfalls nachts, überquert. Es sind damals, in den Nächten, sehr viele in Booten unterwegs gewesen.)
Ich dachte an Judith und erinnerte mich an das winzige Schrebergartenhäuschen in Wien, das die Cousine des Vaters ihnen zur Verfügung gestellt und in dem sie mit ihren Eltern lange gelebt hatte. Die Wände waren dünn gewesen, obwohl die kleinen Räume beheizbar gewesen waren, froren im Winter die Lebensmittel, fror das Brot im Schrank, zogen sich Judith und ihre Mutter Erfrierungen an den Beinen zu. Morgens, im Winter, hatte mir Judith erzählt, sei die Decke vor ihrem Mund weiß bereift von der Feuchtigkeit ihres Atems gewesen.
Erst Jahre später fand sich eine bessere Unterkunft für die Familie. Zur Zeit der Herbstmesse neunundvierzig, als sie Plotzners Patentbett erprobte, hat Judith noch mit ihren Eltern in jenem Holzhäuschen am Wiener Stadtrand gewohnt.
Ich lag und dachte an Judith in dieser Nacht, sah sie über die klebrige Erde kriechen, geduckt über nasse Wiesen laufen, sah sie vom Kohlenwaggon auf den Bahndamm springen, über eine dreckige Böschung fallen, sich wieder erheben, nein, an ihren Kleidern klebte kein Schmutz, ich hatte Judith niemals schmutzig gesehen, selbst wenn sie im Sommer daheim auf den Feldern mithalf, als während des Krieges keine Arbeitskräfte zu bekommen waren, wenn sie Obst pflückte und Trauben von den Stöcken schnitt, selbst dann sah sie aus, als hätte sie eben erst gebadet oder frisch gewaschene Kleider aus dem Schrank angezogen. Nie hing ihr das Haar schweißnaß und verklebt in die Stirn, nie waren ihre Arme von Mückenstichen geschwollen, ihre Augen vom Staub gerötet oder von Kornhalmen zerstochen. Die Arbeiter auf den Feldern drehten sich nach ihr um, wenn sie kam, lachten ihr zu, sie lachte und winkte zurück. Wie Judith wollte ich sein, als ich Anni war, stand vor dem Spiegel, versuchte mein Kopftuch zu binden, wie sie es gebunden hatte, es gelang mir nicht, ich versuchte, mein Haar offen zu tragen, wie sie es trug, es wehte mir über die Stirn in die Augen, vergeblich strich ich es immer wieder seitlich zurück. Wie siehst du denn aus, sagte meine Mutter, WIE EINE ZIGEUNERIN, hast du denn deinen Kamm verloren? Es blieb mir nichts übrig, als wieder meine Zöpfe zu flechten, bis man mir endlich erlaubte, sie abschneiden zu lassen. Das Ergebnis war lächerlich, heute noch kann man es nachprüfen anhand einer damals entstandenen Fotografie, nie würde Anni wie Judith aussehen, nie würde Anni wie Judith sein.
Nein, es gelang mir nicht, Judiths Vollkommenheit auch nur annähernd zu erreichen, nicht in der Kleidung und nicht in der Frisur, nicht in der Haltung und nicht in der Sprache, es dauerte eine ganze Weile, bis ich zu dieser Einsicht kam, bis Anni nicht mehr versuchte, wie Judith zu sein, bis sie sich trotzig dazu entschloß, mit ihren Fehlern zu leben.
Dennoch, Jahre später, die Szene mit Christians silbernem Ring, als Anni wahrheitsgemäß Antwort gab und Judith zornig reagierte, sich von ihr abwendete und davonlief, dennoch das dunkle Gefühl, daß Christians Liebe ihr eigentlich gar nicht zustand, daß er sich nicht ihr, sondern Judith hätte zuwenden müssen, weil Judith klüger, schöner, geschickter, mit einem Wort, in jeder Hinsicht vollkommener war als sie.
Ich dachte an Judith, vielleicht war sie wirklich in meinem Zimmer, was wissen wir von den Toten, von ihrer Freiheit, von ihrem Losgelöstsein, eine Ahnung ihrer Gegenwart wehte mich aus den Vorhängen an, in denen die zitternden Schatten der Baumzweige tanzten, stieg aus den blassen Lichtschatten, die auf dem Teppich lagen. Ich hörte ihre Stimme, mit der sie auf Mutter und Tante einredete, ihnen Mut zusprach, sie überzeugte.
Spring, sagte Judith, und die Mutter, eine sonst ängstliche und vorsichtige Person, sprang vom Kohlenwaggon in die Nacht hinein, es geschah ihr nichts, sie verletzte sich nicht bei diesem waghalsigen Sprung vom fahrenden Zug, die Überzeugungskraft der mutigen Tochter hatte sie stark gemacht.
Von der Geschichte, die sie mir über den amerikanischen Wachtposten erzählt hatte, der die Familie nicht, wie es seine Pflicht gewesen wäre, am Überschreiten der Demarkationslinie ohne Papiere hinderte, sondern ziehen ließ, hatte ich mir von Anfang an ein anderes Bild gemacht als jenes, das sie dargestellt hatte. Wahrscheinlich hatte es dieses Mädchen, das angeblich irgendwo im Gebüsch auf den Liebsten gewartet hatte, gar nicht gegeben, dachte ich, es hatte nur in Judiths Phantasie existiert, wahrscheinlich hatte einzig und allein ihr Anblick den Amerikaner veranlaßt, sie ungehindert gehen zu lassen. Er konnte nicht widerstehen, als sie ihn erschrocken und bittend ansah, er konnte sich der Wirkung ihrer Stimme nicht entziehen, er vergaß einfach, was ihm aufgetragen war, und widersetzte sich nicht. Es gingen Veränderungen in ihm vor, gegen die er sich nicht zur Wehr setzen konnte. Vielen ist es vorher und nachher ähnlich ergangen, auch Georg, dachte ich, mußte es ähnlich ergangen sein.
Vielleicht war sich Judith der Wirkungen, die von ihrer Person ausgingen, gar nicht bewußt, oder jedenfalls nicht so sehr, wie man später behauptet hat. Sie versuchte einfach, etwas zu erreichen, was sie erreichen wollte, und es gelang, in den meisten Fällen jedenfalls gelang es, sie wünschte sich etwas und bekam es, selten schlug man ihr eine Bitte ab, wenn sie erfüllbar war. Sie war so sehr daran gewöhnt, Erfolg zu haben, wenn sie ihn haben wollte, daß es ihr nicht weiter auffiel, wenn er sich wirklich einstellte. Nie hat sie die Faszination, die von ihrer Person ausging, wissentlich dazu benützt, anderen zu schaden oder sie zu verdrängen. Trotzdem konnte man schuldig werden in ihrem Namen, sie gab den Anlaß zur Schuld, an der andere ein Leben lang zu tragen hatten, und einmal gab sie den Anstoß zu einem Unglück, das sich nicht mehr rückgängig machen, nicht mehr gutmachen ließ. Als es geschehen war, reagierte sie wie ein Kind, das sich im Bewußtsein seiner Schuld in einen Winkel verkriecht und sich die Augen zuhält, in dem Glauben, daß Unglück gelöscht werden kann, wenn man es nicht sieht.
Ich hätte alles nur noch ärger gemacht, wenn ich geblieben wäre, sagte Judith, die in meinem Zimmer war.
Du bist davongelaufen, sagte ich, das war schlimmer, als wenn du geblieben wärst. Du hast das Unglück nicht ertragen, das du verursacht hast, aber andere mußten es tragen.
Du bist mit schuld daran, daß ich davongelaufen bin, sagte Judith.
Ich weiß, sagte ich.
Ich wollte es nicht, sagte Judith, DAS NICHT.
Das habe ich immer gewußt, sagte ich. Du wolltest etwas ganz anderes. Hast du es wenigstens bekommen? Es kam keine Antwort, es konnte ja auch keine kommen.
Nachdem Judith Wien verlassen hatte und nach Deutschland gegangen war, kam keine Nachricht mehr von ihr. Jahre später schickte man uns einen Zeitungsausschnitt zu, auf dem eine Reporterin zu sehen ist, die Passanten in Stuttgart nach ihrer finanziellen Situation befragt, der Name der Reporterin war nicht genannt, sie sah wie Judith aus, konnte Judith sein, sicher waren wir nicht, daß sie es wirklich war.
Dann kam das Hochzeitsbild. Der Umschlag, in dem es steckte, trug keine Adresse, nicht einmal ihren durch ihre Heirat geänderten Namen gab sie uns bekannt. Wir haben geheiratet, Judith und Frank, stand auf der Rückseite der Fotografie, keine Anschrift, kein Datum, den verwischten Poststempel konnten wir nicht entziffern.
Wer war dieser Frank, dessen Frau sie geworden war? Wir wußten es nicht, und es gab niemanden, der uns Auskunft geben konnte. Er konnte ein Deutscher, er konnte auch ein Ausländer sein, ein Nordländer vielleicht oder ein Amerikaner.
Mir fiel auf, was die anderen anscheinend nicht bemerkten, weil sie nicht mehr an ihn dachten oder auch, weil sie ihn gar nicht gekannt harten, die Ähnlichkeit mit Christian. Frank sieht beinahe wie Christian aus, dachte ich sofort, als ich das Bild in der Hand hielt, äußerlich jedenfalls, er sieht ihm ähnlich, der Gesichtsschnitt, das glatte, zur Seite gebürstete Haar, die Haltung, die Körpergröße, die schmalen, zu den Schläfen hin leicht schräg verlaufenden Augenbrauen, die Nase, das Kinn. Ich erschrak über diese Ähnlichkeit, dann aber sah ich den fremden Ausdruck in Franks Augen, und ich sah vor allem die Hände, die eine, etwas unbeholfen herabhängend, die andere besitzergreifend um die Schulter der Braut gelegt. Vor allem diese eine Hand sah ich, die Judiths Oberarm umgriff, ihn umklammerte, sich in den dünnen Stoff des Brautkleides grub, so daß er an dieser Stelle Falten bildete. Die Spuren dieser Umklammerung mußten an Judiths Arm sichtbar geblieben sein, sie mußte am nächsten Tag blaue Druckstellen am Oberarm gehabt haben, dachte ich. Nein, das war nicht Christians Hand, und es waren vor allem nicht Christians Augen, nicht sein skeptischer, hinterfragender Blick. Franks Augen blickten zielstrebig, entschlossen, sie sahen am Betrachter des Bildes vorbei, waren auf einen imaginären Punkt gerichtet, der wahrscheinlich ZUKUNFT bedeutete, sonst nichts.
Nichts von dem war in Franks Augen, was Anni und Valerie traurig gestimmt hatte, als sie die kleine Fotografie betrachteten, die Christian bald nach seiner Ankunft in Deutschland geschickt hatte, sie riefen kein Mitgefühl hervor, ließen keine Zweifel ahnen, keine Spuren von Verunsicherung durch Vergangenes waren aus ihnen abzulesen. Frank war nicht Christian, war ein völlig anderer Mensch, das war mir, als der erste Schreck über die äußerliche Ähnlichkeit abgeklungen war, klar. Alle anderen Überlegungen, die wir über Beruf, Staatszugehörigkeit, Nationalität, durch den ungewöhnlichen, in unseren Ländern kaum gebräuchlichen Namen angeregt, anstellten, gehörten in den Bereich der Phantasie. Es blieb uns, abzuwarten, ob doch eines Tages eine Nachricht von Judith kommen würde, aber das war nicht der Fall. Sie wollte keine Verbindung mehr zu uns, sie wollte vergessen werden und wahrscheinlich wollte sie selbst auch vergessen.