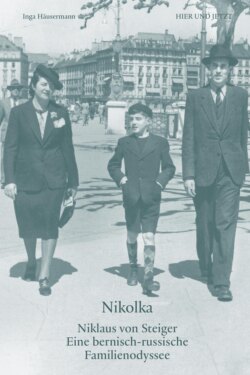Читать книгу Nikolka - Inga Häusermann - Страница 8
Masleniza
ОглавлениеDer Kellner klopfte uns sanft auf den Rücken und stellte einen Teller mit Käse und Trockenfleisch auf den Tisch. Wir mussten beide in Gedanken gewesen sein und fragten uns, wie wir eigentlich in diesen Keller gelangt waren. Als der Mann uns Wein nachschenkte, bemerkte er, es komme nun mal nicht alle Tage vor, dass man einen derart edlen Tropfen öffne. Nach einem Blick auf die Etikette schauten wir einander staunend an. Die Flasche trug den Jahrgang 1730.
Jetzt erst begriffen wir, dass wir im «Klötzlikeller» sassen, der ältesten noch erhaltenen Weinstube Berns. In einer Nische des seit vierhundert Jahren unveränderten Raumes stand noch immer der helle, zylinderförmige Kachelofen. Und über den schweren, dunklen Tischen hingen an holzverkleideten Wänden alte Zeichnungen, Kupferstiche und gerahmte Zeitdokumente sowie Porträts der legendären Kellerwirtinnen.
Als Niklaus für den Wein aufkommen wollte, winkte der Kellner ab. Die Rechnung sei bereits beglichen worden. Ob es tatsächlich Schultheiss Christoph von Steiger gewesen war, der uns eingeladen hatte, wagten wir nicht zu fragen. Stattdessen erhoben wir uns und stiegen wieder die Stufen zur Gerechtigkeitsgasse hoch.
In der Postgasse setzten wir uns auf die schmiedeeiserne Treppe, die der Künstler Carlo Lischetti am Kronenbrunnen angebracht hatte und auf die jeder Berner steigen kann, um sich einmal im Leben wie eine Brunnenfigur zu fühlen.
Niklaus kam auf die Französische Revolution zu sprechen, die letztlich auch das Ende des alten Bern eingeläutet hatte. Er sprach von der Eroberung der Alten Eidgenossenschaft durch die Franzosen, was für das Patriziat einen tiefen Einschnitt und den Verlust der politischen und gesellschaftlichen Vormachtstellung bedeutet hatte. Der Adel war bis anhin entweder im Staatsdienst beschäftigt gewesen oder hatte von seinen Ländereien, die er bewirtschaften liess, gelebt. Grosse Teile des landwirtschaftlichen Besitzes gingen nun aber verloren. Ausserdem war das Patriziat unter dem «Direktorium», der letzten Regierung vor der Machtübernahme Napoleons, mit beträchtlichen Reparationszahlungen belegt worden. Und als im Jahre 1816 schwere Ernteausfälle zu einer grossen Hungersnot führten, ging dies auch am Berner Adel nicht spurlos vorüber.
Obschon sich die Franzosen inzwischen hinter den Rhein zurückgezogen hatten und die Aristokratie sich langsam wieder etablierte, waren manche der bernischen Patrizierfamilien so verarmt, dass sie sich für die Auswanderung entschieden. In den 1820er-Jahren setzte eine breite Auswanderungswelle ein, obwohl das Reisen zu jener Zeit nicht ungefährlich war. Viele Familien, die bereit waren, die Strapazen auf sich zu nehmen, wurden Opfer von Überfällen und Krankheiten, noch bevor sie ihr Ziel erreichten.
Auch der Besitz der Familie von Steiger war enorm geschrumpft. Ein Zweig war in Bern geblieben, konnte sein Gut in Tschugg aber nur mit Mühe halten. Für Niklaus’ direkten Vorfahren Johann Rudolf aber, dessen Familie das Weiermannshausgut im Steigerhubel besass, wurde es schwierig. Neben den Einschränkungen, die alle Patrizier betrafen, verlor er Prozesse gegen die damalige Stadt Bern, was ihn beinahe in den Ruin trieb. Sein Sohn Rudolf erinnerte sich an den Patensohn seines Vaters, der als Küher nach Russland ausgewandert war und ihm voller Begeisterung von den Vorzügen und Perspektiven jenes unermesslichen Landes geschrieben hatte. Und so nahm die Idee, die Eidgenossenschaft zu verlassen, allmählich Gestalt an.
Rudolf, der ein regelrechter Wildfang gewesen sein muss, nannte man in Bern nur «den Kreuzbuben». Aus einer «Mesalliance», wie man damals eine nicht standesgemässe Verbindung nannte, mit einer Frau aus Sankt Gallen hatte er fünf Töchter und zwei Söhne. Als aus der Affäre mit einer Pfarrerstochter ein weiterer Sohn hervorging, verschärfte sich die Kritik an ihm sowohl im bernischen Grossen Rat wie auch an seinem Wohnort Frienisberg, was ihn in seinen Plänen zusätzlich bestärkt haben mag.
Vor seiner endgültigen Entscheidung, das Land mit seiner Familie zu verlassen, hatte er Russland ein erstes Mal besucht. Nach seiner Ankunft in Jaroslawl, einer Stadt nordöstlich von Moskau, liess er sich in einem bescheidenen Hotel nieder. Es war die Zeit der Masleniza, der sogenannten Butterwoche, unmittelbar vor der Grossen Fastenzeit. Auf einem Abendspaziergang durch die Stadt kam er mit einem Mann ins Gespräch, der ihn zu sich nach Hause einlud. Dort waren meterhoch Blinis, eine Art russische Pfannkuchen, aufeinandergestapelt und daneben Wodkagläser aufgetürmt. Diesen Berg trug man in einer wilden Völlerei von oben nach unten ab, und Rudolf war so begeistert von diesem Brauch, dass er in sein Hotelzimmer zurückging und sich sagte: «Dieses Land gefällt mir, hier will ich hinziehen.»
Die späte Vormittagssonne liess die Häuser der unteren Altstadt in herbstlichem Licht erstrahlen, als Niklaus und ich uns wieder erhoben. Die Gasse war menschenleer und still. Nur das leichte Aufschlagen von Niklaus’ Stock auf den Pflastersteinen war zu hören. In den Laubengängen dämpfte der graue Sandstein das Licht, sodass ich die Tür erst gar nicht bemerkte, vor der er stehen geblieben war. «Was meinst du, wollen wir?», fragte er mich. Da erst realisierte ich, dass wir vor dem lutherischen Gotteshaus standen, in dessen Krypta sich die Russisch-Orthodoxe Kirche befand.
Durch die unverschlossene Tür gelangten wir in den hohen, schwach beleuchteten Eingangsbereich mit der Treppe, die in den Vorraum der Krypta hinunterführte. Als wir die mit rotem Teppich belegten Stufen hinabstiegen, hörten wir aus dem Untergrund leise Stimmen in russischer Sprache. Auf den rustikalen Holzbänken, die sich im Vorraum den Wänden entlangzogen, warteten Gläubige in abgedämpftem, warmem Licht. Ich bedeckte die Haare mit meinem Halstuch, wir bekreuzigten uns und betraten die mit Kerzen beleuchtete und von Weihrauch geschwängerte Krypta. Nur ein Geistlicher, der in einem prächtig eingefassten Buch las, einer Bibel vermutlich, sass in der Ecke neben einer Seitentür. Alte, hölzerne Klappstühle standen in einem Halbrund um einen Sockel, auf dem eine Ikone lag. Ich nahm Niklaus am Arm, damit er sie küssen und sich vor ihr bekreuzigen konnte. Dann setzten wir uns auf zwei der hinteren Stühle.
«Damals kursierten in den Kreisen der Ausreisewilligen verlockende Versprechungen, die vielen den Entscheid, auszuwandern erleichterten», nahm Niklaus seine Erzählung wieder auf. «So geriet etwa eine Frau von Krüdener, eine geborene Juliana Barbara von Vietinghoff, die in Bern lebte und dem baltischen Adel angehörte, regelrecht ins Schwärmen, wenn sie vom Russischen Reich, den Gegenden Mittelasiens Samarkand oder Buchara erzählte. Nicht nur das biblische Paradies habe sich dort befunden, sondern es sei auch die Stelle gewesen, wo Noahs Arche nach der Sintflut wieder auf Festland gestossen sei. Manchen lockte ihre Verheissung, man sei dort dem Himmel näher als der Erde. Ein politisch neutrales Reich sei im Entstehen begriffen, und man sei in Erwartung des tausendjährigen Reichs Christi.
Es gab aber durchaus auch handfeste, rationale Argumente, um nach Russland auszuwandern. So versprach Zar Alexander I., der eine besondere Affinität zur Schweiz hatte, unter anderem jedem, der sich auf der Halbinsel Krim niederlassen wollte, ein zinsloses Darlehen für die Übersiedlungskosten und genügend fruchtbaren Boden für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Er garantierte Religionsfreiheit, die Einwanderer waren von Zollgebühren befreit, und den Kolonisten wurden eigene Bezirke mit weitgehender Selbstverwaltung zuerkannt, in denen sie nachbarschaftlich unter ihresgleichen leben konnten. Es war ihnen erlaubt, Fabriken zu gründen und Handel im In- und Ausland zu betreiben. Jeder konnte sich auf den Schutz und den Beistand der Kaiserlichen Majestät verlassen, und den Angehörigen ausländischer Adelsfamilien wurden die Rechte und Privilegien des russischen Adels eingeräumt.
Besonders jener letzte Punkt wird für Rudolf ausschlaggebend gewesen sein, sich auf das Abenteuer Russland einzulassen. Im Frühherbst des Jahres 1822 verliess Rudolf schliesslich mit seiner Familie Frienisberg.
Die Pfarrerstochter und seinen unehelichen Sohn liess er ohne finanzielle Hilfe in der Heimat zurück. Später musste sich dieser als Hausierer durchschlagen. Dank seines kaufmännischen Geschicks brachte er es aber trotzdem bis zum Buchhalter bei der Kantonalbank. Ein Sohn von ihm baute später in Bern das bekannte Porzellangeschäft Steiger auf, das noch bis in die Neunzigerjahre des zwanzigsten Jahrhunderts in der Marktgasse beheimatet war.»
Nach Russland führten verschiedene Wege. Viele der Eidgenossen, die sich im Süden ansiedelten, wählten den Flussweg über die Donau nach Wien und weiter in Richtung Schwarzes Meer. Da sich die von Steigers für den Nordwesten Russlands entschieden hatten und nicht zu den Ärmsten unter den Auswanderern gehört haben dürften, nahmen sie vermutlich den Weg über Preussen und die Ostsee.
«Wie schön doch unsere Heimat ist», dachten sie immer wieder wehmütig während der ersten Tage ihrer Reise, «wie abwechslungsreich die Landschaft, die Alpen, Täler und Gehöfte!» Und Rudolfs Frau Susanne staunte, mit welcher Begeisterung ihr Mann aus dem Kutschenfenster schaute und die Kinder auf jede noch so kleine Sehenswürdigkeit hinwies. Als die Wege jedoch schmaler und holpriger wurden und sie nur noch schleppend vorankamen, schienen die Tage immer länger zu werden. Man sass sich gedankenverloren gegenüber. Es gab kaum Pausen, und die Füsse konnte man sich nur kurz vertreten, wenn man neuen Proviant beschaffen, die Tiere versorgen oder den Wagen wechseln musste. Nur mit Mühe gewöhnten sich die Reisenden daran, dass der Fahrer meist erst tief in der Nacht einen Halt einlegte, sich ein paar wenige Stunden auf dem Kutschbock in seine Decken hüllte und bereits in den frühen Morgenstunden die Pferde wieder anspannte.
An der eidgenössisch-preussischen Grenze nahm ein neuer Kutscher die Fahrt in Richtung Lübeck auf. Vor der Abreise besprach er mit Rudolf die nächste Etappe. Gemeinsam entschieden sie, die Berge möglichst zu umfahren, um die Pferde zu schonen. Ausserdem war man dadurch weniger Wegelagerern ausgesetzt, kam immer wieder an Gehöften vorbei und konnte sich mit dem Nötigsten eindecken. Durch das Elsass fuhren sie in Richtung Norden und kamen nach mehreren Wochen Fahrt durchs oberrheinische Tiefland erschöpft, aber unversehrt in Frankfurt an.
Sie waren froh, dass der Fahrer sich vor Ort auskannte. Er fuhr sie zur Herberge, versorgte die Pferde und brachte Wagen und Gepäck in Sicherheit. Als sie abends nach langer Zeit endlich wieder in frisch bezogenen Betten lagen, war ihnen, als spürten sie das Rumpeln der Fahrt noch immer in ihren Knochen.
In den folgenden Wochen überquerten sie Hessens Bergland, umfuhren das Harzgebirge und gelangten endlich wieder in ebenere Gebiete. Da sie vom immerwährenden Sitzen steif und wund geworden waren, baten sie den Kutscher, Zelte zu organisieren, damit sie sich während der Rast kurz hinlegen konnten. Abends sassen sie dann unter dem freien Himmel um eine Feuerstelle, und die Mutter erzählte den Kindern Geschichten vom Land, in dem die Kirchtürme mit Zwiebelhauben bekrönt waren und nachts Wölfe und Bären um die Gutshöfe strichen.
Nachdem sie bereits mehrere Monate unterwegs gewesen waren, wurde es zunehmend kälter. Für das Übernachten in Zelten war es zu kühl geworden. Stattdessen wärmte man sich nach dem Essen kurz die Hände über dem offenen Feuer, zog sich so rasch wie möglich in den Wagen zurück und schmiegte sich eng aneinander. Als der Winter einbrach, musste Rudolf immer öfter aussteigen, um gemeinsam mit dem Kutscher Schneeverwehungen wegzuräumen, die erschöpften Tiere anzutreiben oder den festgefahrenen Wagen anzustossen. Längst hatten sie aufgehört, die Tage zu zählen.
Die Kälte wurde immer unerträglicher. Starke Winde wirbelten den trockenen Schnee auf den Feldern auf, peitschten den Pferden ins Gesicht und drangen durch die Ritzen der Kutschenwände. In Wolldecken eingewickelt, sassen sie eng beisammen und waren froh, wenn sie endlich wieder ein Dorf erreichten und sich kurz in einer Gaststube stärken konnten. Rudolf bestellte für seine Frau und die Kinder eine warme Suppe und gönnte sich selbst ein grosses Glas Branntwein. Es tat ihm gut zu sehen, wie die Gesichter der Buben und Mädchen wieder etwas Farbe annahmen.
Nach der Fahrt durch die Lüneburger Heide überquerten sie die Elbe. Statt die vorbeiziehende Landschaft zu betrachten, döste Rudolf immer öfter vor sich hin. Zweifel kamen in ihm auf, ob es richtig gewesen war, sich auf dieses Abenteuer eingelassen zu haben, und die Ungewissheit darüber, was sie in der Fremde erwarten würde, machte ihm zu schaffen.
Die Tage wurden schon wieder länger, als sie endlich in Lübeck eintrafen. In der Nähe des Hafens fanden sie eine günstige Herberge, und Rudolf ging an die Schiffsanlegestelle, um sich um die Überfahrtspapiere nach Sankt Petersburg zu kümmern. Am übernächsten Morgen bezog die Familie auf einem dreimastigen Frachtschiff ihre Kajüte, und das Schiff stach in die hohe See.
Das Essen an Bord war eintönig und der Ton unter den Matrosen rau. Schon nach kurzer Zeit jedoch liessen sie den einen oder anderen Buben bei der strengen Arbeit mitanpacken. Nach drei Wochen hörte man den kleinen Eduard jubeln, der zusammen mit dem Kapitän vorne auf der Reling stand. In weiter Ferne tauchten, als wäre es ein Traum oder eine Sinnestäuschung, das Festland und die Stadt Sankt Petersburg auf.
Nachdem das Schiff am Hafen angelegt hatte, begleitete der Kapitän die Familie auf einer Droschkenfahrt durch die Stadt. Rudolf und Susanne waren überwältigt von der Grösse der Häuser, den unzähligen Kanälen und der Eleganz der Menschen. Russland begreife man erst, erklärte der alte Seemann, wenn man den Newski-Prospekt gesehen habe, und als sie schliesslich in den breiten Boulevard mit der mächtigen Kasernenkathedrale einbogen, kamen sie tatsächlich nicht mehr aus dem Staunen heraus.
Schon der Schriftsteller Gogol hatte über den Newski-Prospekt geschrieben: «Kein Glanz, der diese schönste Strasse unserer Residenz entbehren müsste! […] Wenn man den Nevsky betritt, spürt man sogleich diesen gewissen Duft von frohem Müssiggang. Und bist du auch in dringenden und wichtigen Geschäften unterwegs, betrittst du ihn, hast du jegliches Geschäft vergessen. Das ist der einzige Ort der Stadt, den man nicht aufsucht, weil man muss, zu dem uns nicht nur die Notwendigkeit und das Geschäftsinteresse lenken, die doch sonst ganz Petersburg regieren.»
Ganz ähnlich erging es den von Steigers, als sie sich mit dem Kapitän vor ein Café an die Sonne setzten. Alle Last schien auf einmal von ihnen abzufallen. Die beschwerliche Reise, die Furcht vor einer ungewissen Zukunft und das bittere Heimweh, das sie immer wieder geplagt hatte. Ein Strahlen lag plötzlich auf ihren Gesichtern, während sie an ihren Gläsern nippten und zusahen, wie sich der Newski allmählich mit Händlern füllte. Bauern priesen ihre Ware an, alte Frauen feilschten mit fuchtelnden Armen um Groschen und Kopeken, während emsige Knaben in buntscheckigen Kitteln leere Flaschen einsammelten oder Stiefel auslieferten.
Schon kurze Zeit später veränderte sich das Strassenbild erneut. Hohe Beamte und Würdenträger schritten über das breite Pflaster, Angestellte des Aussenministeriums, die man an ihren tiefschwarz glänzenden Backenbärten, die sie kunstvoll unter ihre Halsbinden gesteckt hatten, erkannte, flanierten vorbei, und junge Mädchen in Begleitung ihrer Gouvernanten, die sich diskret ein paar Schritte hinter ihnen hielten, trugen hocherhobenen Hauptes ihre Schönheit zur Schau. Die Tische vor dem Café waren bis auf den letzten Platz besetzt. Die Herren lasen Zeitung, und die Damen studierten die Theaterprogramme oder tauschten sich gegenseitig über das Befinden ihrer Kinder aus.
Der Kapitän unterbrach das wortlose Staunen der Neuankömmlinge und geriet ins Schwärmen. Er erzählte, wie unter Zar Peter dem Grossen Hunderttausende von Arbeitern unter schwierigsten Bedingungen in nur wenigen Jahren die Stadt in einer unwegsamen Moorlandschaft errichtet hatten. Dass der Boden, in dem man die gigantischen Fundamente der schweren Paläste und Kirchen verankert hatte, weich und tückisch war, und er erzählte vom Nebel, der aus den umliegenden Sümpfen aufsteige und an manchen Tagen wie ein Schleier über der Stadt liege. Wie alle Russen blickte er voller Stolz auf die prachtvolle Metropole. Aber auch wer sich als Ausländer in Sankt Petersburg niederlasse, versicherte er, gerate alsbald in den Bann der heiteren und zugleich würdevollen Melancholie, von der die Stadt durchdrungen sei.
An den folgenden Tagen kümmerte sich Rudolf um die Weiterreise, und bald schon wurden ihre Koffer auf eine Barke, die am Ufer der Wolga angelegt hatte, verladen. Glücklich, aber auch etwas wehmütig, nahmen sie Abschied von der ihnen lieb gewordenen Stadt.
Nach der Fahrt durch scheinbar endlose Nadelwälder erreichten sie zehn Tage später die Ortschaft Jaroslawl und gingen am Ufer vor dem Verklärungskloster an Land. Schon am nächsten Tag suchte Rudolf das Haus seines Bekannten auf, der ihn bei seinem letzten Aufenthalt zur Masleniza eingeladen hatte. Er überbrachte ihm Geschenke aus seiner Heimat und erkundigte sich nach einer möglichen Arbeit. Tatsächlich wollte es das Glück, dass für den ehemaligen Schaffner aus Frienisberg der Posten eines Direktors an der agronomischen Akademie frei wurde.
Obwohl er auf dem landwirtschaftlichen Gut seines Vaters aufgewachsen war und ein gewisses Fachwissen mitbrachte, musste er rasch feststellen, dass in Russland manches anders gehandhabt wurde als in Bern. Vor dem Einzug der Franzosen hatten seine adligen Verwandten zwar noch Untertanengebiete verwaltet, eine Leibeigenschaft wie in Russland gab es in Bern jedoch schon längst nicht mehr.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, sich in die örtlichen Gegebenheiten einzufinden, gelang es ihm schliesslich dennoch, auf den Gutshöfen der Umgebung vor allem auf dem Gebiet der Milchwirtschaft erhebliche Fortschritte zu erzielen.
Der Umstand, dass Jaroslawl bereits unter Kaiserin Katharina der Grossen Ende des 18. Jahrhunderts zu einer Gouvernementshauptstadt des Zarenreichs geworden war, eröffnete Rudolf als Patrizier neue Perspektiven.
Mit seiner Einführung in die Kreise des Adels kam er zum Posten des Verwalters der zaristischen Krongüter, und schliesslich wurde ihm der Titel eines Kaiserlichen Hofrats, der mit hohem Ansehen verbunden war, verliehen. Es war ihm gelungen, sich in der russischen Gesellschaft zu etablieren, und mit dem Eintritt der Familie in die Russisch-Orthodoxe Kirche hatten die von Steigers auch das russische Bürgerrecht erlangt.
Sie waren noch nicht lange in Jaroslawl, als seine Frau Susanne ernstlich erkrankte. Rudolf war es, als würde ihnen ihr grosses Glück nun seinen Tribut abverlangen. Obwohl die besten Ärzte bei ihnen ein- und ausgingen und er jeden Abend an ihrem Krankenbett sass, überbrachte man ihm eines Tages in seinem Kontor die traurige Nachricht, dass seine Frau ihrem Leiden erlegen sei.
Rudolf verfügte inzwischen über die nötigen finanziellen Mittel, um seine beiden Söhne in ein Berner Internat zu schicken. Da er aber auf Dauer mit dem Alleinsein nicht zurechtkam und kein Mann von Traurigkeit war, konnte man ihn schon bald wieder an gesellschaftlichen Anlässen antreffen. Die Frau, die wenig später in sein Leben trat, kam aus gutem Haus und verhalf der Familie zu grossem Reichtum. Leider verstarb auch sie früh, und mit dem Tod seines Sohnes Rudolf während eines militärischen Auslandseinsatzes, musste er einen weiteren schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Seine dritte und letzte Frau brachte erneut eine hohe Mitgift in die Ehe. Aufgrund eines schlecht ausgehandelten Erbvertrags fiel jedoch nach Rudolfs Tod sein gesamtes Vermögen der Familie seiner Frau zu, und sein eigener Sohn Eduard ging leer aus.