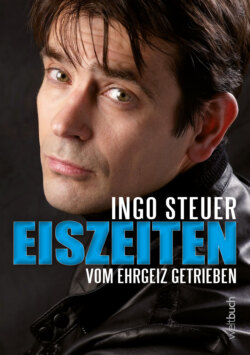Читать книгу Eiszeiten - Ingo Steuer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Kapitel Erfolg erfordert harte Arbeit
ОглавлениеIch will sehen, wie du läufst
Ich weiß es noch, als ob es gestern war: Fünfjährig stand ich zum ersten Mal auf dem Eis. Die Halle, die Trainerin, alles stürzte, rauschte ganz ungewohnt auf mich ein. Hinter der Bande standen meine Eltern und schwitzten für mich mit. Laufen sollte ich.
„Lauf“, sagte die fremde Frau, die für lange Zeit meine Trainerin werden sollte. „Lauf und halte dich auf den Beinen – ich will sehen, was du kannst!“
Ich rang dem Eis mit Leichtigkeit ein erstes Stehen und ein vorsichtiges Gleiten ab. Das fühlte sich gut an. Das fühlte sich sehr gut an! Lag es daran, dass ich seit einiger Zeit auf Rollschuhen durch unsere den Rasen begrenzenden Straßen flitzte? Oder daran, dass in mir ein Bewegungstalent schlummerte?
Jedenfalls, der erste Versuch auf dem Eis fühlte sich großartig an wie Musik. Dann stolperte ich und fiel zum allerersten Mal aufs Eis. In diesem Augenblick liefen plötzlich wildfremde Mädchen und Jungen, sich eigenartig einig, im Kreis um mich herum und ließen mich nicht mehr durch. Kichern, Lächeln, Schadenfreude. Nun – damit, dass Kinder grausam sein können, haben wir alle im Laufe unseres Lebens Bekanntschaft gemacht. Da meinte ein anderer kleiner Steppke, er könne das viel besser als ich. Seit dieser Erfahrung weckt alles, was aussichtslos scheint, zu jeder Zeit meinen Ehrgeiz. Selbstmitleid ist nicht meine Stärke. Ich stand auf, putzte mir den Eisstaub von der Hose und dachte: „Denen zeigst du‘s!“ Und ich zeigte es ihnen.
In dieser Eishalle in Chemnitz, gleich in der Nähe der Autobahnauffahrt Chemnitz Mitte, habe ich fast 40 Jahre lang trainiert. Hinter dem kleinen Wäldchen führt ein Weg entlang zur Eissporthalle. Hier habe ich mein blaues Rad der Marke Diamant an die Hallenwand gelehnt und diese nach dem Training mit der Stirn berührt. Mich abgekühlt, obwohl ich aus der Kälte kam. Viel hat sich nicht verändert. Gleich nach der Wende wurde das Dach der Halle erneuert. Sobald genügend Geld zusammengekommen war, erhielt die Halle neue Heizungen und Eisleitungen. Ansonsten blieb beinahe alles beim Alten. Die Umkleideräume, in denen es immer noch riecht wie in allen Umkleiden der Welt. Und da ist diese ganz spezielle Kabine, die einst Katarina Witt gehörte und in der dann Mandy Wötzel und ich unser Domizil hatten. Für einige Jahre war es ein kleiner Klassenraum, den vor drei Jahren Aljona Savchenko bezog; wer weiß, wen er in den kommenden Jahren noch beherbergen wird.
Von den neu gebauten Tribünen überblickt man wie eh und je die Eisfläche. Nichts entzieht sich deinem Blick. Die Tafel, an die Termine, Zeitungsartikel und wichtige Informationen zum Trainingsalltag gepinnt werden, hängt immer noch.
Die Halle von heute unterscheidet sich kaum von ihrer früheren Beschaffenheit. Ich erinnere mich noch ganz genau, denn die Trainingshalle wurde mein zweites Zuhause.
In der Gruppe der kleinen Eisknirpse startete ich in die Welt des Eiskunstlaufs. Ich lief meine Runden vorwärts und lernte übersetzen, vorwärts und rückwärts. Vieles eigneten wir uns spielerisch an, bildeten zwei Riegen und flitzten um die Wette von einer Bande zur anderen. Wir probierten die ersten Pirouetten und versuchten, bei jeder Umdrehung einen ganz bestimmten Punkt zu fixieren. Wem es schwerfällt, beim Laufen verschiedene Bewegungen miteinander zu koordinieren, gewinnt beim Eiskunstlaufen keinen Blumentopf. Also lagen wir anfangs, zack, ständig auf unseren kleinen Hintern. Wir schwebten in der Waage übers Eis, solange wir konnten, und probten „Kanone“ und „Storch“. Wochenlang übten wir, auf einem Bein zu laufen. Wir zogen erste Schlingen, wagten die ersten, klitzekleinen Sprünge. Dann liefen wir nach Musik und sehr viel später präsentierten wir uns in ersten Wettkämpfen.
Körperlich brachte ich gute Voraussetzungen mit: Meine Arm- und Beinlängen befanden sich in der richtigen Proportion. Ich war nicht zu groß, nicht zu klein, weder zu schwer noch zu leicht. Meine Muskeln spielten gut mit und wuchsen, wie es sich gehörte. Ich war ein wendiger und athletischer Bursche mit der richtigen Portion Robustheit. So nahmen die Dinge ihren Lauf. Bald standen erste Leistungsvergleiche an. Normen mussten erfüllt werden, um weiter trainieren zu können. Im Eiskunstlauf heißt es ja leider nur Hop oder Top; ich schaffte es meist erst im letzten Anlauf, die „Aufstiegsläufe“ gerade noch zu bestehen. Andere nicht.
Es dauerte zwei Jahre und ein halbes dazu, dann blieben von der ersten Eislaufgruppe ganze vier Kinder übrig. Nur zwei Mädchen und zwei Jungen konnten mit den gestiegenen Anforderungen mithalten, die anderen schieden aus. Die Prüfungen hatten es von Jahr zu Jahr mehr in sich. Anfangs mussten wir vorgezeichneten Runden und Schlaufen folgen, später kamen komplizierte Figuren dazu und verschiedene Sprünge: erst einfacher Lutz, dann doppelter; einfacher Toeloop und später der ganze Spaß doppelt gesprungen.
Nur dank der Eltern und Großeltern war das Training in jenen ersten Jahren überhaupt möglich. Schließlich brachten sie uns zum Training und holten uns auch wieder ab – und nicht alle besaßen ein Auto! Sie schnürten uns die Schlittschuhe zu und halfen uns in unsere Trainingsklamotten hinein.
Und genau wie beim Fußball stand während jedes Trainings eine ganze Horde Trainer hinter der Bande. Alle Mütter und Väter nahmen zwangsweise enormen Anteil an unserem jungen Sportlerleben; natürlich machten sie sich ihr Bild und fachsimpelten. Sie beobachteten ihre Sprösslinge und verglichen deren Chancen mit denen der anderen. Bald trainierten wir Knirpse ja immer ernsthafter und auch für unsere Eltern spielte nicht mehr nur die Logistik eine große Rolle.
Unsere Mütter schneiderten uns die Kostüme, als es mit den Leistungsvergleichen losging und die ersten größeren Wettbewerbe bevorstanden. Aus dunkelblauem Silastik entstand für mich ein toller Anzug. Dann schwebten wir kleinen Wichte scharf beäugt übers Eis. Ich habe den Eindruck, dass das geplante Training, mit Athletiktests, Ballett- und Eistests damals viel umfangreicher war als heute. Natürlich auch weil der Sport vor 30, 35 Jahren im Osten Deutschlands eine ganz andere Bedeutung besaß. Mit ihm konnte man dem grauen Alltag entfliehen. Hier sahen wir die Welt- und Europameister im Training hautnah auf dem Eis und wurden immer wieder angestachelt, uns zu recken und zu strecken. Wir hatten immer unsere kleinen Ziele und mussten bestimmte Normen erfüllen, um dann irgendwann festzustellen, dass wir Blut geleckt hatten und wirklich dabei waren. Im Vergleich mit anderen jungen Eiskunstläufern aus der ganzen Welt begriffen wir, dass wir infolge der strengen Ausbildung und auch der zahlreichen jährlichen Leistungstests etwas auf dem Kasten hatten.
tkcl
Von Pflicht und Spiel
All die Jahre dort verbrachte ich gemeinsam mit Nils – dem Jungen, der, als ich in die Trainingsgruppe einstieg, sehr froh war, endlich einen kleinen männlichen Sportler neben sich zu wissen. Fast zehn Jahre sollte man uns zusammen trainieren sehen. Und nicht nur das! Wir verzapften jeden nur vorstellbaren Unsinn, übertrafen einander mit unseren Vorschlägen. Wir sorgten dafür, dass unsere Übungsleiter uns immer gut im Auge haben mussten. Max und Moritz auf dem Eis! Und wenn wir keinen gemeinsamen Streich ausheckten, nahmen wir Kobolde uns gegenseitig ins Visier.
Später waren wir zwei leistungsorientierte Jungen, die begabt genug waren, um zu guten Einzelläufern heranzuwachsen. Wir liefen miteinander übers Eis, folgten gemeinsam den Anleitungen der Trainer und hielten verschworen zusammen, wenn wir, nun 12-, 13-, 14-jährig, versuchten, uns gegen sie aufzulehnen. Als gleichaltrige Platzhirsche stritten wir damals auch viel miteinander. Man darf davon ausgehen, dass es unsere Trainer wahrlich herausforderte, uns beide an der Leine zu halten und unsere Streitereien zu schlichten. Ich will gar nicht wissen, wie viele Nervenstränge wir Streithähne damals kappten.
Vielleicht hätten es uns andere pädagogische Methoden leichter gemacht, Schule, Eislauf und Pubertät miteinander zu verbinden. Vielleicht würde heute manches anders laufen. Aber vielleicht auch nicht, denn Jutta Zickmantel, meine erste Trainerin, und der von uns allen so geschätzte Peter Meyer gaben sich wirklich große Mühe. Es kann gut sein, dass ich unter heutigen Trainingsbedingungen gar nicht so weit gekommen wäre. Ich weiß es nicht, denn ich trainiere fast ausschließlich Erwachsene.
Mancher Trainer kann trotz allem Übungspensum sehr herzlich sein. Ein anderer bleibt kühl und eher unverbindlich.
Ich weiß, dass man mit Kindern und Jugendlichen besonders einfühlsam und geschickt arbeiten muss. Sollte ich jemals eine Rasselbande kleiner, frecher Jungs unterweisen, werde ich versuchen, mich an mich zu erinnern. Monika Scheibe zum Beispiel macht das heute sehr gut in Chemnitz. Die Kinder mögen und achten sie. In dieser Mischung trainiert es sich angenehm und vor allem erfolgreich.
Doch wen wundert‘s, dass junge Burschen, die täglich Gewichte stemmten, Ausdauerläufe schrubbten und auf dem Eis ausgebildet wurden, den Regeln mal trotzen wollten? Also „überraschten“ wir unsere Betreuer immer wieder, indem wir Absprachen schlichtweg übersahen. So selbstverständlich sich mir das aus heutiger Sicht darstellt, so sehr brachte es mich damals in Schwierigkeiten. Dabei haben wir einfach nur Blödsinn gemacht; obwohl wir auf dem Eis tanzten, blieben wir doch die Löwenjungen, die wahlweise anderen oder sich gegenseitig die Tatzen immer mal wieder ins Fell krallen mussten.
Aber nicht nur mit Nils trieb ich Schabernack. Ich erinnere mich an einen Lehrgang. Zwölfjährig, schliefen wir in diesen Tagen im „Chemnitzer Hof“ und brauchten nach all der grauen Theorie unseren Auslauf. Das Zimmer, das ich damals mit Alexander König teilte, lag über einem Taxistand, und mit großer Freude und außerordentlichem Geschick feuerten wir Wasserladungen auf die Wartenden. Wir besaßen Augenmaß und Durchhaltevermögen – bis ein Taxifahrer, der uns zuvor mehrfach drohte, dafür sorgte, dass wir in der Hotellobby landeten. In unseren Schlafanzügen standen wir dort, das Portemonnaie in der Hand, um unsere Schulden zu begleichen, und erwarteten das Abstrafen. Aber nichts geschah; wir wurden nur verwarnt.
Nils und ich verbrachten fast unsere gesamte Eislaufjugend zusammen. In unserer Gruppe wechselte zwar die Anzahl der Mädchen, mal waren es zwei, mal drei. Wir beide aber blieben die männlichen jungen Hoffnungsträger. Mal Rabauken, mal freundliche Schlingel, immer etwas im Hinterstübchen ausheckend. Keinem Trainer fiel es leicht, uns zwei Jungs zu bändigen. Wir mussten dem streng durchgeplanten Alltag unsere Frechheiten entgegensetzen, um ihn zu ertragen. Früh 8 Uhr begann das Pflichttraining in der Eishalle. Nils und ich trafen uns eine Stunde früher im davor gelegenen Wald. Eine kleine Höhle war unser Paradies. Dort schenkten wir uns ein Stückchen ganz normale Kindheit und übernahmen die Hauptrollen unserer Geschichten. Der eine gab den Räuberhauptmann, der andere den wilden Jäger; unser Wäldchen wurde zum Wald, in dem Robin Hood zu Hause war. Für eine kurze Zeit versanken wir ins Spielen wie alle Jungen auf der Welt in diesem Alter.
Dann begannen jeden Morgen zwei Stunden Pflichttraining. Ödes, sterbenslangweiliges Üben. Zwei Stunden lang liefen wir nur Schlingen und Kreise, absolvierten „Dreier“ und lernten, uns abzustoßen ohne nachzustoßen. Über diese monotonen Wiederholungen erlernten wir das ABC des Eiskunstlaufens. Das sogenannte Kantenlaufen, das heute nicht mehr intensiv geübt wird und damit keine abrufbare Fertigkeit der Eiskunstläufer mehr ist. Ich als Trainer bedauere das sehr. Der Wechsel von Einwärtskante auf Auswärtskante und umgekehrt muss ja beherrscht werden, wenn man als Läufer Schritte auf dem Eis macht.
Jüngere Sportler, wie beispielsweise Aljona, haben diese Schule nicht durchlaufen und kennen viele Begriffe wie „Gegenwende“ und „Gegendreier“ nicht. In meiner Jugend gehörte das zum Einmaleins des Eiskunstlaufens. Maximal zogen damals sechs Sportler ihre Kreise auf dem Eis, jeder an seinem Ort. Mehr konnten in einer solchen Übungseinheit nicht zusammen trainieren. Damals war das kein Problem, denn das Eis „kostete“ nichts; heute schlägt der Zwang zur Effizienz zu. Für Trainer sind solche Übungsstunden einfach unrentabel.
Wir hatten in der DDR immer gute Pflichtläufer, Anett Pötzsch war eine von ihnen. Von ihr konnten wir uns viel abschauen, doch für uns war es furchtbar stumpfsinnig! Eine Stunde lang übten wir die Figur „Paragraph“ oder den großen Kreis-Auswärtsdreier. Danach schlängelten wir die Schlinge, heute Rückwärts-Einwärtsschlinge, morgen die Schlangenbogenschlinge. Oh je, wenn ich daran zurückdenke! Und das jeden Tag und für ein paar Stunden, das war schrecklich!
Natürlich haben Nils und ich uns zu diesem Pflichttraining etwas ausgedacht.
Ich weiß nicht, ob es die Pflichtschiene heute überhaupt noch gibt, diese besondere Kufe am Schlittschuh, die nur eine Zacke nach oben, zum Abstoßen besaß. Zum Bremsen war keine Zacke da. Im Gegensatz zur Kürschiene, die Zacken nach unten besaß, um vor dem Springen bremsen zu können. Wir besaßen also verschiedene Trainingsschuhe, Kürschuh und Pflichtschuh. Mit jedem kompletten Paar ließ es sich gut laufen – doch wie wäre es eigentlich, wenn wir mal links den Pflichtschuh und rechts den Kürschuh anlegten? Müsste doch lustig werden, dachten wir, weil man auf diese Art überhaupt nicht laufen, sondern maximal stolpern könnte. Ja, das müsste wirklich sehr, sehr lustig werden! Gedacht, getan, mit verschiedenen Schuhen zum Pflichttraining aufs Eis. Nils wandte sich als Erster an unseren Trainer Peter Meyer. Er käme nicht zurecht, hätte wohl verschiedene Schuhe an! – Nils durfte zum Schuhwechsel in die Kabine. Als ich einige Minuten später mit der gleichen klugen Bemerkung kam, hatte Meyer Lunte gerochen und bemerkte nur, dass ich dieses bedauerliche Missgeschick, diesen unglaublichen Zufall, der auch mir passiert sei, nun leider ausbaden müsse. Na ja, da war ich wieder einmal zweiter Sieger und stolperte bis zum Trainingsende wie ein betrunkener kleiner Bär übers Eis.
Es gab noch eine weitere Möglichkeit, die Pflichtübungen ein wenig zu reduzieren. Bevor wir begannen, unsere Kreise und Schlingen zu laufen, ritzten wir die Übungselemente selbst ins Eis. Mittels eines riesigen Holzzirkels – heute wird dafür ein Zirkel aus Metall genutzt – zeichneten wir sie uns auf die spiegelglatte Fläche.
tc
Später, bei der Pflicht, mussten wir ohne diese Vorgaben dreimal so genau wie möglich die geforderten Figuren nachlaufen.
So manchen Eiskunstläufer machte die Abschaffung der Pflicht bei den Wettkämpfen überglücklich. Für Kati Witt beispielsweise war es wunderbar! Ihr lag die Kür viel mehr. Manche, unter anderem Jan Hoffmann, beherrschten sowohl Kür als auch Pflicht sehr gut.
So nahmen wir das Vorzeichnen mit dem Zirkel sehr genau! Wir mussten schließlich Zeit schinden, fuhren gleich dreimal mit der Zirkelspitze im Kreis herum und ließen uns dabei so viel Zeit wie möglich – bis es den Trainern zu weit ging. Manchmal bestritten Nils und ich nur zu zweit eine solche Einheit und dann ließen wir unter großem Gejohle die Hölzer übers Eis schlittern, bis sie an die gegenüberliegende Bande krachten. Unsere Trainer gönnten uns die Abwechslung; nur wenn es gar zu schlimm wurde, zogen sie uns an den Hörnern.
Dazwischen bestritten wir unser altersgebundenes Aufstiegslaufen in regelmäßigen Wettkämpfen. Wir liefen unsere Pflichtfiguren, um danach die Kür vor der Kommission zu laufen. Ich erinnere mich, dass ich einmal in der Dresdner Eishalle die Norm meiner Altersklasse erfüllen musste. Meine Eltern kamen später aus Chemnitz hinterher und wurden mit der Frage empfangen, wo denn ihr Sohn stecken würde.
Völlig aufgelöst suchte uns eine Schar Erwachsener. Sie fanden uns in der neben der Halle gelegenen Kiesgrube, glücklich spielend, in völlig verschmierten Küranzügen. Jeder weitere Leistungsbeweis hatte sich an diesem Nachmittag für uns erledigt. Generell gelang es mir immer erst recht spät, die Norm zu erfüllen, da mir die Pflichtaufgaben Probleme bereiteten. Entweder schob ich mich mehr ab, als erlaubt war, oder ich lief die Kreise ungenau, mit meinen Gedanken sonst wo, nur nicht bei den monotonen Übungen. Trotzdem oder gerade deshalb wurde ich mehrere Male Spartakiade-Sieger. Man kann die Spartakiade mit einer Mini-Olympiade im eigenen Land vergleichen. Diese Siege flogen mir mehr oder weniger zu, da ich zu den Älteren meiner Gruppe gehörte, während meine Altersgenossen im Gegensatz zu mir die höhere Normstufe schon erreicht hatten und während der Spartakiade auch mit strengeren Maßstäben gemessen wurden.
Manchmal, wenn wir zum Pflichttraining mussten, stiegen wir absichtlich in den falschen Bus, der uns von der Schule – natürlich ganz aus Versehen – nicht in die Eishalle, sondern in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Jede Minute, die wir uns drücken konnten, war uns ein Gewinn. Auch der Zigarre rauchenden, streng polternden Pförtnerin spielten wir manchen Streich, spuckten einmal sogar durch ihr Pförtnerfensterchen hinein – um am nächsten Tag einen ordentlichen Anpfiff zu erhalten.
Später kamen weniger lustige Geschichten dazu. Trinkfest starteten wir in Trainingslagern durch – was auch immer wir uns da beweisen mussten. Einmal torkelten wir vom Flaschendrehen direkt in einen Swimmingpool hinein; was konnten wir schließlich dafür, dass die Schnapsflasche ausgerechnet immer wieder vor uns zum Stehen kam?
In meiner Erinnerung leuchten diese „schweren Vergehen“ aus dem durchgeplanten Trainingsalltag heraus. Es könnte diese Zeit gewesen sein, in der ich etwas vorsichtiger und schweigsamer wurde. Wie erkläre ich es am besten? Ich war nicht wirklich geschmeidig, tappte in jeden Fettnapf, der zu finden war. Manchen verfehle ich auch heute nicht. Vielleicht isolierte ich mich, von mir selbst unbemerkt, etwas mehr als vorher. Ich zog mich bisweilen gekränkt zurück und schaute von drinnen trotzig auf draußen. Es kann gut sein, dass mich das prägte und ich diese Schwarzer-Peter-Position ein Stück ins Erwachsenenleben mitnahm.
Auf jeden Fall blieben jene heiklen Aktionen nicht unbemerkt, doch man ließ uns gewähren und hatte aus der Entfernung – vielleicht auch ganz aus der Nähe – ein wachsames Auge auf uns. Wir „Goldkufen“ bewegten uns in einem großen Freiraum; was wir auch anstellten, wir liefen an der langen Leine.
Schwierigkeiten
In jedem von uns steckte ja zu dieser Zeit ein Stück Hoffnung, das Land einmal im Eiskunstlauf zu repräsentieren. Unser Erfolg würde mit der positiven Außenwirkung des Landes verschmelzen. Jeder von uns Jungs träumte davon, als Einzelläufer einmal eine olympische Medaille zu erringen. Und der Einzellauf stand für uns klar über dem Paarlauf. Waren wir arrogant? Natürlich waren wir das, wir hatten ja auch keine Ahnung, was das Paarlaufen im Eiskunstlauf bedeutete.
Dann kam es für mich zum großen Knall. Um die beiden Jungen zu trennen, die ständig miteinander stritten oder Unsinn anstellten, überlegten die Trainer zuerst, einen von uns beiden ganz vom Eis zu nehmen. Dann zogen sie in Erwägung, Nils oder mich in den Schnelllauf wechseln zu lassen. Das war nicht unüblich; musste sich jemand vom Kunstlauf verabschieden, wechselte er manchmal in diese Disziplin. Mein Vater arbeitete einige Zeit hobbymäßig als Übungsleiter im Eisschnelllauf. Einmal durfte ich mich im Training dazugesellen und kam wirklich gut zurecht. Doch Schnelllauf kam für mich als Alternative zum Eiskunstlauf ganz und gar nicht infrage, zumal ich ja im Grunde meines Herzens noch immer Einzelläufer war.
Es kam ganz anders. Sie steckten den größeren der beiden, also mich, in den Paarlauf. Auch diese Entscheidung ist nachzuvollziehen, denn der Größere machte mit einer Partnerin nicht nur eine bessere Figur; es galt ja auch zu werfen und zu halten und letzten Endes physikalische Gesetze wie zum Beispiel das Hebelgesetz auszunutzen. Tja, der Größere war nun eben ich.
Ich erinnere mich noch heute an den Moment, in dem ich erfuhr, dass ich aus dem Einzellauf raus sollte. Mehr noch, anfangs sollte meine Zeit auf dem Eis gänzlich vorbei sein. Zu sehr aus der Reihe getanzt, hieß es, zu wenig Disziplin. Zu poltrig, unbedacht und laut. Um Haaresbreite hätte ich mit dem Eiskunstlauf bald nur noch ein schönes Hobby gehabt.
Fürsprecherin Jutta Müller. (Foto: Wolfgang Thieme)
Nur weil Jutta Müller ganz entschieden intervenierte, durfte ich bleiben – unter der Voraussetzung, dass ich fortan in den Paarlauf wechselte. Und es kann sein, dass nur ihre Fürsprache von damals weite Schatten vorauswarf und mich mit Aljona Savchenko und Robin Szolkowy 2014 nach Sotschi zu Olympia fahren lässt.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass damals überall, wo ich auftauchte, Ärger entstand. Machte ich den Menschen um mich herum wirklich das Leben schwer oder hatte ich irgendwann einfach diesen Ruf weg? Konnten sich andere besser ins Licht setzen und war ich schlicht und ergreifend etwas zu schwerfällig, um den Stolpersteinen aus dem Weg zu gehen?
Ich redete eben auch immer, wie ich dachte. Letztendlich ist das immer richtig gewesen, denn ging ich zu weit, habe ich dafür eben Dresche gekriegt.
So will ich auch bleiben. Nicht taktieren. Ich bemühe mich, etwas leiser zu werden, denn manchmal komme ich einfach zu laut daher. Dann hole ich erst einmal Luft und suche bessere Worte, um mich oder etwas zu erklären. Die Jahre haben mich hinsichtlich meiner Ansprüche nicht verändert, ich will keine Kompromisse eingehen und an das, was ich erreichen will, keine Zugeständnisse machen. Anderen Menschen aber muss ich meine Ansprüche nicht mehr „überhelfen“. Ich verstehe, wenn sie andere Prioritäten setzen oder ihren Zielen nicht alles unterordnen, so wie ich es tat und teilweise noch immer tue. Dieses Lebensmotto „Alles oder nichts“ muss es meinen Kollegen und meinen Sportlern manchmal sehr schwer gemacht haben, mit mir auszukommen.
Heute verstehe ich vieles besser als früher. Vielleicht, weil ich die halbe Welt durchreist und manchen Menschen getroffen habe, der mich etwas dazulernen ließ. Vielleicht auch, weil ich mitfühle mit dem Ingo von früher, der, sehr jung noch, viel mit sich selbst ausmachen musste.
tc
Zu zweit
Für mich bedeutete es damals fürs Erste, aus dem Einzellauf in den Paarlauf zu wechseln und ein Mädchen an der Seite zu haben. Manuela Landgraf hieß die Zehnjährige, die man für mich ausgesucht hatte, da sie in Körpergewicht, Größe und sportlichem Entwicklungsstand zu mir passen könnte. Mit meinen 14 Jahren durchwanderte ich die Hölle. Ich fühlte mich degradiert. Aus der Traum; der Weltuntergang wäre nicht halb so schlimm gewesen.
An diesem Abend lag ich auf meinem Bett und heulte wie ein Schlosshund. Ich schämte mich, denn der Wechsel in den Paarlauf war für mich ein Abstieg, doch das war nur einer der Gründe.
Die Trainingsgruppe war mein zweites Zuhause. In diesem sozialen Umfeld wuchs ich heran, feierte meinen 10., 12. und 14. Geburtstag. In dieser Gruppe übte ich, mich zu anderen ins Verhältnis zu setzen, denn hier spielte sich meine gesamte Freizeit ab. Ich agierte zwischen Bande und Umkleidekabine, zwischen Trainergespräch und Trainingslager. Mitten unter all diesen jungen Spunden begann ich zu verstehen und zu begreifen, dass wirkliche Freude immer mit einem Sieg über sich selbst zu tun hat. Zum Beispiel, wenn man den ersten doppelten oder dreifachen Sprung gestanden hat.
Wenn einer den Sprung am Anfang der Trainingsstunde stand, dann wollte der andere das auch können und übte so lange und so intensiv, bis er am Ende der Stunde den Sprung auch draufhatte. Sobald jemand etwas besser beherrschte als der andere, distanzierte er sich von der Gruppe und das Gemeinschaftsgefühl, der Spaß verlor sich für den Moment. Unsere Trainer meinten, auf dem Eis gebe es keine Freundschaft. Uns war nicht klar, was damit gemeint war. Das war es, war einer besser, wollte der andere nachziehen. Mit zehn Jahren stand ich den dreifachen „Salchow“, mit elf stand ich den dreifachen „Toeloop“ und mit zwölf stand ich den ersten „Axel“. Ich lernte, Sprünge so lange zu wiederholen, bis ich den richtigen Dreh raushatte. Den Rittberger mochte ich, der lag mir. Der dreifache „Lutz“ fiel mir hingegen schwer. Das ist ein Kantensprung, der von der Rückwärts-Auswärtskante gesprungen wird und mit dem ich nie richtig warm geworden bin. Ich musste ihn immer mehr üben als die anderen.
Im Training begriff ich, dass Enttäuschungen zum Leben dazugehören und dass das nicht das Schlimmste ist. Und, obwohl ich manchmal danebenlag, schätzte und achtete ich meine Übungsleiter, wenn mir auch nicht jeder ans Herz wuchs – wie auch ich nicht jedem gleichermaßen sympathisch wurde. Aber ich begriff, dass jeder seinen Teil zum Ganzen zu leisten hatte.
In der großen Eismanege mussten Sportler, Trainer, technische Mitarbeiter und die Frauen in der Verwaltung einen guten Job machen. Wer nicht zuverlässig war, hatte in diesem Team nichts verloren. So wurde den Damen in der Verwaltung ebenso Respekt entgegengebracht wie dem Masseur.
Wir lernten, dass wir unseren Mädchen die Taschen zu tragen hatten. Wir hielten ihnen die Tür auf und halfen ihnen in die Jacken. „Kinderstube“ sagt man wohl dazu. Das Wort klingt altmodisch, ich weiß. Und ich fühle mich selbst nicht alt genug, um zu lamentieren, aber wir lernten in diesen Jahren, uns zu benehmen. Im Sport kann einer ohne den anderen nicht sein und immer steht das Team über dem Einzelnen. Doch jeder Sportler träumt von olympischem Gold, beäugt die Fortschritte der Trainingskameraden und schielt manchmal nach dem kleinen Vorteil für sich selbst. In diesem Spannungsfeld wuchsen wir heran, Freunde und Konkurrenten. Wir stritten uns und loteten auf dem Eis unsere Grenzen aus.
Weit und bunt war das Terrain nicht, auf dem wir uns austobten, obwohl wir das Eis liebten. Sicher war es nicht immer leicht, mich so anzunehmen, wie ich war. Ehrgeizig und trotzig und dabei bestimmt liebenswert und frech, wie die meisten Jungs auf dieser Welt. Es hätte mir gut getan, angenommen zu werden.
Vielleicht fehlten mir ein paar Lausbubensommer auf dem Land, während derer ich den Unsinn für ein ganzes langes Schul- und Trainingsjahr hätte machen können. Herumtollen, schreien, leise sein, lachen und weinen. Wann immer es geht, nutze ich die Gelegenheit und versuche, gemeinsam mit meinem Jungen Unsinn zu treiben und nachzuholen, was ich versäumte.
Unterdessen hatte ich an vielen Spartakiaden teilgenommen. Im Winter 1981/82 richtete Karl-Marx-Stadt, unser heutiges Chemnitz, die Eissportdisziplinen im Rahmen der Winterspartakiade aus. Auf Landesebene nahmen die besten Nachwuchssportler teil. Mit prächtigen Eröffnungsfeiern und viel Show ging es zur Sache.
Die Stimmung war für junge Sportler herrlich, die Atmosphäre gespannt und doch ausgelassen. Für jeden, der teilnehmen konnte, ein Vorgeschmack auf künftige, internationale Wettkampfatmosphäre. Ich sollte in diesem Winter das Spartakiade-Feuer entzünden.
Heute noch erinnere ich mich an diese kalte, fantastische Nacht. Ich lief mit der Fackel die lange Treppe, die nach oben hin immer schmaler wurde, bis zur letzten Stufe hinauf, und entzündete in der Schale das Spartakiade-Feuer. Es fühlte sich großartig an. Für einen Jungen von 15 Jahren, der nur für den Sport lebte, konnte es kein schöneres Erlebnis geben.