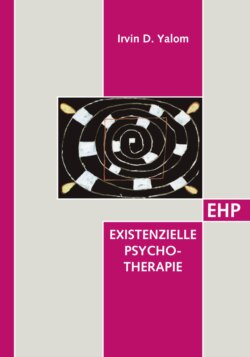Читать книгу Existenzielle Psychotherapie - Irvin D. Yalom - Страница 8
Vorwort zur vierten deutschen Auflage: »25 Jahre Existenzielle Psychotherapie«1
ОглавлениеWenn mich Leser fragen, welches meiner Bücher mir am liebsten ist, fällt mir die Antwort nicht leicht. Wie die meisten Autoren bin ich meist in das Buch verliebt, das ich gerade schreibe. Aber wenn ich wüsste, dass ich meine Feder für immer niederlegen müsste, würde ich wohl antworten, dass ich besonders stolz auf das Buch Existenzielle Psychotherapie bin. Es war am schwersten zu schreiben; ich habe jahrelang lesen müssen, bis ich in der Lage war, es zu Papier zu bringen – übrigens im Wortsinn: Ich habe es nämlich mit Bleistift auf gelbes, blau liniertes Papier geschrieben – das war kurz vor der Einführung der Textverarbeitung, und tippen konnte ich auch nicht.
Ich weiß noch genau, wie ich mich bei meinem alten Freund Alex Comfort, dem Schriftsteller, beklagte, ich könne einfach den Anfang nicht finden. Ich erzählte, dass ich jahrelang unaufhörlich gelesen und viele Philosophie-Seminare an der Universität Stanford besucht hätte und trotzdem blockiert sei. Alex Comfort kannte sich mit den Problemen des Schreibens aus; er hat neben Joy of Sex, das ihn berühmt gemacht hat, über fünfzig weitere Bücher geschrieben – medizinische und geriatrische Abhandlungen, Romane und auch einige Gedichtbände. Er hörte geduldig zu und sagte dann: »Dein Thema ist so groß, dass du mit dem Lesen nie fertig wirst. Ich mache dir einen Vorschlag: Hör auf zu lesen und fang an zu schreiben! Morgen!« Diesen Rat habe ich befolgt und gleich am nächsten Morgen mit dem Schreiben angefangen – und dann jeden weiteren Morgen, dreieinhalb Jahre lang.
Existenzielle Psychotherapie war ein Wendepunkt in meiner Laufbahn als Autor. Vorher hatte ich über eine Reihe von Themen geschrieben, die nachfolgenden Bücher dagegen waren fast ausschließlich Variationen verschiedener Motive aus diesem Buch. Was ich dort geschrieben und skizziert habe, bildet den Fokus aller weiteren Bücher, aber die Form hat sich verändert. Nachdem Existenzielle Psychotherapie erschienen war, wurde mir klar, dass sich die subjektiven Reaktionen auf die Wechselfälle des Lebens in fachlicher Prosa nur unzureichend beschreiben lassen, und ich habe mich wie viele existenzielle Denker vor mir entschieden, die Konfrontation mit den existenziellen Fakten des Lebens in einer anschaulicheren literarischen Form zu beschreiben.
Existenzielle Psychotherapie ist also die Quelle, sozusagen die Mutter all der Romane, Geschichten und Leitfäden für Kliniker, die ich seit 1980 geschrieben habe, und aus diesem Buch sind andere entstanden wie Die Liebe und ihr Henker, Die Reise mit Paula, Die rote Couch, Und Nietzsche weinte, Die Schopenhauer-Kur.
Von Zeit zu Zeit habe ich darüber nachgedacht, Existenzielle Psychotherapie zu überarbeiten, aber dann schien es mir absurd, Material zu bearbeiten, das sich mit den zeitlosen Quellen des Leidens beschäftigt – Leiden, das die Menschen seit dem Entstehen der Selbstbewusstheit erleben. Doch so zeitlos das Thema auch sein mag, der Autor ist es nicht. Wenn ich den Text überarbeiten sollte, dann würde ich das mit aufnehmen, was ich in den Jahren seit der Veröffentlichung gelernt habe: weitere Einzelheiten aus der psychotherapeutischen Praxis und über die großen Leistungen von Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche, zwei Philosophen, die für mich sehr wichtig geworden sind.
Die Fragen und Kommentare der Leser, die mich im Lauf der Jahre erreicht haben, haben mich bewogen, bestimmte Aspekte aus der Praxis der existenziellen Psychotherapie deutlicher zu machen, die ich im Text nur angerissen und nicht ausgeführt habe. Besonders häufig werde ich gefragt: Wo gibt es die besten Ausbildungsprogramme für existenzielle Psychotherapie? Mir ist bei dieser Frage nicht wohl: ich benutze heute den Begriff »existenzielle Psychotherapeuten« nur sehr selten und spreche lieber von »existenziell sensiblen«, »existenziell orientierten« oder »existenziell gestimmten« Therapeuten. Ich glaube nicht, dass existenzielle Therapie eine eigenständige, unabhängige ideologische Schule sein kann. Man kann angehende Therapeuten nicht von Anfang an zu existenziellen Therapeuten ausbilden, sondern sollte ein volles, abgerundetes psychotherapeutisches Ausbildungsprogramm durch existenzielle Sensibilität quasi veredeln.
Dafür ein anschauliches Beispiel: Vor kurzem kam Felix, ein fünfzigjähriger Zahnarzt, zu mir in Behandlung, der nach dem Tod eines nahen Freundes unter anhaltender chronischer Todesangst litt. Er wurde fast jede Nacht von Todesängsten überschwemmt und hatte viele Aktivitäten (wie Autofahren, Skifahren und Schwimmen) aufgegeben, weil sie ihm zu gefährlich schienen. Bei der Exploration von Todesängsten, so habe ich festgestellt, sind Nietzsches Bemerkungen über die Vollendung des eigenen Lebens und den richtigen Zeitpunkt des Sterbens ausgesprochen nützlich. Ich glaube, dass es zwischen Todesangst und erfülltem Leben einen Zusammenhang gibt: je größer das ungelebte Leben, desto größer die Verzweiflung. Also fragte ich Felix, ob er das Gefühl habe, sein Leben ganz gelebt zu haben, oder ob er ungelebtes Lebens in sich spüre.
Felix ging auf diese Frage ein und sprach lange über seine brachliegende Kreativität. Obwohl er ein begabter Maler war, hatte er seit Jahren nichts mehr gemalt. Auf die Frage nach dem Grund für diese Vernachlässigung seines kreativen Selbst antwortete er: »Zu viel zu tun, zu beschäftigt mit Geld verdienen!« Doch wie ich bald erfuhr, verdiente er mehr Geld, als er brauchte. Die weitere Exploration ergab, dass die Triebkraft dahinter eine implizite Konkurrenz mit seiner Frau – ebenfalls Zahnärztin – war, die sich um die Frage drehte, wer mehr verdiente.
»Was würden Sie über diesen Lebensplan denken, wenn Ihr Leben jetzt zu Ende wäre?« fragte ich.
»Verheerend«, antwortete er, »ein weggeworfenes Leben«.
Die nächste Phase unserer Arbeit konzentrierte sich auf seine Ehe, auf die anhaltenden Auseinandersetzungen und die Unzufriedenheit mit seiner Frau und mit anderen wichtigen Frauen aus seiner Vergangenheit und Gegenwart. Danach untersuchten wir seine tiefe Neigung, über andere zu ›richten‹ – über mich, über alle Menschen in seiner Umgebung. Diese Untersuchung führte zurück zu der Unfähigkeit zu malen – er schien Angst vor Kritik zu haben und nicht bereit zu sein, die Grenzen seiner Kreativität auszuloten, sondern wollte die Vorstellung potenzieller Größe bewahren.
Was ich damit sagen will, ist, dass bei diesem Patienten wie bei fast allen anderen die therapeutische Exploration einer existenziellen Angst den Weg zu einer Reihe interpersonaler und innerpsychischer Bereiche gebahnt hat. Der Therapeut muss in der Lage sein, den Patienten dorthin zu begleiten, wo der Weg hinführt.
Noch ein paar Worte über die Alltagspraxis einer existenziell gestimmten Therapie: Obwohl ich das Buch für ein Fachpublikum geschrieben habe, haben viele Patienten, die es gelesen haben (meist solche mit einer tödlichen Erkrankung), gesagt, sie hätten von dem existenziellen Ansatz profitiert. Aber zur Psychotherapie gehört in der Regel mehr als nur die Vermittlung von Inhalten.
Wie sieht existenzielle Psychotherapie in der Praxis wirklich aus? Will man diese Frage beantworten, muss man auf den »Inhalt« und auf den »Prozess« achten, also auf die beiden wichtigen Aspekte des therapeutischen Diskurses. »Inhalt« heißt genau das – die exakten Worte, die gesprochen, die wesentlichen Themen, die angesprochen werden. »Prozess« bezieht sich auf eine ganz andere und ungeheuer wichtige Dimension: auf die interpersonale Beziehungzwischen Patient und Therapeut. Wenn wir nach dem »Prozess« einer Interaktion fragen, meinen wir: Was sagen die Worte (und das nonverbale Verhalten) über das Wesen der Beziehung zwischen den an der Interaktion beteiligten Parteien aus?
Wenn wir also meine Therapiesitzung beobachten, welchen Inhalt und welchen Prozess können wir dann erkennen? Betrachten wir zunächst den Inhalt: Hier wird der Beobachter oft vergeblich auf ausführliche, explizite Diskussionen über Tod, Freiheit, Sinn oder existenzielle Einsamkeit warten. Ein solcher existenzieller Inhalt wird nur für einige (aber nicht alle) Patienten in einigen (aber nicht in allen) Phasen der Therapie wichtig sein. Ein effektiver Therapeut sollte nie versuchen, Diskussionen über einzelne inhaltliche Bereiche zu erzwingen: Therapie darf nicht theorie-, sondern muss beziehungsgeleitet sein.
Betrachten wir jetzt den Prozess. Achtet man in denselben Sitzungen auf einen charakteristischen, aus einer existenziellen Orientierung abgeleiteten Prozess, wird man etwas ganz anderes erkennen: Eine erhöhte Sensibilität für existenzielle Fragen hat großen Einfluss auf das Wesen der Beziehung von Therapeut und Patient und berührt jede einzelne Therapiesitzung. Denn Therapeut und Patient sind mit denselben Lebenstatsachen konfrontiert und müssen beide die Angst bewältigen, die aus den vier existenziellen Fragen entsteht, die in diesem Buch beschrieben werden. Es gibt hier kein wir (die Therapeuten) und sie (die Leidenden). Es ist uns gemeinsam, wir sind Reisegefährten – oder, wie Schopenhauer sagt: Leidensgefährten –, und die Grundlagen effektiver Therapie sind tiefe Fürsorge und Empathie für unsere Patienten und die Schaffung einer echten Begegnung.
Denken Sie daran: In der existenziell sensiblen Therapie gibt es eine dynamische adaptive Spiralbewegung zwischen Inhalt und Prozess. Das alte Sprichwort: Es ist die Beziehung, die heilt, gilt für den existenziellen genauso wie für jeden anderen psychotherapeutischen Ansatz. Aber die existenziellen Fakten des Lebens sind eine Richtschnur für eine tiefere, reichere Beziehung zu denen, die unsere Hilfe suchen. Und wenn eine solche Beziehung erst einmal da ist, kann der Patient nicht nur die Basis seines persönlichen Lebens – seine Geschichte und seinen Alltag – tiefer erkunden, sondern auch die Basis seiner Existenz.
Irvin D. Yalom, 2005