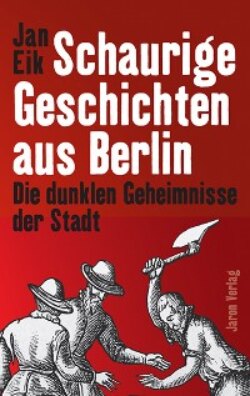Читать книгу Schaurige Geschichten aus Berlin - Jan Eik - Страница 9
Huren, Hexen, Zauberer
ОглавлениеEine unabhängige Justiz?
Wer da glaubt, unsere Altvorderen hätten es sich mit der Justiz leichtgemacht, der irrt. Betrachtet man allerdings die Zeit, die einst zwischen der Tat, der Anklage, dem Urteil und dessen Vollstreckung verging, so können wir Späthinteren von so kurzen Zeiträumen nur träumen.
Joachim Nestor belieh 1508 den Rat von Berlin und Cölln mit der oberen und unteren Gerichtsbarkeit, die vorher als Lehen in den Händen von Einzelpersonen gelegen hatte. 1536 mussten die Städte das untere Stadtgericht für 2250 Gulden erneut vom kurfürstlichen Küchenmeister Hans Tempelhof erwerben.
Bei todeswürdigen Verbrechen war es im 16. Jahrhundert üblich, das Urteil vom Schöffenstuhl in Brandenburg sprechen oder zumindest bestätigen zu lassen. Auch als das Berliner Kammergericht zwischen 1617 und 1632 zeitweilig Strafprozesse führte, schickten die überlasteten Räte die Akten gerne nach Brandenburg. Ab 1611 gestattete ein Landtagsabschied, dass in peinlichen Sachen fortan auch das Urteil von der Frankfurter Juristenfakultät geholt werden dürfe – um die Landesuniversität zu fördern!
Natürlich war die Justiz nicht unabhängig. Der Kurfürst musste die Urteile bestätigen und griff häufig genug direkt oder durch seine Räte ein. Als 1624 beispielsweise 13 Soldaten Pferde gestohlen hatten und erklärten, sie hätten keinen Raub begehen wollen, gedachten die Schöffen und Richter, sie nicht ohne klares Geständnis hinrichten zu lassen. Der Dompropst und die Kurfürstin verwandten sich für die Diebe, und Kurfürst Georg Wilhelm begnadigte fünf von ihnen.
Die Strafen waren im Allgemeinen drakonisch. Jedoch verschwanden die mittelalterlichen Gottesurteile allmählich, bei denen die Angeklagten, um ihre Unschuld zu beweisen, furchtbaren Prüfungen ausgesetzt wurden, die sie nur mit der besonderen Gnade Gottes bestehen konnten. In Berlin mussten die Beschuldigten ohne Brandverletzungen ein glühendes Eisen von bestimmtem Gewicht neun Schritte weit tragen, unverletzt einen Ring oder Stein aus einem Kessel siedenden Wassers fischen oder im Zweikampf gegen den Prozessgegner den Sieg davontragen.
Der Todeswürfel
Die häufig überlieferte Berliner Sage vom Todeswürfel verlegt ein solches Gottesurteil noch in die Zeit des Großen Kurfürsten. Da habe in Berlin ein wohlhabender Waffenschmied gelebt, der eine wunderschöne Tochter besaß. Zwei Leibtrabanten des Kurfürsten, Heinrich und Rudolf, entbrannten in Liebe zu der liebreizenden Jungfrau, die sich jedoch anfangs für keinen zu entscheiden vermochte. Erst als der stillere Heinrich durch eine überraschende Erbschaft plötzlich zu Geld gekommen war und er überdies den alten Waffenschmied eines Abends vor den Misshandlungen roher Gesellen zu schützen wusste, wandte sie sich ihm zu. Rudolf, mit heftigerem Charakter, verging fast vor glühender Eifersucht und schlich den beiden auf Schritt und Tritt nach. Als er sie eines Abends beim Abschied am Brunnen belauerte, brachten ihn die Liebkosungen, die das Mädchen Heinrich gewährte, derartig in Wut, dass er mit dem Schwert auf die Ärmste einstach, kaum dass Heinrich verschwunden war.
Man fand das Mädchen in seinem Blut liegend. Der Mordverdacht fiel zwar sofort auf Rudolf, dessen Eifersucht bekannt war, aber auch Heinrich, der noch kurze Zeit zuvor mit dem Mädchen gesprochen hatte, kam als Täter in Frage.
Der unglückliche Vater verlangte vom Kurfürsten die Bestrafung des Verbrechers. Der ließ auch wirklich die beiden Trabanten verhaften. Beide leugneten die Tat entschieden und legten auch auf der Folter kein Geständnis ab. Der Kurfürst wollte deshalb kein Urteil fällen, sondern stellte die Entscheidung Gott anheim. Er befahl, die beiden sollten um ihr Leben würfeln; wer den höheren Wurf tat, sollte als unschuldig gelten.
Vor der Front der angetretenen Leibtrabanten wurde eine Trommel aufgestellt, dabei stand ein Geistlicher, und unweit davon wartete der Sarg auf den Unterlegenen. Vergeblich forderte Heinrich noch einmal von seinem Kameraden, sich schuldig zu bekennen. Der nahm wortlos die beiden Würfel und warf zwei Sechsen auf das Trommelfell. Damit war Heinrich so gut wie gerichtet. Doch der ließ sich nicht beirren, flehte zu Gott, er möge ein Zeugnis seiner Unschuld ablegen, und warf die Würfel so heftig auf die Trommel, dass der eine in zwei Teile zersprang, die eine Sechs und eine Eins zeigten. Auch der zweite zeigte die Sechs, so dass nun 13 Augen auf der Trommel lagen. Rudolf, von diesem offenbaren Gericht Gottes ergriffen, stürzte wie vom Blitz getroffen zu Boden und leugnete seine Schuld nicht länger. Der Kurfürst verurteilte ihn zu ewigem Gefängnis, um ihm Zeit zur Reue zu lassen, doch er verfiel im Kerker dem Wahnsinn und erhängte sich. Auch Heinrich wurde seines Lebens nicht mehr froh. Er suchte und fand den Tod in der Schlacht. Der zersprungene Todeswürfel aber wurde noch lange in der Kunstkammer des königlichen Schlosses in Berlin aufbewahrt.
Der Kaak
Die Strafen des Stäupens (Züchtigen mit Ruten) und des Prangerstehens im Halseisen an der Schandsäule wurden für Verurteilte, denen Schimpf und Schande angetan werden sollte, gleich unter dem Kaak an der Gerichtslaube des alten Berliner Rathauses vollzogen. Die noch heute vorhandene Kopie des Kaak stellt einen großen Vogel mit Flügeln, Eselsohren und einem verzerrten Menschengesicht dar. Die Gerichtsstube lag über der Durchfahrt zur Ratswaage, darüber befand sich im Dachboden die Folterkammer. Im Keller des Rathauses gab es ein Gefängnis, den sogenannten Krautgarten. Hinrichtungen durch das Schwert fanden jahrhundertelang vor beiden Rathäusern statt, bis sich im Jahre 1694 die Anwohner des Berliner Rathauses wegen der damit verbundenen häufigen Verkehrsstörungen beschwerten. Erst dann wurde das Hochgericht auf den Neuen Markt verlegt.
Die Gerichtslaube, ein Anbau am alten Berliner Rathaus, ist heute gleich zweimal als Rekonstruktion vorhanden. Da sie 1872 dem Neubau des Roten Rathauses im Wege war, versetzte man das offene Gebäude in den Schlosspark Babelsberg. Hundert Jahre später passte es den Bauherren des Nikolaiviertels ins historisierende Konzept, eine Gaststätte in der Poststraße als zweite Kopie der Gerichtslaube zu errichten.
Das Hurenhaus
Mag die Gerichtslaube in alten Zeiten das Ihre zur Unterhaltung der Berliner beigetragen haben – andere Häuser liefen ihr dabei vermutlich den Rang ab, und der Rat hatte auch daran seinen Anteil. Bereits um 1400 wird von einem Freudenhaus berichtet, von dem der Rat jährlich zwei Schock Groschen kassierte. Zwanzig Jahre später ist das Hurenhaus zu Berlin ganz eingerissen und neu aufgebaut worden. Die feilen Dirnen darin durften nicht durch Winkelhurerei auffällig werden, darüber wachte der für sie verantwortliche Scharfrichter. Der hatte um 1580 alle Frauen, die außerhalb des Freudenhauses Unzucht trieben, aus der Stadt zu trommeln. Wo sich das Haus einst befand, weiß der Chronist Schmidt zu berichten:
Die jetzige Rosen-Strasse hat Anfangs die Huren-Strasse geheißen. Das liederliche Frauen-Volck hat der Strasse den Nahmen zuwege gebracht, denn es wurden dieselbigen an einen Karren mit zwey Rädern geschlossen, und mussten den Gassen Unflath in die dazu gemachten Grufften zwischen den Wall und Mauer fahren. Weil hernach einige Hoff-Trompeter anbaueten ward sie die Trompeter Strasse, da aber dieselbigen ausgestorben, die Rosen-Strasse genennet.
Im Jahre 1603 sandte Kurfürst Joachim Friedrich ein »Mandat an alle Pfarrern, bey Verlust ihres Pfarr Amts auff den Concubinat acht zu haben gegen Unzucht und Hurerey«. Erfolg war dem Papier anscheinend nicht beschieden. Kurfürst Friedrich III., der spätere König, verschärfte 1690 die Strafen gegen die öffentliche Unzucht.
Der Soldatenkönig erließ am 31. März 1718 gar ein »Allgemeines Edict wegen Abstellung des Voll-Sauffens, und daß die Trunckenheit in denen Delictis nicht entschuldigen sondern die Strafe vermehren soll … Weil unter dem Vorwand des Gesundheit-Trinckens ein grosser Mißbrauch vorgehet.«
Gehurt und gesoffen wurde dennoch weiter, Berlin war nicht umsonst eine Stadt der Bierbrauerei und allgemeinen Zecherei, und an feilen Damen fehlte es nicht einmal in der besten Gesellschaft.
1795 wies Berlin mit seinen 173 000 Einwohnern 66 registrierte Bordelle mit 257 polizeilich inskribierten Dirnen auf, streng preußisch geführt nach dem königlichen Lusthaus-Reglement und eingeteilt in drei Klassen. Die Stuben waren nummeriert; das Mobiliar bestand aus einem Feldbett und einem Leuchter!
Bald standen etwa hundert Freudenhäuser mit je fünf bis neun Lustdirnen unter Aufsicht der Polizei. Die Frauen mussten sich regelmäßigen Gesundheitsuntersuchungen unterziehen. Strafen setzte es nur noch, wenn jemand zu Schaden kam oder öffentliches Ärgernis erregte.
Jeder Bordellwirt musste »monatlich für jede Lohnhure, die er hält, sechs Groschen« in die Heilungskasse zahlen. Dafür sollte »jede infizierte Lohnhure sofort in die Charité« eingeliefert werden, und die – 1726 im unbenutzten Pesthaus von 1710 eingerichtet – leistete nach dem Urteil eines Zeitgenossen »mehr für die Dezimierung der Berliner Bevölkerung als die Guillotine in anderen Städten«. Dies vor allem, als sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Berlin die Syphilis seuchenartig ausbreitete.
Hexenverbrennungen
Wie überall in Deutschland ging man in alten Zeiten nicht nur den Dirnen an die Wäsche. Auch im protestantischen Brandenburg fanden Hexenverbrennungen statt, war doch selbst der Doktor Luther der Meinung, Hexen müsse man verbrennen und in solchen Fällen mit der Strafe eilen, ohne auf die Bedenklichkeiten der Juristen zu hören.
Der erste Fall einer Bestrafung wegen Zauberei ist aus dem Jahr 1390 überliefert. Eine alte Frau sollte einer anderen zwei Giftbeeren gegeben haben und erlitt deswegen den Tod durch das Feuer. Ein ähnlicher Fall ereignete sich 1423, als ebenfalls eine alte Frau verbrannt wurde. Die Chronik scheint hier lückenhaft, denn angeblich erst 1552 wurde wieder eine Zauberin angeklagt und verbrannt. Als die Flamme des Scheiterhaufens hochschlug, sei ein Reiher darin verschwunden und mit einem Stück vom Pelze (?) der Hingerichteten davongeflogen. Im Jahr darauf verbrannte man zwei »Zauberhuren, weil sie ein gestohlenes Kind zerstückelt und gekocht hätten, um mit dem daraus gewonnenen Zaubermittel Theuerung (!) im Land anzurichten«.
Carions Weissagung
Die Hohenzollern waren besonders abergläubisch. Joachim Nestor hatte für seinen Astrologen Carion eine Sternwarte einrichten lassen und galt selbst als halber Zauberer. Carion weissagte sogar den Namen des Schutzengels des Prinzen Johann: »Bathsitihadel«. Es fand sich keiner, der einen anderen Namen für den Engel kannte.
Zu jener Zeit kursierte eine berühmte Weissagung, im Februar 1524 würde die Welt untergehen. Carion jedoch ermittelte einen Fehler in der Berechnung und prophezeite die Sündflut für den 15. Juli 1525. Es war ein strahlender Sommertag. Der Hofstaat zog dennoch mit Kisten und Kasten auf die höchste Erhebung von Berlin, den heutigen Kreuzberg. Allmählich breitete sich dumpfe Gewitterschwüle aus, und der Himmel bezog sich. Dann jedoch brach die Sonne durch, und die Wolken lösten sich auf. Nachdrücklich forderte die Kurfürstin Elisabeth zur Rückkehr auf. Unter dem Gespött, noch mehr aber unter dem Gemurre der Berliner zog die Kavalkade in die Stadt ein. Als sie auf den Schlossplatz einbog, schoss plötzlich ein Feuerstrahl aus den neuerlich aufgezogenen Wolken.
Joachim sank betäubt zusammen, der Regen stürzte wie aus Kannen vom Himmel. Als der hohe Herr zu sich kam, lag der Kutscher tot aus dem Wagen herausgeschleudert auf dem unbefestigten Platz. Außer ihm hatte der Blitz vier der acht Pferde erschlagen. »Sunsten hat das Wetter keinen Schaden mehr getan …«, merkt ein Chronist an. Es trifft eben immer die Falschen.
Am zweiten Weihnachtstag desselben Jahres hörte Joachim in der Kirche der schwarzen Brüder vor dem Schloss die Weihnachtspredigt. Der rotgesichtige Mönch auf der Kanzel erging sich in wüsten Drohungen gegen Luther, donnerte mit den Fäusten auf das Holz – und brach vom Schlag gerührt zusammen. Die Kurfürstin Elisabeth zog es vor, bald darauf ins lutherische Sachsen zu entfliehen.
Die letzte preußische Hexe
Ein Edikt des Großen Kurfürsten befahl 1679 den Kriminalrichtern Berlins mit Nachdruck, alle Hexen der Mark zur Verantwortung zu ziehen. Hexenprozesse blühten auf, als sie anderswo bereits abflauten; noch 1692 wurde in Berlin Daniel Krösing wegen ausgestoßener Gotteslästerungen enthauptet.
Erst der Soldatenkönig machte den Hexenprozessen ein Ende. Ein junges Mädchen, Dorothea Steffin, hatte angeblich am Wedding vor den Toren Berlins einen vornehmen jungen Mann in blauem Rock und gestickter Weste kennen und lieben gelernt. Sie traf ihn auf der Langen Brücke in Berlin wieder, schlief wiederum mit ihm und schloss angeblich einen Pakt mit ihm. Er sei der Teufel, erklärte er und ließ sie ein Dokument mit ihrem Blut unterzeichnen.
Im Kalandshof wegen ihres unsittlichen Lebenswandels eingesperrt, gestand die Steffin nach einem Selbstmordversuch ihre Beziehung zum Teufel. Damit wäre ihr Schicksal besiegelt gewesen. Gemäß den modernen Ansichten eines Thomasius wurde sie jedoch von einem Richter und einem Arzt vernommen und begutachtet und wand sich dabei in Krämpfen. Im Prozess konnten sich die Reformisten unter dem Kammergerichtsrat Wagner durchsetzen. Da Friedrich Wilhelm I. sich das Urteil beziehungsweise dessen Bestätigung vorbehalten hatte, wurde der Fall dem Staats- und Kriegsminister Samuel von Cocceji, dem späteren Rechtsreformer und Großkanzler des Alten Fritzen, vorgetragen. Cocceji, wie schon sein Vater ordentlicher Professor der Rechte an der Universität zu Frankfurt an der Oder, entschied, Dorothea Steffin habe am Leben zu bleiben.
Am 10. Dezember 1728 erging das Urteil:
Obwohl es das Ansehen habe, daß die Inquisitin wegen des Bündnisses mit dem Teufel mit dem Feuer oder doch mit dem Schwerte zu strafen sei, zumal sie einen höchst unsittlichen Lebenswandel geführt habe, so könne doch das Bündnis mit dem Teufel auch Effekt der Schwermütigkeit sein … Damit sie aber durch ein liederliches Leben und Versuchen des Selbstmordes nicht ferner in dem Wege des Satans sich verstricken könne, sei sie lebenslänglich in das Spandauer Spinnhaus zu bringen und zu leidlicher weiblicher Arbeit anzuhalten, ihr auch dort Arznei und geistlicher Zuspruch zu erteilen. Von Rechts wegen.
Die neue Sittlichkeit
Der weniger geschätzte Gatte der allseits beliebten Königin Luise, der Lady Di der Freiheitskriege, beschloss um 1810, die Straßen Berlins von allen Lusthäusern zu säubern, was natürlich nicht gelang. Fortan konzentrierte sich das unausrottbare Gewerbe im schmuddeligen Viertel Hinter der Königsmauer, also etwa zwischen Bahnhof Alexanderplatz und Fernsehturm, und gelangte dort, der strengen Reglementierung endlich entronnen, zu unerwarteter Blüte. Außerdem boten bald »Frey-Dirnen« überall in der Stadt ihre Dienste an. Als 1846 für die nächsten 140 Jahre der Betrieb von Bordellen verboten wurde, hatte sich das horizontale Gewerbe mit seinen etwa 15 000 Prostituierten längst anderweitig etabliert, und die gestrenge Polizei übersah geflissentlich die »Lasterhöhlen«, in denen die Herren aus höchsten Kreisen verkehrten. Die Berliner Sittenlosigkeit, die Nutten und ihre Luden, erlangte sprichwörtlichen Ruhm, schätzte man doch in den Goldenen Zwanzigern mehr als 25 000 illegale Prostituierte.
Die Szene überdauerte Weltkriege und Inflation und lebte im Nachkriegsberlin neu auf. Offiziell beschränkte sich die Prostitution nun allerdings auf den West-Berliner Frontstadtsumpf. Im Osten gingen die Damen (und ausgewählte Knaben) in höchst geheimer Mission und mit staatlicher Duldung und Anleitung ihren devisenträchtigen Diensten nach, galt es doch, nicht weniger als das sozialistische Vaterland im Auftrag des Ministeriums für Staatssicherheit vor dem nimmermüden Klassenfeind zu schützen.