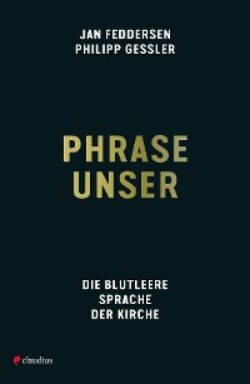Читать книгу Phrase unser - Jan Feddersen - Страница 7
KAPITEL 2 Kennzeichen der kirchlichen Sprache
ОглавлениеWenn der Berliner Historiker Paul Nolte, Sohn eines Pfarrers, ehrenamtlicher Präsident der Evangelischen Akademie zu Berlin und Mitglied der EKD-Synode, die kirchliche Sprache beschreiben soll, dann fällt ihm schon nach wenigen Minuten Otto Waalkes ein. Der ostfriesische Komiker erzählt in seinem Sketch „Das Wort zum Montag“, dass er neulich in seiner Musikbox geblättert und die Zeile gefunden habe:
„‚Theo, wir fahr’n nach Lodz!‘
Nun, was wollen uns diese Worte sagen?
Da ist von einem Menschen die Rede. Von einem ganz bestimmten Menschen. Nicht Herbert, nicht Franz, nicht Willy, nein, Theo ist gemeint. Aber um welchen Theo handelt es sich? Ist es nicht auch jener Theo in uns allen? Jener Theo, der in so wunderbaren Worten vorkommt, wie Theologie, Theodorant, Tee oder Kaffee? Und an diesen geheimnisvollen Theo ist eine Botschaft gerichtet:
‚Theo, wir fahr’n nach Lodz!‘
Vier fahr’n. Da sind also vier Menschen unterwegs. Und wer sind diese vier? Sind es die vier Jahreszeiten? Die vier Musketiere? Oder sind es vier alle?“
Der Sketch von Otto ist über 40 Jahre alt – und schon damals wies die kirchliche Sprache bestimmte Eigenheiten auf, die so deutlich waren, dass sie leicht persifliert werden konnte. Zum Beispiel das „Wir“. Es ist noch heute ein häufiges Kennzeichen der kirchlichen Sprache, der Gebrauch der ersten Person Plural: „Lass uns“ oder „Wir“. Es ist ein umarmendes Wir – wie auch bei „Uns alle“. Der Münchner Theologe Friedrich Wilhelm Graf argumentierte schon vor Jahren, die evangelische Kirche predige zu häufig einen „Kuschelgott“, was einher gehe mit einem „Umstellen auf einen Psychojargon, in dem es permanent um das ‚Fühl dich wohl‘ geht und in dem elementare Spannungen und Widersprüche des Lebens kaum noch eine Rolle spielen … Aber es käme doch gerade darauf an, die existenziellen Spannungen des Lebens religiös zu deuten und nicht einfach durch ein bisschen Wohlfühlrhetorik zum Verschwinden zu bringen“.
Wodurch ist die kirchliche Sprache gekennzeichnet? Sie ist, gerade beim Predigtton, zum einen häufig stark moralisierend und wertend. Sie arbeitet oft mit rhetorischen Fragen und benutzt nicht selten Wortspiele, die manchmal ins Kalauerhafte abrutschen – in der Hoffnung, darüber erschlössen sich neue Bedeutungen.
Wie stark die kirchliche Sprache ist, zeigt sich darin, dass man in sie verfallen kann, auch wenn man das gar nicht will. Auch Geistliche, die sehr bewusst, ja manchmal brillant mit der Sprache umgehen, wie etwa der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck, sind sich der Verlockung der kirchlichen Sprache bewusst, gerade weil sie nach vielen Jahren im geistlichen Amt so leicht über die Zunge geht: „Es gibt Worte, die ich versuche, aus meinem Wortschatz zu eliminieren – aber manchmal rutschen sie auch mir durch. Das Wort ‚gleichsam‘ oder ‚Ein Stück weit‘ – beides kommt häufig vor. Ebenso die Wörter oder Redewendungen ‚vielleicht‘, ‚bedeutsam für die Seele‘ oder ‚Jesus würde es heute vielleicht so sagen‘.“
Die kirchliche Sprache ist ein Gruppenidiom, in das man häufig hinein sozialisiert wird, zuerst wird es passiv verstanden oder gesprochen. „Aber ab einem bestimmten Punkt merkt man, dass man selbst anfängt, so zu ‚kirchlichen‘“, so beschreibt es der Münchner Theologieprofessor Reiner Anselm, Vorsitzender der Kammer für Öffentliche Verantwortung der EKD. Die kirchliche Sprache empfinden viele Kirchenleute fast wie einen Zwang, in den man gerät, sobald man einige Jahre für die Kirche arbeitet.
Der katholische Münsteraner Dogmatiker Michael Seewald zählt zur kirchlichen Sprache „Unworte“, die man eigentlich vermeiden wolle. Mit leichter Selbstironie sagt er: „Ich falle zum Beispiel auf die Wortkombination ‚immer wieder‘ selbst immer wieder herein, obwohl mich das bei anderen stört.“ Irgendwann aber habe man sich ein Reservoir an Phrasen kirchlicher Prägung zurechtgelegt. Und vielleicht stimmt es, was viele erfahrene Predigerinnen und Prediger sagen, dass man bei Predigten kaum um Floskeln herum komme.
Ein Problem der kirchlichen Sprache ist, dass sie auf einen oft veralteten Wort- und Bilderschatz von rund 2.000 Jahren zurückgreifen kann, der sich angesichts der intensiven Ausbildung der Theologinnen und Theologen mit dieser Tradition allzu leicht in die heutige Sprache hinein schleicht.
Diese alte Tradition ist prägend. Manche sehen in dem „Kirchensound“ einen Ausdruck der kirchlichen Architektur der „Gestalteten Mitte“, die nur noch Insidern etwas sagt oder nur noch sie bewegt. In den Schaukästen oder den Gemeindebüros von Kirchengemeinden finden sich seltsame Poster, auf denen über Schafherden häufig Worte von gestern stehen. Es ist verführerisch, sich einer alten Sprache und der alten Bilder zu bedienen, ohne überhaupt darüber nachzudenken, ob sie heute noch verstanden werden, ob sie nicht schon längst in Klischees erstarrt sind. Dann wird etwa in großstädtischen Gemeinden permanent über Hirten und Könige gesprochen, „aber nicht über die U-Bahn, die einen nervt“, wie Petra Bahr, Regionalbischöfin in Hannover, konstatiert. Viele Theologinnen und Theologen beschreiben es so, dass sie leicht in diesen Sound hineinrutschen, wenn sie sich nicht vorher genug Gedanken gemacht hätten, zu wenig vorbereitet waren oder nicht hart genug mit dem Text, den sie auslegen wollen oder der Kirchenordnung gemäß auslegen sollen, gerungen haben. Und das Schlimme ist dabei noch, dass man oft mehr Lob bekommt, wenn man den „Kirchensprech“ bedient, als wenn man ihn zu vermeiden trachtet.
Die kirchliche Sprache ist eine Sprache, die viele Floskeln enthält. Es wird erzählt, was vermeintlich theologisch richtig ist. Dies ist eine Methode, um sich mit seinen eigenen Ansichten ganz gut verstecken zu können, denn dann muss man nicht sagen, was man selbst von einer Sache denkt. Oft werden dabei Formulierungen genutzt, wie man sie in klassischen dogmatischen Lehrbüchern findet, auch wenn man sie selbst überhaupt nicht mehr versteht, vielleicht nur kurz im Studium einmal verstanden hat.
Die ehemalige Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags und Co-Leiterin der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung, Ellen Ueberschär, spricht hier von „dogmatischen Richtigkeiten“, die gefahrlos genutzt werden können, denn sie entsprechen dem, was von einer Pfarrerin, einem Pfarrer erwartet wird. Aber es gibt dabei ein Problem: „In Andachten zum Beispiel erschließen sich die Texte so nicht, sondern man bleibt an der Oberfläche, die nur noch gut klingt“, sagt Ellen Ueberschär. Dazu gehören feste Redewendungen wie etwa: „Gott erhöre uns und schenke uns Frieden!“ Es ist fraglich, wem solche Redewendungen noch etwas sagen – auch wenn sie gemäß der christlichen Theologie nicht falsch sind.
Hinzu kommt, dass man die kirchliche Sprache als eine besondere Form eines Soziolekts begreifen kann, der sich aus gleichen Normen und Werten ergibt. Das ist auch nichts Erstaunliches. Viele Gruppen oder Milieus haben ihre eigene Sprache. Es gibt Soziolekte in der Wissenschaft, der Wirtschaft, im Sport, in der Kultur, ja selbst Junkies haben ihre eigene Sprache. Daran ist auch wenig verkehrt. Solche Soziolekte sind oft sinnvoll. Dadurch erkennen die Mitglieder einer Gruppe, wen sie vor sich haben – also Gleichgesinnte oder Fremde.
Eine gemeinsame Sprache, ein Soziolekt, verbindet, das ist ihr Vorteil. Ihr Nachteil ist, dass sie aber auch abgrenzt. Soziolekte schaffen Zugehörigkeit, sie stabilisieren die Identität der Sprechenden und den Zusammenhalt der Gruppe. Auch bei der Kirche ist das der Fall, mit vielleicht einer Besonderheit. Der Essener Kommunikationsforscher Jo Reichertz sagt: „Die Ziele Nähe, Aufrichtigkeit, Mitfühlen – das wären die zentralen symbolischen Verdichtungen der kirchlichen Sprache, um die sich alles dreht, um die es geht.“
Insofern ist es wahrscheinlich passender, den kirchlichen Duktus schlicht als eine Teilsprache des Deutschen zu bezeichnen. Es ist ein Soziolekt einer immer noch ziemlich großen Gruppe, die zumindest gelegentlich mit dieser Teilsprache zu tun hat – immerhin gibt es derzeit in Deutschland noch über 40 Millionen Christinnen und Christen, das ist etwa die Hälfte der Bevölkerung. Die kirchliche Sprache könnte man genauer wohl auch als ein Soziolekt sozialer Subsysteme in Sinne von Niklas Luhmann bezeichnen – aber das hilft ebenfalls nicht sehr viel weiter. Wichtiger ist, dass viele Worte der kirchlichen Sprache erst kirchenspezifisch werden durch die Verwendungskontexte, die Sprechhaltungen oder gar die Intonation, in denen sie genutzt werden. Otto Waalkes mit seinem „Vier fahren nach Lodz“ lässt da grüßen.
Der kirchlichen Sprache ist eigen, dass sie Aggressionen zu bremsen oder zu vertuschen trachtet und in einer passiv-aggressiven Form gleichwohl beim Gegenüber ein schlechtes Gewissen zu schaffen vermag. Es ist eine Sprache, die oft überhäuft ist mit Adjektiven, was in der Regel Zeichen eines schlechten Stils ist, – und die zugleich zu vielen Wertungen neigt. Insofern hat sie auch etwas Lehrer- oder Gouvernantenhaftes. Böse gesagt, neigt die kirchliche Sprache schon in ihrem Duktus zur Besserwisserei, was sie noch schwerer verdaulich macht.
Auch das Glossar in diesem Buch deutet an, dass häufig erst der Zusammenhang der Wörter und der Tonfall der Sprache die kirchliche Sprache ausmachen. Paul Nolte nennt ein Beispiel: „Ein Wort wie ‚eckig‘ passt manchmal rein, gerade weil die kirchliche Sprache nicht besonders eckig ist.“ Die Redewendung „aus Betroffenen Beteiligte machen“ klingt dagegen sowohl nach kirchlicher Sprache als auch nach dem Wörterbuch des Managements 2.0. Es kommt eben meistens auf die ganzen Wendungen an. Dabei ist auffällig, dass die kirchliche Sprache zu Aufblähungen neigt. So reicht es nicht, das Wort „berühren“ zu nutzen, es wird auch gern zu „Lass uns die Berührung suchen“ aufgebläht – gerade die alte „Sprache Kanaans“ neigt zu solchen Blähungen, die nicht mehr Inhalt, dafür umso mehr ungewollte Komik transportieren.
Wenn es stimmt, dass die Ziele der kirchlichen Sprache vor allem Nähe, Aufrichtigkeit und Mitfühlen sind, dann ist das schön – es hat aber auch einen Preis für diese Sprache. Einer ist, dass der kirchlichen Sprache und dem kirchlichen Duktus eine klare Widerrede, gar widersprechende Wörter kaum zur Verfügung stehen, sie sich damit zumindest schwer tut: Die kirchliche Sprache erlaubt kaum adversative Aussagen, die etwa sagen, man sei ein Idiot, die von ihm geäußerte Ansicht sei Schwachsinn – und überhaupt habe man von dem/der Sprechenden wenig Sinnvolles bisher gehört. Interessant ist, dass die kirchliche Sprache dabei oft zu Ich-Aussagen neigt, die eigentlich ein Ausweis von Emotionalität sein sollen, denn in dieser Form werden in der Regel Befindlichkeiten ausgedrückt. Aber das muss im kirchlichen Miteinander und deshalb auch in der Sprache in aller Regel hinter Adjektiven möglichst weit zurück gedrängt werden, so dass man diese Emotionen kaum mehr richtig wahrnimmt.
Es kommt bei der kirchlichen Sprache eben sehr darauf an, wie man etwas meint und wie man es versteht. „Wenn man dauernd darin kommuniziert, dann weiß man schon, wann eine rote Linie überschritten ist, wann da ein hochroter Kopf ist, der sich dahinter verbirgt“, sagt Reiner Anselm. Und mit etwas Selbstironie ergänzt der evangelische Professor: „Das erfordert ein hohes Maß an Selbstkontrolle – und das ist wieder etwas sehr Protestantisches.“ Diese Selbstkontrolle, das Hinter-das-Gesagte-Schauen, die vergifteten Ich-Botschaften – all das haben viele Theologinnen und Theologen, Pfarrerinnen und Pfarrer schon seit ihren Kinder- und Jugendtagen gelernt und verstanden. Es ist ein Lesen zwischen den Zeilen, und natürlich ist es auch eine Adaptionsleistung. Oder wie es Anselm in einem schönen Bonmot sagt: „Wenn jemand eine Ich-Botschaft los wird, weiß man schon, jetzt wird es kritisch.“