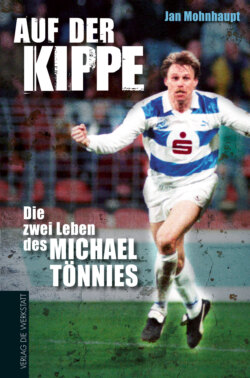Читать книгу Auf der Kippe - Jan Mohnhaupt - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAuf der Straße nach Schalke
(1960er bis 1981)
»Wir sind die letzten Helden des 20. Jahrhunderts, nach uns kommen nur noch Spieler aus Kunststoff.«
Horst Szymaniak, um 1965
Drinnen hat er es nie lange ausgehalten. Deswegen ist er auch nur kurz im Kindergarten gewesen. Weil er dort aber ständig geweint hat, wenn er nicht raus durfte, haben ihn seine Eltern bald wieder zu Hause gelassen. Mit drei oder vier Jahren haben sie ihn dann zum ersten Mal eine Zeitlang auf der Straße vor dem Haus spielen lassen. Michael wird zum Straßenkind; er will immer nur raus und mit den Jungs aus der Nachbarschaft Fußball spielen, eine Straße gegen die andere, jeden Tag. Anpfiff ist, wenn die Schule vorbei ist – und Schlusspfiff, wenn die Laternen angehen. Zum Glück hat er in der Schule nur selten Hausaufgaben zu erledigen, zumindest sagt er seiner Mutter das, damit er schnell nach draußen kann. Und das geht meistens so schnell, dass die anderen noch gar nicht da sind. Er rennt dann von Tür zu Tür, trommelt sie zusammen – und muss meistens warten. Die anderen haben Hausaufgaben bekommen.
Fußball spielt er überall, ob auf der Straße, auf der Wiese an der Anlage oder im Käfig. Der Käfig ist zwanzig mal vierzig Meter groß. Grauer Ascheboden, zwei Handballtore, umrandet von einem Gitterzaun. Dorthin geht er auch alleine, wenn sonst keiner Zeit hat zum Fußballspielen. Ohne Gegenspieler muss er sich selbst herausfordern. Er dribbelt los und versucht, den Ball besonders schön ins Tor zu schießen, mal genau in den Winkel, mal so, dass er vom Innenpfosten hineinspringt. Meistens gehorcht ihm der Ball. Wenn er geschossen hat, eilt er mit dem Ball am Fuß zum anderen Tor. Hin und her. Stundenlang macht er das. Im Käfig fühlt er sich wohl.
An der Straße vor dem Käfig ist eine Bushaltestelle. Auch wenn dort niemand ein- oder aussteigt, wartet der Busfahrer manchmal und beobachtet diesen Jungen, der wie ein Irrer alleine über den staubigen Platz rennt, immer von einem Tor zum anderen.
»Manchmal hat der Busfahrer schon mit dem Kopf geschüttelt, wenn er mich nur gesehen hat, und wohl gedacht, der hat auch nicht mehr alle Latten am Zaun. Einmal hatte ich einen nagelneuen Ball dabei. Der war weiß mit grünen Flicken und kostete damals 50 Mark. Wochenlang habe ich ihn mir im Schaufenster eines Sportgeschäfts angesehen und immer wieder gebettelt, bis meine Eltern ihn mir endlich gekauft haben. Mit dem Ball unterm Arm bin ich von Tür zu Tür gerannt und habe ihn meinen Kumpels gezeigt. Als wir dann auf dem Platz waren, hat es nicht lange gedauert, bis einer von denen den Ball über den Zaun geschossen hat. Der Ball rollte die Straße runter, genau auf den Bus zu, der dort stand. Vor einem der beiden Vorderreifen ist er liegen geblieben. Wir haben dem Busfahrer noch gewunken und zugerufen. Er muss das gesehen haben, aber er ist einfach losgefahren. Dann hat’s geknallt und der Ball war hin. Nur weil irgend so ein Amateur den über den Zaun gepöhlt hat.«
Ab und zu kommt auch sein Vater mit, wenn er nicht arbeiten muss. Werner Tönnies besitzt eine Gebäudereinigungsfirma, ein Knochenjob ist das, vor allem im Winter, wenn man aufpassen muss, dass einem das Putzwasser nicht an den Glasscheiben festfriert. Früher hat er unter Tage als Bergmann gearbeitet, aber das musste er irgendwann aufgeben, weil er davon eine Staublunge bekommen hat. Im Käfig stellt sein Vater leere Coladosen auf die Torlatte und Michael muss sie herunterschießen. Sie reden kaum, nur das leichte Klatschen beim Schuss, das Scheppern der Dosen und das zitternde Gitter, wenn der Ball dagegenprallt, sind zu hören. Sein Vater stellt die Dosen wieder auf, und Michael versucht sie wieder herunterzuschießen.
Werner Tönnies zeigt seinem Sohn auch den großen, den lauten Fußball. Hier im Essener Nordosten, an der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen und Wattenscheid, überlappen sich die Reviere der Bundesligaklubs. Nur manche fahren bis nach Dortmund ins Stadion Rote Erde – entweder geht man zu RWE an die Hafenstraße oder auf Schalke. Und solange Michael Tönnies denken kann, hat sein Vater ihn in die Glückauf-Kampfbahn mitgenommen. Sie fahren meist erst eine halbe Stunde vor Anpfiff los, dann ist das Stadion zwar schon voll, aber sie haben immer eine kleine Holzbank dabei, die sie in der Kurve hinter den Zuschauerreihen aufstellen. So können sie über die Köpfe der anderen hinwegschauen. Wenn Michael die Schalker Spieler auf dem Rasen sieht, stellt er sich vor, auch mal dort unten zu stehen, und sein Vater wünscht sich das insgeheim wohl auch.
Dass Michael ein guter Fußballer ist, haben seine Mitschüler in der Hauptschule an der Immelmannstraße auch bald bemerkt. Sie überreden ihn, mit zum Training zu kommen, und so geht er einfach mal mit. Der Jugendtrainer bei der Spielvereinigung Schonnebeck 1910 will ihn sofort dabehalten, und weil Michael sowieso immer Fußball spielt, spielt er nun auch hier. Bald darauf wird er zum ersten Mal in die Kreisauswahl Essen Nord/West berufen, mit der er als 13-Jähriger Niederrheinmeister wird. In der Kreisauswahl entdeckt er auch sein sportliches Idol. Bei einem Turnier in der Sportschule in Duisburg-Wedau schauen sich die Auswahlspieler gemeinsam einen Lehrfilm an. Darin zeigt Günter Netzer, wie man richtig passt und schießt. Netzer bewegt sich elegant, als wäre es reine Leichtigkeit, nie Anstrengung. Das imponiert Michael, so will er auch werden, denkt er sich – ein Spielmacher. Von nun an ist Netzer sein großes Vorbild, und wie Netzer läuft er am liebsten mit der Nummer 10 auf. Wenn er sich mit seinen Kumpels aus der Nachbarschaft im Käfig trifft, sagt er meistens schon: »Heut’ bin ich der Netzer.« Aber im Käfig spielt er alle Positionen. Manchmal ist er dann auch Dortmunds Stürmer Lothar Emmerich, manchmal sogar Bayern Münchens Libero Franz Beckenbauer – dann versucht er genauso überheblich und aufreizend den Ball zu führen wie Beckenbauer.
Nach zwei Jahren verlässt er die Schonnebecker wieder. Denn Rot-Weiss Essen, der größte Klub der Stadt, ist auf ihn aufmerksam geworden und holt ihn in seine Nachwuchsabteilung. Mit RWE wird Michael Stadtmeister. Sein Vater ist meist mit dabei, weil die Mannschaft immer Eltern braucht, die ein Auto haben und die Kinder zu den Auswärtsspielen fahren können.
Der Junge mit den großen Füßen
Eines Tages kommt ein Talentspäher auf Werner Tönnies zu. Er solle sich mit seinem Sohn mal bei Uli Maslo vorstellen. Maslo leitet die sogenannte Knappenschmiede, die Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04. Für Vater und Sohn geht damit ein Traum in Erfüllung: Nun könnte Michael selbst bald für ihren Lieblingsverein spielen.
Als sie das erste Mal zum Training der Schalker B-Jugendmannschaft kommen, hat die alte Glückauf-Kampfbahn als Bundesligastadion längst ausgedient. Vor der Weltmeisterschaft 1974 ist im Nachbarstadtteil Erle ein neues entstanden – das Parkstadion. Eine weite, flach abfallende Betonschüssel, die mehr als 70.000 Menschen fasst. Dort stehen nun Vater und Sohn auf der Tartanbahn im Schatten der zweistöckigen Tribüne. Sie fühlen sich ganz klein, als Uli Maslo vom Rasen langsam auf sie zukommt.
Der Junge hat ja unwahrscheinlich große Füße, denkt sich Maslo, als er auf die beiden zugeht. Vater Tönnies stellt seinen Sohn Michael vor, und Maslo sagt nur so etwas wie: »Wir freuen uns über jeden Spieler, der bei uns mithält.« Was man als Trainer eben so sagt, wenn ein neuer Spieler kommt, den man nicht kennt.
Neben der Fitness legt Maslo vor allem Wert auf die Schusstechnik seiner Spieler. Er zeigt ihnen, dass sie beim Spannstoß den Fuß strecken und die Fußspitze nach unten drücken müssen, damit der Ball nicht flattert, dass sie beim Schuss genau auf die Stelle des Balles schauen müssen, an der sie ihn treffen wollen. Und dass der Ball dort hinfliegt, wohin die Fußspitze zeigt. Maslo bemerkt, dass der Junge seine übergroßen Füße gut einzusetzen weiß: »Micha hatte einen sauberen Spannstoß. Er konnte als B-Jugendlicher aus 30 Metern aufs Tor schießen, und das war dann auch ein strammer Schuss, da war richtig was hinter. Aber das ist keine Frage der Kraft, sondern nur der Technik.«
Uli Maslo besucht seine Spieler auch in der Schule. So hält er Kontakt zu ihren Lehrern, damit sie die Jungen auch mal für Sondereinheiten während des Unterrichts freigeben. Seinen Spielern zeigt er damit, dass es um mehr geht als nur Fußball zu spielen: »Wir waren ja keine Pfadfindertruppe, wo es egal war, wie wir kickten.« Denn die Ausgaben für den Talentschuppen kann Präsident Günter Siebert vor dem Vorstand nur rechtfertigen, wenn die Mannschaften erfolgreich sind. »Je mehr Titel wir holen, desto besser«, sagt Siebert zu Maslo.
Vier Jahre lang spielt Michael in der Schalker Jugend. Vier Jahre, in denen er kaum ein Spiel verliert. 1976 wird er mit der B-Jugend Westdeutscher Meister: Mit vier Toren – drei davon innerhalb von zwölf Minuten – ist Michael der »Star des Spiels« im Halbfinale gegen den 1. FC Paderborn, wie die WAZ schreibt. Im Finale schlagen sie den 1. FC Köln mit 5:0. »Es spricht für die Überlegenheit der Truppe«, ist diesmal in der WAZ zu lesen, »dass Mittelstürmer Tönnies, der in ›Alltagsspielen‹ immer für ein Tor oder meist mehrere Tore gut ist, diesmal kein Tor schoss, sondern seinen Kameraden Feldmann und Thomas (je zwei) diese Aufgabe überließ.«
Alles, was er auf dem Fußballplatz anstellt, scheint ihm zu gelingen.
»Micha war immer einer von denen, die spielerisch gut mitgehalten haben, obwohl er einer der Jüngeren war«, sagt Uli Maslo über ihn. »Er hat das Spiel gelesen und konnte den Ball auch mal prallen lassen für den Mitspieler.«
Er ist ein Bewegungstalent: Mit 15 schafft er das Sportabzeichen als Siebtbester in Nordrhein-Westfalen. Mit 16 wird er im Gerätevierkampf Zweitbester seiner Schule. Bei Uli Maslo läuft er im Training 100 Meter in handgestoppten 12,3 Sekunden. Obwohl er noch in der B-Jugend spielt, zieht ihn Trainer Maslo schon bald in den Kader der A-Junioren hoch.
Die Schalker A-Junioren spielen 1976 um die Deutsche Meisterschaft. Im Vorjahr haben sie im Endspiel 0:4 gegen den VfB Stuttgart verloren, aber in diesem Jahr wollen sie erstmals den Meistertitel nach Gelsenkirchen holen. Im Endspiel wartet Rot-Weiss Essen. Die Essener um Kapitän Frank Mill haben im Halbfinale gegen den Vorjahressieger aus Stuttgart gewonnen, Verteidiger Burkhard Steiner ist dabei ein sehenswerter Treffer gelungen, als er eine Flanke von links mit dem Rücken zum Tor annimmt, den Ball zweimal mit links jongliert und ihn dann aus der Drehung in den Winkel schießt. Das Tor wird später zum Tor des Monats Juli 1976 gewählt. Aber Steiner kann auch anders. Wenn er am Ball ist, legt er ihn sich gern ein Stück zu weit vor, um dann mit gestreckten Beinen voran in den Gegenspieler grätschen zu können. Solange er den Ball trifft, ist das erlaubt. Jahre später sollen sich Steiner und Michael Tönnies noch mal über den Weg laufen.
Michael sitzt bei diesem Spiel nur auf der Bank, aber er ist froh, überhaupt dabei zu sein. Nervös genug ist er auch so schon, 23.000 Zuschauer sind an diesem Samstag ins Herner Stadion am Schloss Strünkede gekommen. Ihm kommt es vor, als seien es noch viel mehr. Er hat noch nie zuvor vor so vielen Menschen gespielt, solche Massen kennt er nur aus der Zeit, als er selbst noch mit seinem Vater in der Glückauf-Kampfbahn zugeschaut hat. Doch jetzt ist er nicht mehr nur Zuschauer, sondern mittendrin. Beim Warmmachen spürt er die Massen auf den Rängen. Die Essener gehen schon nach wenigen Minuten in Führung, doch Schalke gleicht kurz darauf aus und dreht das Spiel noch vor der Pause in ein 2:1.
»Man rechnet ja immer damit, dass man eingewechselt wird. Und Uli Maslo guckte irgendwann in der zweiten Halbzeit zu mir herüber, zumindest glaubte ich, dass er mich ansah. Da durchzuckte mich sofort ein Schauer und ich dachte, ›Puh, jetzt geht’s los‹. Da hat der Köttel schon ziemlich weit rausgeguckt.«
Am Ende gewinnen die Schalker Nachwuchsspieler mit 5:1 und holen erstmals den Titel nach Gelsenkirchen. Obwohl er nicht mehr zum Einsatz gekommen ist, fühlt sich Michael Tönnies dennoch als Deutscher Meister. Noch völlig aufgewühlt und siegestrunken kommt er nach der Meisterfeier daheim in Essen-Schonnebeck an, und weil er jetzt nicht nach Hause gehen will, zieht er weiter. In der Nähe gibt es eine Gartenfeier, auf der auch sein Freund Uli Scherwinski ist. Schon von Weitem hört dieser Michael singend die Straße entlangschlendern: »So gelöst hatte ich ihn noch nie erlebt«, erinnert sich Scherwinski.
Uli Scherwinski und Michael Tönnies haben sich im Käfig kennengelernt, dort, wo Michael schon als Kind die Dosen vom Tor geschossen hat. Und auch jetzt mit 16 Jahren spielt er noch dort. Scherwinski ist drei Jahre älter. Aber als sie die ersten Male gegeneinander gespielt haben, hat Michael ihm und den anderen Freizeitfußballern nach Belieben den Ball durch die Beine gespielt und sich gewundert, dass sie das gar nicht störte. Bei Schalke würden wir uns schwarzärgern, wenn uns einer tunnelt, denkt sich Michael.
Die beiden haben die gleichen Interessen: Wenn sie nicht auf dem Fußballplatz sind, treiben sie sich in den Kneipen der Umgebung herum und spielen Karten. Und wenn Uli nicht weiß, wo Michael steckt, schaut er zuallererst in einer der Spielotheken in Schonnebeck nach. Meistens findet er ihn dort.
Bei Schalke wissen sie noch nichts von all dem. Und Michael lässt sich nichts anmerken, seine Leistungen leiden auch nicht darunter, im Gegenteil. Als Präsident Günter Siebert einige Zeit später ein Spiel seiner B-Jugend besucht, traut er seinen Augen kaum. Beim 14:0 gegen Wacker Gladbeck trifft Michael Tönnies neunmal. Siebert ist sofort klar, dass er dieses Talent rechtzeitig an den Verein binden muss. »Komm mal morgen mit deinem Vater in mein Büro«, sagt er nach dem Spiel zu ihm, »dann machen wir den Vertrag fertig.«
»Der will nur spielen!«
Zu Verhandlungen kommt es gar nicht erst, denn sein Vater Werner stellt sofort eins klar: Geld gibt es zu Hause dank seiner Firma genug. »Der Junge will kein Geld, der will nur spielen!«, sagt er zu Siebert.
So etwas hört Siebert auch nicht oft, aber er fragt nicht nach, er will gar nicht wissen, ob er das richtig verstanden hat. Stattdessen ruft er seinem Mitarbeiter Willi Regenhardt im Nebenzimmer zu: »Willi mach’ mal den Standardvertrag fertig!«
Ab der Saison 1978/79 wird Michael Tönnies 3.200 Mark Grundgehalt brutto verdienen, plus Prämien, wenn er spielt.
»Es war immer mein Traum, Profi zu werden. Spieler wie Rüssmann, Fischer, Abramczik, Sobieray, Lütkebohmert, Fichtel, Bongartz und die Kremers-Zwillinge habe ich vorher nur im Fernsehen oder Stadion gesehen und auf einmal sollte ich mit dazugehören. Ich wäre auch bereit gewesen, für hundert Mark netto zu spielen, aber mittlerweile sehe ich das anders. Mein Vater hat es zwar gut gemeint, wenn er gesagt hat, dass ich kein Geld brauche. Er war stolz auf seine Firma und darauf, dass er seine Familie damit versorgen konnte. Auf Dauer hat das aber auch dazu beigetragen, dass ich mich schwergetan habe, richtig selbstständig zu werden, denn ich wusste ja, dass mir im Zweifel nichts passieren konnte.«
Mit Uli und ein paar weiteren Freunden hat er zudem eine Thekenmannschaft gegründet: Blau-Gelb Schonnebeck. Eine Zeitlang spielt Michael samstags in der Essener Thekenliga auf Asche und sonntags im Nachwuchs bei Schalke. In der Thekenliga ist er der unumstrittene Star, und bald spricht es sich herum, dass bei den Blau-Gelben ein Nachwuchsspieler vom FC Schalke 04 mitmischt.
»Einmal hat eine gegnerische Mannschaft alle Spieler gegen die eines Bezirksligateams ausgetauscht«, erinnert sich Scherwinski. »Als wir uns beschwert haben, haben die gesagt: ›Ihr habt doch auch einen von Schalke dabei.‹ So viel war der wert. Denn der hat ja immer gegoalt wie ein Verrückter.«
Doch als die Schalker von Michaels zweiter Karriere erfahren, bestellt ihn Präsident Siebert in sein Büro und droht ihm mit dem Rausschmiss, wenn er nicht sofort damit aufhört. Michaels Onkel kontrolliert von nun an ab und zu den Käfig, um zu sehen, ob sein Neffe auch keine Dummheiten macht. Doch ab dem Zeitpunkt spielt er nur noch für Schalke.
Im Sommer 1977 darf er zum ersten Mal bei den Profis mitspielen. Trainer Friedel Rausch hat ihn für ein Testspiel in Meppen nachnominiert. Erst mittags kommt er im Mannschaftshotel an, und bis die Spieler zum Stadion fahren, soll er so lange zu Torwart Volkmar Groß aufs Zimmer. Als Michael Tönnies das Zimmer betritt, sitzt Groß, fast zwei Meter groß, auf seinem Doppelbett, in der einen Hand hält er den Telefonhörer, in der anderen eine Zigarette.
Wo bist du denn hier gelandet, der raucht ja auf dem Zimmer, denkt sich Michael, und setzt sich in einen Sessel am anderen Ende des Raums. Zu der Zeit raucht Michael auch, schon mit 13 hat er angefangen. Silvia Gehrke hieß der Grund. Er wollte ihr auf dem Schulhof imponieren, doch sie hat ihn abblitzen lassen. Und obwohl es bei ihr nicht geklappt hat, hat er weiter geraucht. In der Westfalenauswahl hat er mit drei anderen Spielern mal heimlich auf dem Zimmer in der Sportschule geraucht. Prompt sind sie vom Trainer erwischt worden. Anschließend musste Michael wieder bei Siebert antanzen. Davon hat er vorerst genug.
Groß und er reden kaum. Drei Stunden sitzt Michael im Sessel, vor lauter Ehrfurcht traut er sich kaum, sich zu bewegen.
Auf der Ersatzbank fühlt er sich deutlich wohler als bei Groß auf dem Zimmer, in der zweiten Halbzeit wird er eingewechselt:
»Es ging sofort gut los, ich hatte eine super Aktion, habe den Ball bekommen, einen Gegner aussteigen lassen und den Ball direkt weitergespielt. ›Boah, ist der gut‹, hat Trainer Rausch gerufen. Normalerweise läuft’s dann, wenn man so ins Spiel startet, aber ich war durch das Lob irgendwie verunsichert und habe danach nichts mehr auf die Kette gekriegt.«
Nach der zehnten Klasse verlässt Michael die Hauptschule und beginnt eine Ausbildung zum Sportartikelverkäufer. Die Stelle hat ihm der Verein besorgt; die Nachwuchsspieler sollen ein zweites Standbein haben, um nach der Karriere weiter Geld verdienen zu können oder für den Fall, dass es mit der Karriere doch nichts wird. Drei Jahre lernt er bei Sport Sepp in der Gelsenkirchener Innenstadt. Für den schriftlichen Teil seiner Abschlussprüfung bekommt er die Note drei. Außerdem muss er vor der Prüfungskommission ein Verkaufsgespräch führen. Michael Tönnies erhält die Aufgabe, einen Campingkocher vorzustellen.
Einen Campingkocher hat er vorher noch nie gesehen, und er weiß auch nicht, was er darüber sagen soll.
»Das ist ein Campingkocher«, sagt er nur.
Er hat Glück: Die Prüfer geben ihm eine fünf, weil das Sportgeschäft in dem er gelernt hat, keine Campingabteilung hat. So besteht er die Prüfung gerade noch.
Flugangst, Kakerlaken und fünf Tore
Auf dem Fußballplatz läuft es besser. Mit der A-Jugend erreicht er noch einmal das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft, wo sie jedoch am VfB Stuttgart scheitern. Doch die Leistungen des jungen Mittelstürmers mit der Schuhgröße elf haben sich herumgesprochen. Im Winter 1977 erhält Michael Post aus Frankfurt. Seine Anschrift ist zwar falsch geschrieben – statt Ophoffsfeld 38 in Essen-Schonnebeck steht dort Ophofstraße 38 in Essen-Schonebeck –, aber wen interessiert das schon, wenn man vom Deutschen Fußball-Bund zur U18-Auswahl eingeladen wird. Er hat es schwarz auf weiß vor sich liegen, dass er jetzt zu den besten Fußballspielern Deutschlands in seinem Alter zählt. Noch in diesem Dezember soll er zu einer Länderspielreise nach Israel mitkommen.
»Ich wollte da nicht hin, ich habe zu Hause gesessen und gedacht: ›Scheiße, wat machse jetzt?‹ Ich bin ja vorher noch nie geflogen. Da hab’ ich mir fast in die Hosen geschissen. Normalerweise läuft man da ja freiwillig hin, wenn die Nationalmannschaft ruft, aber die weiten Reisen waren nicht mein Ding. Ich war nie jemand, der Fernweh hatte. Am liebsten war ich zu Hause, weil ich meine Ruhe haben wollte. Das war schon in Essen in der Kreisauswahl so: Wenn es nur für eine Woche zum Lehrgang in die Sportschule Kaiserau bei Dortmund ging und wir mit vier Mann auf ein Zimmer mussten – da bin ich kaputtgegangen. Und jetzt ging es sogar nach Israel!«
Zunächst geht es Ende Dezember 1977, wenige Tage nachdem Michael 18 geworden ist, mit dem Auto nach Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main, wo die Spieler im Hotel zusammentreffen und von Trainer Herbert Widmayer empfangen werden. Widmayer kümmert sich seit Anfang der siebziger Jahre um die Nachwuchsmannschaften des DFB. Er ist einer dieser Trainer, die man harte Hunde nennt. Im Zweiten Weltkrieg war Widmayer Kampfflieger und überlebte zwei Abschüsse. 1961 wurde er mit dem 1. FC Nürnberg Deutscher Meister und im Jahr darauf Pokalsieger. Wiederum ein Jahr später wurde er als erster Trainer der neugegründeten Bundesliga entlassen. Widmayer nahm das alles mit Galgenhumor: »Ich bin dreimal in meinem Leben abgeschossen worden – zweimal im Krieg und einmal in Nürnberg.«
Von Neu-Isenburg aus fahren sie am nächsten Morgen weiter zum Frankfurter Flughafen, wo Michael zum ersten Mal in ein Flugzeug steigt.
»Von dort sind wir erst mal nach Zürich geflogen. Ich hatte vorher eine Riesenangst, aber der erste Flug dauerte nur 55 Minuten und war einfach nur geil. Das Starten und Landen hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich ganz euphorisch war, als wir in Zürich angekommen sind. Aber der zweite Flug war die Hölle, vier Stunden am Stück, da ging es direkt zur Sache mit Turbulenzen. In Israel haben wir im Kibbuz Shefaim gewohnt. Das war auch nicht so sauber. Nachts sind da die Kakerlaken über den Flur gelaufen, und zu essen gab es nur Hammelfleisch.«
In Israel stehen vier Spiele gegen die Nationalmannschaften von Dänemark, Norwegen, Israel und Griechenland an. Im deutschen Team stehen Spieler wie Thomas Allofs von Fortuna Düsseldorf, Thomas Kroth von Kickers Offenbach sowie ein schüchterner blonder Mittelfeldspieler aus Augsburg, der kaum ein Wort sagt, wenn die Mannschaft beim Essen beisammensitzt: Bernd Schuster. Allesamt verheißungsvolle Talente, die in den achtziger Jahren auch als Profis Erfolge feiern werden: Kroth wird mit drei verschiedenen Mannschaften den DFB-Pokal gewinnen, Allofs wird ihn schon ein halbes Jahr später in den Händen halten und anschließend sogar mit Düsseldorf im Europacupfinale stehen. Und Schuster wird mit der Nationalmannschaft 1980 Europameister werden. Doch nach dem ersten Spiel klopfen alle nur Michael Tönnies auf die Schulter. Gegen Dänemark hat er in der ersten Halbzeit drei Tore innerhalb von zehn Minuten geschossen. Trainer Widmayer, der seine Fußballwelt sonst in zwei Sorten von Menschen aufteilt – in Experten und Osterhasen – hat noch eine weitere entdeckt:
»Der Tönnies, das ist ein Genie!«, ruft Widmayer begeistert in der Kabine. »Mit der Pike macht der die Bälle noch rein!«
In der zweiten Hälfte trifft Michael noch zweimal. Deutschland gewinnt 8:0.
»Im ersten Spiel lief es noch gut, da habe ich nicht nachgedacht, weil wir erst seit zwei Tagen da waren. Nachher wurden die Leistungen ja schlechter, weil ich kaum etwas gegessen habe. Im zweiten Spiel bin ich ausgewechselt worden und im dritten sollte ich auf einmal Manndecker spielen. Dabei habe ich mich dann auch noch verletzt, weil ich versucht habe zu grätschen. Ein halbes Jahr später sollte ich noch zum UEFA-Turnier nach Polen mitfahren, aber in einem der letzten Spiele für die Schalker A-Jugend habe ich eine Rote Karte bekommen und wurde daraufhin noch aus der Mannschaft gestrichen. Später bin ich noch einmal von Berti Vogts zu einem U21-Lehrgang eingeladen worden – das war’s dann aber auch. Es hat mich zwar stolz gemacht, dass ich mal dabei gewesen bin, aber ich war auch ganz froh, dass ich da nicht mehr hinmusste. Vielleicht auch deshalb, weil ich immer ein bisschen pessimistisch war und mir das nicht so recht zugetraut habe. Für internationale Klasse hat es bei mir aber einfach nicht gereicht.«
Zocken wie die Profis
Im Sommer 1978 steigt Michael zu den Profis auf und trainiert nun zusammen mit Spielern wie Rolf Rüssmann, Klaus Fischer und Klaus Fichtel. Denen hat er schon als Kind mit seinem Vater in der Glückauf-Kampfbahn zugejubelt. Auch hier macht er sogleich im Training auf sich aufmerksam: Am Spielfeldrand stehen Nationalspieler Rolf Rüssmann und Präsident Siebert, als Michael Tönnies mit seinem rechten Fuß ausholt. Mit einem lauten Klatschen knallt der Ball gegen die hölzerne Torlatte und prallt in weitem Bogen zurück. »Wa, Rolli«, sagt Siebert zu Rüssmann, »so einen Bums möchtest du auch mal haben.«
Rüssmann kümmert sich besonders um die jungen Spieler wie Michael Tönnies. »Mensch, Junge«, sagt Rüssmann zu ihm, »du hast es doch drauf, du musst es nur zeigen.« Und Michael Tönnies nimmt sich das zu Herzen. Daher bleibt er am Abend vor dem nächsten Testspiel nur bis ein Uhr in der Disko. Seine Freundin Martina hatte sich schon gefreut, dass er endlich mal wieder mit ihr feiern geht. Und nun, da sich die Disko füllt, müssen sie schon wieder los. Missmutig geht sie hinter ihm her. Auf der Treppe zum Ausgang laufen sie einem großen Mann mit hellblondem Haar in die Arme – Rolf Rüssmann: »Oh, Micha, willste schon weg?«, fragt er überrascht.
»Ja, wir haben doch morgen ein wichtiges Spiel«, antwortet Michael Tönnies leicht beschämt.
Rüssmann hebt im Vorbeigehen den Daumen. »Das ist die richtige Einstellung«, sagt er und verschwindet im Menschengewirr. Michael Tönnies schaut ihm noch einen Moment nach, während seine Freundin vor sich hin meckert: »Wir gehen, wenn die anderen kommen.«
Am nächsten Tag steht Michael Tönnies auf einem Fußballplatz in Gladbeck und weiß nicht, was mit ihm los ist. Kein Pass will ihm gelingen. Er steht völlig neben sich, obwohl er doch gestern so früh zu Hause war. Nach dem Spiel kommt Rüssmann zu ihm.
»Na, du bist wohl doch nicht sofort nach Hause gegangen?« Es klingt für Michael, als fühle sich Rüssmann verarscht.
Zur neuen Saison ist Ivica Horvat zum FC Schalke 04 zurückgekehrt – schon einmal hat der Jugoslawe den Klub trainiert und ist mit ihm 1972 Pokalsieger geworden.
Horvat nennt ihn Tänis, weil er den Namen Tönnies nicht aussprechen kann. Bei Horvat wissen die Ersatzspieler schon vor dem Spiel, wer von ihnen eingewechselt wird, denn zum Abschluss der Mannschaftsbesprechung fragt Horvat stets einen Spieler: »Bist du fit?« Dann wissen sie, dass dieser Spieler auch als erster eingewechselt wird – egal, wie es steht. Wenn es nötig ist, baut der Trainer die Aufstellung um.
Michael Tönnies steht oft im Kader, doch zum Einsatz kommt er nicht, denn es gibt da ein Problem. Er konkurriert mit Klaus Fischer um den Posten als Mittelstürmer. Fischer ist zu der Zeit einer der besten Stürmer Deutschlands, Nationalspieler und Schalkes Rekordtorschütze mit knapp 150 Toren in der Bundesliga. An ihm kommt er nicht vorbei.
»Der Micha kann ein ganz Großer werden«, sagt Fischer zu dessen Vater. »Er hat nur ein Problem: Er raucht zu viel.«
Michael Tönnies genießt die Vorzüge, die er als Profi hat. Auch wenn er nicht spielt, freut er sich auf die Auswärtsfahrten mit Schalke. Das ist ein anderes Reisen als in den Auswahlmannschaften, denn als Profi wohnt er in richtigen Hotels und muss sich das Zimmer nur mit seinem Mannschaftskollegen Thomas Kruse teilen. Außerdem ist er danach schnell wieder zu Hause.
»Kruse, bist du fit?«
Auf den Auswärtsfahrten zocken die Stammspieler um Fischer und Rüssmann im Bus Karten. Im Bundesligaskandal Anfang der siebziger Jahre haben sie noch ein Spiel für 2.300 Mark pro Mann verschoben, jetzt gehen solche Einsätze beim Kartenspielen drauf. Die Cleveren kassieren, die Opfer müssen blechen. Auch Trainer Ivica Horvat zockt mit und wird öfters von seinen Spielern abgezogen.
Michael Tönnies gewöhnt sich an sein Reservistendasein; nach den Spielen geht er feiern – steil gehen nennt er das. Dann ist es auch ganz egal, ob sie gewonnen haben oder nicht, ob er gespielt hat oder nicht. Oft kommt er erst frühmorgens nach Hause, und manchmal schafft er nicht mal das.
»Micha, fang mal an, Kaffee zu trinken, du musst gleich zum Training«, sagt Uli, der meistens mit dabei ist, wenn Michael steil geht.
Aber der bestellt noch zwei Bier und schmeißt wieder einen Fünfer in den Spielautomaten. Bis es irgendwann zu spät ist, um nach Hause zu gehen. Er muss von hier aus zum Training fahren.
»Komm mit«, sagt er zu Uli, »allein trau’ ich mich nicht dahin.«
Beim Warmlaufen hält er sich einige Meter hinter den anderen Spielern, damit keiner seine Alkoholfahne riecht.
In der Woche vor dem Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart im September 1978 hat er das Gefühl, dass es diesmal so weit sein könnte. Horvat lässt im Training oft Sturm gegen Abwehr spielen. Die Stammspieler erkennt man an den gelben Leibchen. Und nun hat Michael Tönnies auch eines bekommen. Im Trainingsspiel ist er jedoch zu nervös. Ihm unterlaufen einige taktische Fehler, sodass Horvat es sich noch einmal anders überlegt.
»Tänis, bis du fit?«, fragt Horvat am Ende der Mannschaftbesprechung vor dem Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart.
Michael antwortet erschrocken. »Ja.«
68 Minuten sind im Parkstadion gespielt – die Stuttgarter haben kurz zuvor zum 2:2 ausgeglichen –, als Trainer Horvat Michael Tönnies einwechselt.
»Ich war sehr, sehr nervös. Das war ein anderes Bankdrücken als sonst. Aber als ich auf dem Feld stand, war die ganze Anspannung auf einmal weg. Ich war sofort im Spiel, hatte gleich einige gute Aktionen und habe das Siegtor mit vorbereitet.«
Eine Woche später kommt er auch im Ligaspiel gegen die Stuttgarter zum Einsatz. In seiner ersten Saison bei den Profis spielt er insgesamt fünfmal für Schalke. Außerdem läuft er noch für die Amateurmannschaft auf, die er zum Aufstieg in die Verbandsliga schießt.
Lernen und leiden unter Lorant
Nach vier Niederlagen in Folge wird Ivica Horvat bereits im März 1979 entlassen, auf ihn folgt Gyula Lorant. Als Spieler war Lorant Teil der ungarischen Nationalmannschaft, die 1954 im WM-Finale gegen Deutschland 2:3 verlor. Anschließend vermittelte ihm Bundestrainer Sepp Herberger einen Platz an der Sporthochschule in Köln. Als Trainer führte Lorant als erster die Raumdeckung in der Bundesliga ein. Seine Trainerprüfung an der Sporthochschule Köln musste er allerdings wiederholen, weil er im Fach Psychologie durchgefallen war. Auch Michael Tönnies lernt bald die zwei Seiten des neuen Trainers kennen:
»Beim Training saß Lorant meistens auf der Tribüne und qualmte Zigarre, während sein Co-Trainer Dietmar Schwager das Training unten auf dem Platz leitete. Irgendwann, wenn er zu Ende geraucht hatte, kam er herunter und machte selbst ein paar Übungen vor. Das waren dann aber auch Übungen, wo man sagen musste, mein lieber Schwager! Da hat er gezeigt, was er drauf hat. Im taktischen Bereich habe ich von ihm am meisten gelernt. Aber wenn er einen nicht leiden konnte, hat er versucht, denjenigen aus dem Kader zu kriegen. So wie Jürgen Sobieray. Lorant hat ihn vor dem Training auf den Platz geschickt und ihn Eckbälle schießen lassen – ohne sich warm zu machen, nur mit dem Außenrist. Nach der dritten Ecke hatte der ›Sobbi‹ einen Muskelfaserriss und fiel für sechs Wochen aus.«
»Dalli!«, schreit Lorant, wenn er seine Spieler antreiben will. Wenn er mit der Leistung unzufrieden ist, sagt er: »War nicht schlecht – war ganz schlecht.« Um die Ausdauer zu trainieren, lässt er die Spieler einmal mit Eisenstollen um den Platz laufen – denn diese tragen sie auch am Wochenende. Nur dass sie dann auf dem Rasen des Parkstadions und nicht wie auf der harten Aschenbahn der Glückauf-Kampfbahn laufen müssen. Doch Lorant ist das egal.
»Dalli!«
Nach mehreren Runden bricht Michael Tönnies ab, weil er die Schmerzen nicht mehr aushält; seine Füße sind wundgelaufen.
»Trainer, ich kann nicht mehr«, sagt er zu Lorant und zeigt ihm die blutigen Blasen an seinen Füßen.
»Dann läufst du die letzten Runden barfuß«, befiehlt ihm Lorant.
Lorant hat ihn sogar mal geschlagen: Michael Tönnies ist im Zweikampf von Abwehrspieler Bernd Thiele gefoult worden und krümmt sich am Boden. Als er gerade wieder hochkommen will, spürt er plötzlich einen Schlag im Nacken und hört Lorant von hinten zischen: »Steh auf, dalli!«
Doch schon bald kann er sich ein bisschen von Lorants Training erholen, denn er wird zur Bundeswehr einberufen – und als Profifußballer kommt man in die Sportfördergruppe. Zuerst geht es für sechs Wochen zur Grundausbildung nach Budel in den Niederlanden.
»Danach mussten wir nur jeden Montag nach Duisburg zum Wedaustadion. Außer mir waren unter anderem noch Thomas Allofs von Fortuna Düsseldorf, der Handballtorwart Stefan Hecker und Eiskunstläufer Rudi Cerne dabei. Alle standen in Grüppchen herum – die Fußballer, die Handballer – jede Sportart für sich. Nur Rudi stand alleine da, weil er der einzige Eiskunstläufer war. Wir Fußballer haben dann unter Auswahltrainer Toni Pointinger trainiert und ab und zu am Dienstag ein Spiel gehabt. Ansonsten habe ich den Rest der Woche mit den Profis trainiert. Offiziell war ich zwar in der Ruhrlandkaserne in Essen-Kupferdreh stationiert, aber ich musste nie dort schlafen, ich hatte dort nur einen Schrank auf der Stube.
Einmal hat es mich jedoch erwischt. Ich wurde zum Bereitschaftsdienst eingeteilt und sollte übers Wochenende bleiben, um den Hof zu fegen. Auf der Stube habe ich einen gefragt, ob er meine Bereitschaft übernehmen könnte. ›Ich geb’ dir ’n Fünfziger dafür‹, hab ich ihm gesagt. Er war einverstanden. Zum Glück ist das nicht aufgeflogen. So waren die 50 Mark gut investiert und ich war nach zwei Stunden schon wieder zu Hause. Ich bin sogar befördert worden, zum Obergefreiten, glaube ich, auf jeden Fall hatte ich danach zwei Balken auf der Schulter. Aber das war auch nur eine Frage der Zeit, bis man befördert wurde, dagegen konnte man gar nichts machen.
Irgendwann haben die von der Kaserne bei mir angerufen: ›Hör mal, du musst deine Kohle abholen, die liegt hier rum.‹ Ich habe 300 Mark im Monat bekommen, im Ausland sogar das Doppelte. So etwas hatten die auch noch nicht erlebt, denn die anderen Rekruten waren darauf angewiesen, die hatten kaum was, aber ich bekam noch die vollen Bezüge bei Schalke.«
Neun Spiele in drei Jahren
Auch Lorant hält sich nicht lange beim FC Schalke, nach weniger als zehn Monaten wird er entlassen. Unter ihm hat Michael Tönnies nur zweimal gespielt, doch auch der neue Trainer, Fahrudin Jusufi, setzt ihn kaum ein. In den nächsten beiden Jahren kommt er nur noch viermal zum Einsatz. Wenige Tage vor seinem 21. Geburtstag im Dezember 1980 steht er beim 0:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern von Beginn an auf dem Platz. Zur Halbzeit nimmt ihn Jusufi raus. Von nun an wird er Michael Tönnies nicht mehr einsetzen. Selbst nachdem sich Mittelstürmer Klaus Fischer das Schienbein gebrochen hat und zehn Monate ausgefallen ist, kommt Michael Tönnies, der einstige Überflieger, nicht mehr zum Zug.
»Vielleicht habe ich zu viel Ehrfurcht vor den Jungs gehabt. Ich war auch schon ein ganz Guter, aber Klaus Fischer war einfach besser, das muss man anerkennen. Ich habe damals immer mit Nationalspielern trainiert, ich kenne den Unterschied zwischen Guten und Schlechten, man darf sich ja nicht überschätzen. Ich habe gesehen, bis hierhin geht’s und nicht weiter, ich bin ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, aber international reicht es nicht, denn dazu fehlte mir diese hundertprozentige Einstellung, auch vom Kopf her, aber die muss man haben – und zwar immer. Es geht um die gesamte Körperpflege und Vorbereitung über die ganze Woche und nicht nur ein, zwei Tage vorm Spiel. Wenn ich daran denke, wie Klaus Fischer, Rolf Rüssmann oder Klaus Fichtel gelebt haben, wundert mich das nicht, dass sie auf so hohem Niveau gespielt haben. Die sind nach dem Training noch eine Stunde länger geblieben und haben Extraschichten geschoben, obwohl sie schon Nationalspieler waren. Von mir hat man so etwas nie gesehen.«
Eine Zeitlang versucht er es im offensiven Mittelfeld, hinter den Spitzen, auf der Position, auf der er schon als Kind am liebsten spielen wollte. Denn dort spielte schon sein Vorbild – Günter Netzer. Doch Michael kommt nicht aus der Tiefe des Raumes, er lauert am Strafraum auf den Ball. Im Schalker Mittelfeld ist auch kein Platz für ihn. Dass die Position hinter den Spitzen nichts für ihn ist, hat schon Berti Vogts erkannt, damals im U21-Lehrgang: »Andere laufen das Doppelte und Dreifache von dem, was du läufst«, hat ihm der damalige Nachwuchstrainer gesagt, »du gehörst vorne rein.«
Von der Bank muss Michael Tönnies mit ansehen, wie die Mannschaft immer tiefer in den Tabellenkeller rutscht. Drei Jahre ist es her, dass die Schalker noch Vizemeister geworden sind. Nun kämpfen sie gegen den Abstieg.
Einige Zeit zuvor hatte er ein Angebot von Eintracht Frankfurt. Doch sein Vater Werner hatte ihm geraten, beim FC Schalke zu bleiben. Er hatte gehofft, dass sich sein Sohn irgendwann bei ihrem Lieblingsklub durchsetzen würde.
Im Sommer 1981 wird sein Vertrag bei Schalke auslaufen, und der neue Manager, Rudi Assauer, hat mit ihm schon einen Gesprächstermin vereinbart. Klaus Fischer hatte bereits während der Saison seinen Abschied bekannt gegeben und wird zum 1. FC Köln wechseln.
Dann wäre endlich Platz für ihn, und wenn die Mannschaft absteigt, brauchen sie ihn, für einen Neuanfang, denkt er.
Mit der Erwartung zu bleiben und sich doch noch auf Schalke durchzusetzen, geht Michael Tönnies voller Zuversicht zu Assauer.