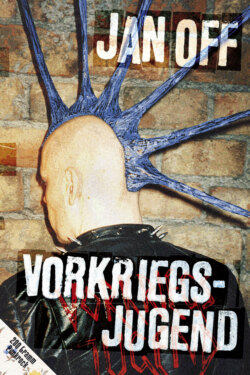Читать книгу Vorkriegsjugend - Jan Off - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zum Geleit
Оглавление»Die 80er wollten kalt sein, die 90er waren es.«
Philipp Schiemann
Sommer 2001. Ich sitze in der Straßenbahn Richtung Hauptbahnhof und sinniere über den eklatanten Unterschied im Groupieaufkommen zwischen Musikern und Schriftschaffenden, als ein Punk und ein Oi-Skin zusteigen. Dem Punk, der – nicht zuletzt dank zahlloser Schwären, Scharten und Eiterbeulen – ausgesucht ranzig daherkommt, fehlt ein großer Teil des linken Hosenbeins, dafür ist der entsprechende Unterschenkel mit einer ehemals weißen Binde umwickelt.
»Hier Alter, riech mal!« fordert der offenkundig Versehrte seinen Begleiter auf, kaum daß die beiden mir gegenüber Platz genommen haben, und hat auch schon damit begonnen, sich die schmutzstarrende Stoffbahn vom bleichen Beinfleisch zu schälen.
»Hoaa, fies!« kommt es aufrichtig begeistert zurück.
Ein Befund, für den sich der Glatzkopf noch nicht mal nach vorn beugen muß. Der pestilenzartige Gestank hat sich längst im gesamten Wagen verbreitet.
Nachdem die Wunde, in der sich wahrscheinlich schon die ersten Maden tummeln, den Blicken der Öffentlichkeit wieder entzogen ist, wendet sich das Gespräch den zahllosen Tätowierungen zu, die die sichtbaren Körperteile des Punks bedecken. Besonders eine Reihe von Zahlen und/oder Buchstaben, die auf keinen Fall von einem Profi stammen können, hat das Interesse des Oi-Skins geweckt.
»Hähä«, freut sich der stolze Besitzer des Schandmals. »Das is’ die Nummer, die mir die Bullen bei meiner letzten Verhaftung gegeben haben. Hab’ ich mir vor drei Tagen von Kopfschuß stechen lassen.«
Im Hauptbahnhof sehe ich die beiden Anwärter auf einen vorderen Platz bei den Weltfestspielen der Filzlauszüchter noch einmal. Ein lautstarkes »Hier – marschiert – der asoziale Widerstand!« auf den Lippen, humpeln sie an verstörten DB-Kunden vorbei durch die Vorhalle.
Ein Anblick, der mir den Tag aus gleich zweierlei Gründen verleidet. Zum einen habe ich mir schon vor Jahren, kaum daß ich beschlossen hatte, daß meine Ohren in diesem Leben auch noch etwas anderes zu hören bekommen sollten als ausschließlich Punkrock, nichts sehnlicher gewünscht, als daß die »Punkbewegung« diesen meinen Entschluß zur Kenntnis nehmen und alsbald in die Grube fahren möge. Wenn ich heute Punkrocker sehe oder erfahren muß, daß Bands, deren Platten ich bereits Anfang der Achtziger erworben habe, immer noch (oder wieder) auf Tour gehen, fühle ich mich allzusehr an diese bizarren, mit Creepers und Schmalztolle ausstaffierten Gecken erinnert, die sich einstmals Teds nannten. Die nämlich fuhren ebenfalls auf die Musik ihrer Väter ab, was mir bereits mit dreizehn so unanständig vorkam wie eine Mitgliedschaft im CVJM.
Zum anderen hat mir die trostlose Parade durch den Bahnhof einmal mehr vor Augen geführt, daß viele der real existierenden Punkrocker (Obacht! Ich rede hier von Punks, die auch so aussehen, nicht von diesen Kurze-Hose-Holzgewehr-Pennälern, die jedem Fähnleinführer Schreie des Entzückens zu entlocken vermögen), daß also viele derjenigen, die auch heute noch vor Supermärkten und U-Bahn-Eingängen ihr Sprüchlein aufsagen, ein paar der mittlerweile über zwanzig Jahre alten Parolen deutlich zu ernst genommen haben. Die Aufschrift »No Future« auf der Jacke zu tragen bedeutete 1983 nicht zwangsläufig, drogensüchtig zu werden und auf der Straße zu leben.
Heute scheint das anders zu sein, was sicher auch der gesamtgesellschaftlichen Situation geschuldet ist. Wer sich in einem Dorf in der sächsischen Schweiz oder einem Vorort von Kiel entschließt, seine Haare fürderhin in der Tradition der Ureinwohner ostamerikanischer Waldgebiete zu tragen, bedarf ohne Zweifel einer regelmäßigen, drogensubstituierten Auszeit.
In der goldenen Epoche, die dieses Buch beschreibt, war das (zumindest im nichtsozialistischen Wirtschaftsraum) nicht wirklich vonnöten. Punk zu sein erforderte in einer Zeit, in der Millionen gegen Atomkraft und NATO-Doppelbeschluß auf die Straße gingen, nicht mehr Mut als ein Tritt gegen das Schienbein deines Nachhilfelehrers. Obdachlosigkeit war kein Thema, dafür gab es einfach zu viele Hippies, die an dir ihre Toleranz erproben wollten. Eine Haftstrafe bekamst du nur, wenn du wirklich kriminell geworden warst. Und um dein Leben fürchten mußtest du schon gar nicht, denn bekennende Nazis existierten kaum. (Zumindest hielten sie sich bedeckt.)
Ich erinnere mich an zahllose Gelegenheiten, bei denen es hieß, es müsse dieses Jugendzentrum oder jenes besetzte Haus gegen eine Horde anrückender Faschisten verteidigt werden. Stundenlang saß man dann, den Baseballschläger martialisch auf den Knien, in irgendeiner »Volxküche« beisammen, während die anfängliche Erregung nach und nach gepflegter Langeweile wich. Meist schlug am Ende jemand vor, den Feind per Auto aufzuspüren. In achtundneunzig von hundert Fällen ergebnislos.
Bei den wenigen von Faschisten angekündigten Aufmärschen und Parteiversammlungen war es nicht anders. Falls die braunen Buben überhaupt anrückten, dann meist in so geringer Zahl, daß ihnen die gegnerischen Kräfte nicht selten um ein Zwanzigfaches überlegen waren.*
Wenn du dich als Punkrocker wirklich an Widerständen aufreiben wolltest, dann mußtest du in den achtziger Jahren schon in der DDR gemeldet sein. Hier hattest du nicht nur in der ständigen Angst zu leben, daß sie dir bei der Volkspolizei die Klamotten wegnahmen oder die Haare schnitten (für Punks die absolute Höchststrafe). Nein, du hattest auch in kürzester Zeit die Staatssicherheit an der Backe, konntest für vermeintliche Nichtigkeiten jederzeit in den Knast oder den Jugendwerkhof einfahren oder mit den abstrusesten Verboten belegt werden (Jugendclubverbot, Kneipenverbot, Berlinverbot usw.). An Punkscheiben war genauso schwer heranzukommen wie an Verstärker und andere (für die Gründung einer Band benötigte) Gerätschaften, von industriell gefertigten Lumpen gar nicht zur reden. Und so erlaube ich mir, die »vom Klassenfeind beeinflußten, dekadenten Elemente« der »Arbeiter- und Bauernmacht« als die wahren Helden des Punkrock zu preisen – auch und gerade, weil der Westen ihre Existenz in der ihm eigenen Ignoranz erst viel zu spät zur Kenntnis genommen hat.
Und ja, ich gebe es zu, trotz meiner oben geschilderten Bedenken genießen auch die kleinen Punker von heute meine Sympathie – zumindest wenn sie in einer Gegend zu Hause sind, in der ein »deutschnationaler« Lebensstil längst zum Mainstream geworden ist. Auf daß sie das Pflaster unserer Innenstädte noch möglichst lange mit dem Auswurf ihrer malträtierten Lungen benetzen mögen! Der Volkskörper braucht nichts dringender als eine chronische Schuppenflechte. Oder um es mit meinem alten Spezi Horst Hrubesch zu sagen: »Kein Vergeben – kein Vergessen. Randale, Saufen, Ostmuschis!«