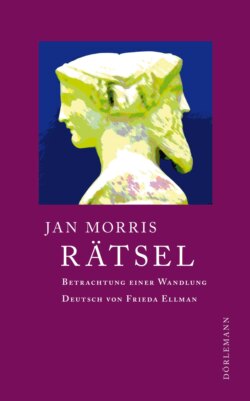Читать книгу Rätsel - Jan Morris - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2
Ein falsches Leben – das Singvogelnest – Oxford – ein kleiner Knoten – in der Kathedrale – ein Lachen
Mit zunehmendem Alter spürte ich immer deutlicher den Konflikt, in dem ich lebte, mein ganzes Leben kam mir nun als ein falsches vor, eine Lüge. Es war eine Maskerade, ich kleidete meine weibliche Identität, von der ich nicht gewusst hätte, wie ich sie in Worte fassen soll, in die Hülle eines männlichen Auftretens. Psychiater haben oft gefragt, ob mir das Schuldgefühle bereitet habe, aber genau das Gegenteil war der Fall. Indem ich mir so sehnlich, so unablässig wünschte, in den Körper eines Mädchens zu schlüpfen, strebte ich ja nur nach einem höheren Zustand, einer inneren Harmonie; und diesen Eindruck schreibe ich nicht den Einflüssen meines Zuhauses, meiner Familie zu, sondern der Tatsache, dass ich schon früh nach Oxford kam.
Oxford war mein Schicksal. Dort bin ich als junger Student gewesen, über viele Jahre meines Lebens habe ich ein Haus dort besessen – und auch mit meinem zweiten Kriterium Besitz von der Stadt ergriffen, denn ich schrieb ein Buch über sie. Aber wichtiger noch: Dort war meine erste Internatsschule; die Symbole, Werte und Traditionen Oxfords prägten meine frühen Jungenjahre und waren meine erste Begegnung mit einer Welt fort vom Elternhaus, weiter fort, als ich mit meinem Fernrohr blicken konnte. Ich sehe die Stadt, will ich hoffen, ohne Sentimentalität – ich kenne ihre Fehler nur zu gut. Aber sie bleibt für mich in ihrer zerlumpten, zerschundenen Integrität ein Bild dessen, was ich auf der Welt am meisten bewundere: eine Präsenz so alt und so wahrhaftig, dass sie den Lauf der Zeiten und alle Veränderungen in sich aufnimmt wie ein Prisma das Licht und nur immer vielfältiger und reicher dadurch wird, eine Stadt, der nichts fremd ist außer der Intoleranz.
Natürlich meine ich, wenn ich von Oxford spreche, nicht einfach nur die Stadt oder die Universität, nicht einmal die Atmosphäre dort, sondern eine ganze Denk- und Lebensweise, eine eigene Kultur, ja eine eigene Welt. Ich kam als eine Abnormität dorthin, als innerer Widerspruch, und wären da nicht die Beweglichkeit, die Leichtigkeit, die Selbstironie gewesen, die ich aus dem Leben in Oxford in mich aufnahm – die Kultur und Kultiviertheit des traditionellen Englands –, ich glaube, dann wäre ich schon vor Langem bei jener letzten Zuflucht alles Abnormen gelandet, im Irrenhaus. Denn ganz nahe am Herzen des Oxforder Ethos liegt die wunderbare, tröstliche Wahrheit, dass es keine Norm gibt. Jeder von uns ist anders; keiner von uns hat jemals ganz unrecht; verstehen heißt verzeihen.
Mit neun Jahren, 1936, wurde ich in die Universität Oxford aufgenommen, man wird meinen Namen im Jahresverzeichnis finden. Nicht etwa weil ich ein Wunderkind gewesen wäre, sondern weil ich meine erste Ausbildung dort an der Chorschule von Christ Church bekam, einem College von solchen Dimensionen, dass seine Kapelle zugleich auch die Kathedrale der Diözese von Oxford ist und ihren eigenen professionellen Chor unterhält. Keine andere Erziehung hätte mich stärker prägen können, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine andere Schule gegeben hätte, egal wo, die auf so eigentümliche Weise genau richtig für all meine inneren Bedürfnisse gewesen wäre. Ein Begriff von Jungfräulichkeit entstand in jenen Jahren in Christ Church in mir, ein Sinn für das Heilige und Zarte, und schließlich, ganz allmählich ging mir auf, dass dies das Weibliche sein musste – »das Ewig-Weibliche«, wie Goethe im letzten Vers seines Faust sagt, »zieht uns hinan«.
Damals hatte die Chorschule der Kathedrale ihr alles andere als spektakuläres Quartier in einer von hohen Mauern gesäumten Gasse im Herzen der Stadt, und die Belegschaft beschränkte sich praktisch ganz auf die Choristen – insgesamt sechzehn Jungen. Wir waren eine mittelalterliche Einrichtung, und wir lebten wie im Mittelalter – ein Singvogelnest auf einem Oxforder Dachboden. Wir konnten eine Cricketmannschaft aufstellen, waren aber zu wenige, um gegeneinander zu spielen. Wir traten in Theaterstücken auf, aber nur in kleinen. Die Konzerte, die wir in der Schule gaben, waren glücklicherweise kurz. Wir hatten, konnte man sagen, nur einen einzigen Daseinszweck: Wir sangen geistliche Musik in der Kathedrale von Sankt Frideswide (ein Oxforder Heiliger, der, wie ich seither leider feststellen musste, anderswo als dubios gilt, wenn nicht gar als reine Erfindung), und hinter diesem Ziel hatte alles andere zurückzustehen. Was wir an Schulbildung bekamen, war solide, aber immer etwas sprunghaft, denn zweimal am Tag setzten wir unsere Baretts auf, legten die steifen Kragen um und schlüpften in die flatternden Talare, und dann überquerten wir im Gänsemarsch St. Aldate’s zur Kathedrale – genossen es, wenn die Touristen uns anstarrten, und manchmal kam uns, was recht komisch aussah, mit polternden Schritten in entgegengesetzter Richtung und ebenfalls im Gänsemarsch ein Trupp Polizisten mit Helm und schweren Stiefeln entgegen, auf dem Weg zur Hauptwache am unteren Ende der Straße.
Heutige Pädagogen wären vermutlich entsetzt, wenn sie die Verhältnisse an unserer Schule sähen; wir müssen zu den kleinsten Internatsschulen in ganz England gehört haben, und dadurch waren natürlich auch die Bildungsmöglichkeiten begrenzt. Trotzdem sehe ich, wenn ich an meine Zeit dort zurückdenke, nichts als Güte und Schönheit. Oft hat man mir zu verstehen gegeben, dass die Konventionen jener nachviktorianischen Epoche der 1930er Jahre meine Wahrnehmung für alles Geschlechtliche verzerrt hätten. Damals stand ein Mann für alles, was hart war, er verdiente das Geld, er führte Kriege, hielt die Ohren steif, prügelte aufsässige Schuljungen, trug Stiefel und Helme, trank Bier; die Frau war für die sanfteren, weicheren Dinge da, sie heilte, tröstete, malte Bilder, trug Seide, sang, hatte Sinn für Farben, machte Geschenke, nahm Bewunderung entgegen. Aber solche Unterscheidungen akzeptierte in unserer Familie keiner, niemand wäre im Traum auf den Gedanken gekommen, dass Sinn für Musik, Farben, Textilien etwas typisch Weibliches sei; Tatsache ist allerdings, dass ich das weibliche Prinzip als etwas Sanftes im Unterschied zum Gewaltsamen sah, Vergebung anstelle von Bestrafung, ein Geben eher als ein Nehmen, eher Hilfe als Anführerschaft. Mir schien, in Oxford war diese Unterscheidung in einem Maße zu spüren, das es in, sagen wir, Cardiff oder sogar in London niemals gegeben hätte, und ich hatte schon das Gefühl, dass ich, indem ich mich so bereitwillig dem Zauber der Stadt ergab, mich auf einen spezifisch weiblichen Einfluss einließ. Das denke ich bis heute, und vom damaligen bis zum heutigen Tag habe ich Oxford immer als eine »Sie« gesehen – bin sogar, was ein Kritiker mir einmal vorgehalten hat, altmodisch dem Brauch der schlimmsten viktorianischen Belletristen gefolgt und habe stets das weibliche Pronomen dafür verwendet.
Viel von ihrer Schönheit war rein äußerlich, und so war auch mein Vergnügen daran äußerlicher Natur. Jeden Nachmittag zogen wir zu unserem Spielfeld auf Christ Church Meadow, einem langgestreckten Feld unterhalb der Mauern von Merton. Es war ein Ort, den ich liebte, und ich habe mich ihm, wenn ich heute daran zurückdenke, hingegeben wie der Dichter Marvell seinem geliebten Garten:
Ich strauchle an Melonen und1
Verstrickt in Blumen fall zu Grund.
Drei große Kastanienbäume standen in der Ecke, und dort lag ich gern, vom langen, feuchten Gras verborgen, in der stillen, süßduftenden Schwere eines Oxforder Sommernachmittags. Frösche kamen bis nach dort oben herauf und sorgten für Unterhaltung; aus den Augenwinkeln sah ich Grashüpfer an den Halmen schaukeln; träge verkündeten die Glocken der Stadt die Stunden; manchmal hörte ich nach mir rufen – »Morris! Morris! Du bist dran!« –, aber ich wusste, dass sie sich nicht lang die Mühe machen würden. Marvell fand, die beste Zeit im Garten Eden müsse die gewesen sein, in der Adam ihn noch ganz für sich allein hatte, und mein Leben lang habe ich an Orten, und zwar in Landschaften wie in Städten gleichermaßen, eine Anziehung verspürt, die mir tatsächlich eine sexuelle scheint, reiner, doch nicht weniger aufregend als die Sexualität des Körpers. Ich führe diese abwegige, doch angenehme Empfindung auf diese dufterfüllten Cricketnachmittage vor so vielen Jahren zurück:
Der Götter Jagd
Auf irdischen Traum
Endete auch in einem Baum,
Und Pan verfolgt, wenn Syrinx flieht,
Sie nicht als Nymphe, nur als Ried.
Andere Oxforder Verführungen waren weniger zu greifen. Ich liebte die Idee dieses Ortes kaum weniger als sein Äußeres. Ich liebte das Alte und Kuriose, seine Zeremonien, seine Schrullen und Altertümer. Ich liebte die vielen langen Bücherreihen, die sich so oft durch Collegefenster erspähen ließen, und die Gesichter der bemerkenswerten Männer, die wir tagtäglich um uns sahen – Staatsmänner und Philosophen am High Table in der Christ Church Hall, Theologen, stattlich wie Ritter auf ihren Kanzeln, überkandidelte Gelehrte, die auf der High Street Selbstgespräche führten. Ich liebte die Weihnachtsfeiern, die die Chorherren von Christ Church für uns ausrichteten, in den großen Häusern mit Blick auf Tom Quad, in denen sie wohnten. Wie hoch die Kerzen damals waren! Wie üppig und trotzdem bekömmlich die Kuchen! Was für gemütliche Leute die Regius-Professoren diesseits von Amt und Würden waren, die uns sonst einen solchen Respekt einjagten! Was für aufregende Geschenke wir bekamen – Umschläge mit Penny Blacks darauf, mit prächtigen Wachssiegeln von Bischöfen und Kanzlern! Wie glücklich die Gesichter der alten Geistlichen, wenn wir mit aufgeregt angehaltenem Atem unsere Dankesworte murmelten – »Haben Sie vielen Dank, Sir!« – »Das ist aber wirklich großzügig von Ihnen, Sir!« – und sie uns noch einmal, schon ein wenig müde um die Augen, durch den sich schließenden Spalt ihrer Wohnungstüren zunickten!
Mir war nicht so richtig klar, wozu Oxford eigentlich da war, und ich sah auch keinen Grund zu fragen. Es war einfach da, nichts was man bestimmen oder erklären musste, einfach ein Bestandteil des Lebens. Mir kam es wie ein eigenes Land vor, eines, das seine Bewohner offenbar dazu ermunterte, ihre eigenen Interessen und ihr Vergnügen zu verfolgen, nach ihrem eigenen Zeitplan und so, wie es ihnen gefiel – und diese Vorstellung einer idealen Landschaft, durch deren Wälder, durch die Hügel, durch die Auen diejenigen, die das Glück haben, dort zu sein, für kurze Zeit wandern dürfen, ist das Bild, das ich bis zum heutigen Tag von einer Universität hege.
All das waren aufregende Einflüsse auf ein Kind, dessen Aufmerksamkeit so geschärft war wie die meine. Sie bekräftigten mich noch in der Vorstellung meiner Andersartigkeit und meiner Reinheit. Die Schule war angenehm unmännlich: Hier nannte niemand mich einen Weichling, nur weil ich mich poetisch gab, oder fand es albern, dass ich rot wurde, wenn mein Geschlecht zu sehen war. Ich verabscheute Sport, alles außer dem Langstreckenlauf, aber niemand machte mir Vorhaltungen deswegen, und ich glaube, die Sensibleren unter den Lehrkräften spürten bei mir eine gewisse Ambiguität und dämmten sie nach Kräften ein. An einen bestimmten Augenblick der Empathie denke ich bis heute mit pochendem Herzen zurück. Einmal war ich im Zimmer der Hausmutter, wollte vielleicht ein Mittel gegen Bauchschmerzen oder holte gestopfte Socken ab, und plötzlich fasste sie mich bei beiden Händen und fragte mich, ob sie mir etwas zeigen dürfe. Sie sagte es mit freundlichem, doch ernstem Lächeln, und ich stellte mir vor, dass sie mir ein Familienerbstück aus einem Schmuckkästchen zeigen wollte oder ein Bild von einem Lieben. Stattdessen ging sie zum Fenster, schloss die Vorhänge und zog ihr Kleid aus. Ich sehe ihre recht dürre Gestalt noch vor mir, in einem rosafarbenen Unterrock, eine Art Satin, und höre ihre Stimme, mit einem leichten Akzent des ländlichen Oxfordshire – »Du musst dich doch nicht schämen, Lieber, bestimmt hast du doch deine Mutter schon oft im Unterrock gesehen?«
Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, als sie meine Hand nahm, sie um den glatten Stoff an ihrer Hüfte legte und hinten ins Kreuz. »Da«, sagte sie, »fühl mal da.« Ich fühlte nach, und unter dem Satin war ein kleiner, harter Knoten. »Spürst du das?«, fragte sie, kniete sich vor mich auf den Boden und nahm mein Gesicht in beide Hände. »Was kann das sein, Morris? Was meinst du, was das ist?« Ich war gerührt, dass sie mich fragte, ich hatte Angst und war stolz, alles zusammen, und mühte mich nach Kräften (den wenigen, die ich hatte), sie zu trösten. Ach, das sei gar nichts, versicherte ich ihr beherzt, da müsse sie sich keine Sorgen machen. Nur ein kleiner Knoten. Kaum zu spüren. Solche Knoten habe meine Mutter öfter.
Der aufregendste Einfluss von allen war jedoch der, den das Leben in der Kathedrale mir bot. Ich bin nie so recht gläubig gewesen und wünsche mir auch heute noch, die großen europäischen Kirchen würden ihre Kräfte für etwas weniger Abstruses als den Gottesdienst verwenden. Ausnehmen will ich von meiner Respektlosigkeit aber die wirklich waschechten englischen Kathedralen, falls es davon noch welche gibt: die, in denen noch aus dem echten Book of Common Prayer gelesen wird, in denen eine Bibel immer noch eine King-James-Bibel ist, unerschrockene Bräute noch immer die Finger kreuzen, wenn sie Gehorsam geloben, die, in denen es nach Moder und Kerzen riecht, in denen die Müttergilde noch die Kniekissen bestickt, in denen die Aussprache der Geistlichen so klar ist wie ihr Gesang wacklig, in denen goldene Gefäße im Licht der Rosettenfenster schimmern, die, bei denen die Organisten sich während der Predigt entspannt über die Brüstung der Empore lehnen, in denen Stanford in C, The Wilderness oder Zadok the Priest an Festtagen durchs Gewölbe tosen und wo am Ende der Abendandacht brüchig, kaum vernehmlich, doch wunderbar rührend die Segensworte von der fernen, in ihren Chorrock gehüllten Gestalt kommen, die dort am Hochaltar zum Abschluss die Arme breitet. All diese Bedingungen waren in meiner Kindheit bei den Messen in Christ Church in Oxford zur Vollkommenheit erfüllt, und unter Gesängen, die von göttlichen Mysterien kündeten, saß ich und sann, dachte Tag für Tag neu nach über das Mysterium meiner selbst.
Leute, die sich mit Transsexualität beschäftigen, sprechen oft von den geradezu mystischen Erscheinungsformen, in denen sie sich äußert. Der Antike galten Gestalten, die über die Geschlechtergrenzen hinausgingen, oft als etwas Heiliges, und mitfühlende Freunde fanden im Herzen meines Zwiespalts bisweilen eine Art von Inspiration. Ich selbst habe diese Inspiration, so lästerlich oder lächerlich es Skeptikern auch vorkommen mag, zum ersten Mal damals dort in der Kathedrale gespürt. Fünf Jahre lang ging ich, die Ferien ausgenommen, tagtäglich zur Messe, und die Mischung aus Architektur, Musik, Schauspiel und Literatur, aus Suggestion, Assoziation und Religion hatte einen mächtigen Einfluss auf die Betrachtungen, die ich über mich anstellte. Ich kannte dieses Bauwerk beinahe so gut wie mein Elternhaus; oder besser gesagt, ich kannte Teile davon, denn im Verborgenen jenseits des Chorgestühls gab es Votivkapellen und Altarnischen, die aufzusuchen es für uns nur selten Anlass gab, Alkoven, die nur an bestimmten Festtagen zum Leben erwachten und meist in tiefem Schatten lagen, aus denen die verstaubten Standarten längst aufgelöster Regimenter funkelten, Orte, in die bisweilen, als wollten sie sich ungesehen machen, gebeugte Gestalten auf der Suche nach Einsamkeit schlurften. Den hell erleuchteten Umkreis des Chorgestühls hingegen machte ich gleichsam zu meiner Heimat, und dort mehr als an jedem anderen Ort formte ich aus meinem Rätsel meine Bestimmung.
Ein jahrhundertealtes Gotteshaus ist immer ein guter Ort für Geheimnisse, und mein eigenes Geheimnis verschmolz so sehr mit den Formen, Klängen und Strukturen der Kathedrale, dass ich bis heute, wenn ich zur Abendandacht dorthin gehe, etwas wie Komplizenschaft spüre. Vorübergehend fand ich Erfüllung in diesem Bauwerk, indem ich mich ihm ganz hingab. Drüben in der Chorschule hatte ich unter meinen Freunden immer mehr das Gefühl, dass ich mich verstellte; insgeheim, doch unter Schmerzen wand ich mich, wenn Leute, wohlmeinend, doch unwissend, von mir erwarteten, dass ich war wie die anderen. Selbst die Hausmutter, wenn ich auf ihre Vertraulichkeit mit einer eigenen geantwortet hätte, hätte mich zweifellos früh zu Bett geschickt oder mir Feigensirup verschrieben – mehr oder weniger die Reaktion, darf ich dazu sagen, die mir Medizinerkreise auch in den folgenden beiden Jahrzehnten noch entgegengebracht hätten. Manchmal habe ich überlegt, ob all das eine Strafe war. Hatte ich womöglich in einer früheren Inkarnation etwas Schreckliches getan, und dies war dafür meine Verdammnis? Oder gab es eine Wiedergutmachung in einer zukünftigen Existenz, in der ich als Sonja Henie oder Deanna Durbin wiedergeboren würde? Zu wieder anderen Zeiten dachte ich, es ließe sich vielleicht alles durch Leiden lösen, und wenn ich auf dem Zahnarztstuhl saß oder elend auf dem Krankenlager lag oder die anderen mich drängten, als Erster den Sprung ins kalte Schwimmbecken zu wagen, griff ich zu selbst erfundenen Beschwörungsformeln; oft bekam ich zu hören, wie tapfer ich sei, und daraus konnte ich etwas über den Stellenwert des Mutes lernen, denn in Wirklichkeit zählte für mich jeder Augenblick des Unglücklichseins als kleiner Schritt auf dem Weg ins Freie – das waren meine Schätze im Himmel.
Aber in den Stunden, die wir täglich in der Kathedrale verbrachten, konnte ich ganz ich selbst sein. Dort erlangte ich ein kindliches Nirwana. In meinen hellroten, weißen und scharlachfarbenen Gewändern, inspiriert von der Musik, dem Text und den Noten gleichermaßen, war ich ja eigentlich sowieso kein Junge, ich hatte mich in einer Apotheose der Unschuld gewandelt, nach der ich auch heute noch strebe – nicht so unmittelbar wie die selbstvergessenen Stunden im Schatten der Kastanienbäume, doch umfassender in ihrer befreienden Wirkung. Vielleicht ist Klosterschwestern so zumute. In jedem Falle war ich mir sicher, dass ich die Geister dieses Ortes auf meiner Seite hatte; dass sie genau verstanden, was ich mir wünschte. Wie hätte es denn anders sein können? Die edelsten Züge der Liturgie strebten ja nach dem, was mir das weibliche Prinzip schien. Selbst unsere Gewänder schienen dazu da, das Männliche in uns zu leugnen, und die schönste aller Gestalten der christlichen Erzählung, um vieles vollkommener und geheimnisvoller als Christus selbst, war für mich die Jungfrau Maria, deren Gegenwart sich so fremd und elegant in die Evangelien wob, sie selbst schließlich auch ein Rätsel.
Auf diese arglose, wenn auch rührselige Art beschwingt, malte ich mir aus, wie ich die Hülle meines Körpers abwerfen würde, und hervor käme die Reinheit meines wahren Wesens – schlicht und einfach und für immer befreit. Allabendlich bat ich im Gebet darum. Abend für Abend folgte dem Tischgebet – »Möge die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gesellschaft des Heiligen Geistes mit uns sein« – ein Augenblick der Andacht. In diesen stillen Sekunden, in denen die Besseren unter uns vermutlich Vergebung oder Erleuchtung erflehten, flocht ich während meiner ganzen Jugendzeit tagäglich in weit weniger nobler, doch deswegen nicht minder ernst gemeinter Inbrunst im Geiste ein: »Und bitte, lieber Gott, lass mich ein Mädchen sein. Amen.«
Wie Er das bewerkstelligen sollte, davon hatte ich keine Ahnung, und was ich mir denn nun im Einzelnen wünschte, blieb zweifellos so unbestimmt wie eh und je. Den Unterschied zwischen den Geschlechtern kannte ich ja ohnehin kaum, hatte kaum einmal, wenn überhaupt, einen nackten Frauenleib gesehen und betete ohne Verstand, einfach nur intuitiv. Aber der Drang war absolut, er war unbezwingbar, und die Tage, die ich in der Kathedrale verbrachte, heiligten ihn offenbar und machten mir Mut. Mir schien, es gab Kräfte dort, die mir helfen würden, wenn der Tag dafür kam. Ich verzweifelte nicht, und da ich von Natur aus ein fröhliches Kind war und, weil die Umstände es gut mit mir meinten, ein glückliches, gelang es mir, es so einzurichten, dass ich mein Geheimnis eher als ein Versprechen hegte, statt dass es mich als Last bedrückte. »Ich will über alles lachen«, sagt Beaumarchais’ Barbier, »denn sonst müsste ich darüber weinen.« Das alles soll nicht heißen, dass ich geglaubt hätte, ich spürte ein göttliches Walten in mir; aber es war doch so, dass diese Einflüsse meiner Kindheit, diese so englische Form der Toleranz, die Stimmungen und Einstellungen, für die der Name Oxford steht, der Trost des Christlichen, wenn auch nur von dessen äußerer Gestalt, ihren Zauber um all meine Unschlüssigkeiten woben, ihnen eine Seele gaben. Manch einer mag am transsexuellen Impuls etwas Groteskes finden, aber mir ist er niemals beschämend, ja nicht einmal unnatürlich vorgekommen. Ich halte es mit Goethe.