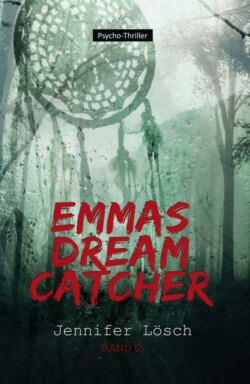Читать книгу Emmas Dreamcatcher - Jennifer Lösch - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 1 – LANGE NICHT GESEHEN
ОглавлениеTante Lynn saß mit leerem Blick und ohne jegliche Emotion auf dem kleinen Sessel in meinem Zimmer. Es waren bereits einige Monate vergangen und ich war noch immer hier in der Klinik. Die „Highfort Klinik für seelische Gesundheit“ war mein neues Zuhause geworden. Es war das erste Mal, dass ich Tante Lynn zu Gesicht bekam. Die letzten Wochen fühlte ich mich alleingelassen, von meiner Familie, meinen Freunden und mir selbst. Es hatte lange gedauert, bis ich mir selbst zugestanden hatte, dass alles nur Einbildung gewesen sein musste. All die Träume und Situationen aus vergangenen Tagen waren nicht real und nicht greifbar. Je mehr Zeit verging, desto mehr verschwamm alles vor meinem inneren Auge. Die Betreuung der Klinik und auch speziell durch Dr. Miller war recht gut. Das Essen war ertragbar, auch wenn ich getötet hätte für eine Tüte Fish´n Chips. Durch den Schlag auf meinem Hinterkopf hatte ich manchmal noch Gleichgewichtsstörungen. Aber die Wunde war im Großen und Ganzen verheilt. Ich nahm einen großen Schluck Kaffee aus meiner mittlerweile heiß geliebten Tasse der Klinik und atmete tief ein. Die Tasse war grün und trug die Initialen E.S. Es musste etwas passieren, die Stille im Raum machte mich verrückt.
„Und wie geht es dir?“, fragte ich entnervt, weil meine Tante Lynn keinen Mucks von sich gab. Wir hatten uns nun Wochen nicht gesehen und sie fragte nicht mal nach, wie es mir hier erging. Wie konnte man nur so egoistisch sein? Keine Reaktion war ihrerseits zu erwarten. Kein Muskel zuckte. Sie starrte weiterhin nur geradeaus, in den kleinen, aber immer noch nett eingerichteten Raum hinein. Da ich sie nicht anrempeln wollte, geschweige denn jegliche andere aus Emotionen geborene Handlung unternehmen wollte, stand ich auf und lief im Zimmer auf und ab. „Wir können das auch lassen, Tante Lynn. Du musst nicht hier sein. Ich bin auch ohne dich klargekommen!“, erwiderte ich mit Nachdruck. Nun liefen ihr Tränen an den Wangen hinunter. Aber das stoppte mich nicht, weiterzusprechen. Sie war die komplette Zeit, ohne sich bei mir zu melden, ferngeblieben. Sie war nicht da. Nicht nur das, sogar meine Ma durfte ich nicht besuchen. Auf Nachfragen hin war es der Beschluss von Tante Lynn. Wenn man dem Klinikpersonal Glauben schenken durfte. Das alles und noch viel mehr machte mich fuchsteufelswild. Ich blieb stehen und schaute Tante Lynn an. Ihre glasig gewordenen Augen und ihre eingefrorene Mundpartie ließen mich dennoch erschaudern. Ein wenig Mitleid stieg in mir auf. War es ungerecht, sie dafür zu verurteilen? War es nicht fair, ihr all die vergangenen Wochen anzukreiden? Auch sie hatte bestimmt schwere Zeiten durchlebt. Sie war es, die ihre Tochter verloren hatte und sich vor Polizei und Ärzten rechtfertigen musste. Vielleicht war einfach keine Zeit übrig gewesen, um auch noch mich zu besuchen. Mir beizustehen und mich und meinen damaligen Aussagen und Geschichten ernst zu nehmen. Ich hätte es wahrscheinlich selbst nicht getan. Ich musste mir eingestehen, dass die ganze vergangene Situation recht merkwürdig war und es für vieles keine Erklärungen geben würde. Ich zweifelte rückwirkend selbst an meiner Wahrnehmung und meinem Verstand. Jeder geht anders mit Trauer um. Und Tante Lynn vielleicht am besten mit Distanz und dem Alleinsein.
Ich lief auf Tante Lynn zu und wollte ihre Schulter berühren. Da sprang sie auf. Nun war sie es, die wie von Hummeln gestochen in meinem Zimmer auf und ab marschierte. Sie stand nun mit dem Rücken zum Fenster. „Emma!“, kroch es ihre heißere und vermutlich sehr trockene Kehle hinauf. „Emma, ich … ich muss dir etwas sagen!“, sprach sie weiter und lief wie in Trance im Raum auf und ab. In der gesamten Zeit, in der sie sprach, würdigte sie mich keines Blickes. „Setz dich bitte“, wisperte sie kaum verständlich und zeigte auf einen der beiden Sessel, auf denen sie selbst vor kurzem gesessen hatte. „Nicht, wenn du dich nicht auch hinsetzt!“, erwiderte ich trocken und so reflexartig, dass Tante Lynn stehen blieb und mich das erste Mal an diesem Nachmittag ansah. Ihre Augen sahen verletzt und gebrochen aus. Der eiskalte Schimmer daraus war verschwunden. Sie wirkte verloren. Als sie mich einige Sekunden lang so ansah, wusste ich, dass sie keine guten Nachrichten für mich hatte, und ich setzte mich hin. Sie immer im Blick, mit dem Rücken den Sesseln zugewandt. Als ich saß, änderte sich ihre Mimik schlagartig. Der verlorene Blick verwandelte sich in eiskalte Züge zurück und ließ mich erschaudern. „Deine Ma ist tot! Sie ist vorletzte Nacht von uns gegangen“, sprach sie kühl und nüchtern. Ich erstarrte. „Es ist nicht so, dass es mich nicht treffen würde, Emma, mich trifft es sehr. Viel zu sehr. Ich habe allerdings keine Kraft mehr. Ich will und kann nicht mehr kämpfen. Wie viel Leid soll ich denn noch aushalten? Wie viele Familiendramen kommen noch?“ Sie vergrub ihr Gesicht in ihren Händen. Fuhr sich wenig später durch die Haare und hielt in dieser Position inne. Gerade, als ich aufstehen wollte, um etwas zu sagen, -ich wusste nicht, ob ich schreien, weinen, um mich schlagen oder einfach nur weiterhin erstarren sollte- , wies sie mich an, sitzen zu bleiben. Sie legte ihre Hand schützend über meinen Schoss, sodass ich nicht aufstehen konnte. „Ich bin noch nicht fertig!“, sprach sie nun mit festerer Stimme weiter. „Du verstehst nicht. Mein ganzes Leben ist ein Drama. Es ist hinüber. Erst habe ich Stacey an diese Klinik verloren, es hat alles mit dem Verlust deines Vaters begonnen. Deine Ma hatte heftige Gefühlsausbrüche und Stimmungsschwankungen, die immer schlimmer wurden, da hat es auch nichts genützt, dass du auf der Welt warst. Ich habe meine Schwester nicht mehr erkannt und wollte ihr um jeden Preis helfen. Koste es, was es wolle! Nach Jahren der Fürsorge und der Zuwendung meinerseits hat sich Stacey irgendwann merkwürdig verhalten und mich plötzlich gemieden.“ Sie fing an, sich in Rage zu reden und schniefte dabei aufgeregt. „Ich habe meine Tochter verloren. Meine einzige und heiß geliebte Tochter Ava. Hast du gewusst, dass die Polizeiakte geschlossen und der Fall als Selbstmord deklariert wurde? Nein? Na ja, woher auch, du bist ja hier drinnen!“ Nun wurde es sehr vorwurfsvoll und ich bekam Angst. Als ich ihre Hand wegschieben wollte, die noch immer über meinem Schoss ruhte, starrte mich Tante Lynn direkt an. Ich wagte nicht, mich in diesem Moment auch nur einen Zentimeter zu bewegen. „Nicht nur das, liebe Emma. Jetzt ist Stacey tot. Gestorben an einem missglückten Selbstmordversuch. Sie schien irgendwie an zu viel Schlafmittel gekommen zu sein. Hatte sich mehrere Tabletten davon in den Rachen geworfen und hatte daraufhin eine Not-OP. Diese Not-OP hat ihr schwaches und mit Medikamenten vollgepumptes Herz nicht überstanden und sie ist gestorben. Deine Ma ist gestorben.“ Endlich stand Tante Lynn auf und ging weiter weg von mir. Ich atmete kurz auf und ließ meinen Tränen freien Lauf. Auch ich erhob mich, um ihr gegenüber zu stehen. Tante Lynn drehte sich wieder zu mir um. „Weißt du, ich habe es auch versucht. Ich habe mir die letzten Wochen mehrfach zum Ziel gesetzt, nicht mehr aufwachen zu müssen. Denn was würde als Nächstes folgen? Was wären die nächsten Schritte? Wie würde es weitergehen? Zur Arbeit kann ich bereits seit Wochen nicht mehr gehen. Dafür bin ich nicht mehr stark genug. Wahrscheinlich habe ich bereits meine Kündigung im Briefkasten liegen, ich weiß es nicht. Nicht einmal das schaffe ich. Den Weg zum Briefkasten.“ Ich ging einen Schritt näher an Tante Lynn heran. „Ich habe mit Dr. Miller gesprochen, Emma. Und habe lange darüber nachgedacht. Ich will einfach nicht mehr und ich will uns alles Weitere ersparen. Du bist die Tochter von Stacey Hensley. Emma Hensley. Es wäre nur eine Frage der Zeit, bis auch du keinen Ausweg mehr finden würdest. Und dich dazu entschließt, mich zu verlassen.“ Ich riss meine Augen auf und wollte Widerworte geben. Niemals würde ich das in Erwägung ziehen. Niemals hegte ich auch nur einen Gedanken an diesen irrationalen Ausweg. Da griff sich Tante Lynn in ihre Hosentasche. Sie zog eine Spritze heraus, die in eine dafür vorgesehene Plastikbox gepackt war. Ich erkannte die Box sofort, da es die gleiche war, die auch hier in der Klinik verwendet wurde. Ich ging wieder einen Schritt zurück und begann schneller zu atmen. „Es tut mir so leid, Emma. Aber ich nehme dir einfach diese Entscheidung ab und helfe dir, dass alles nicht erleben zu müssen. Danach kannst du deinen Frieden finden und ich den meinen. Dann muss ich mir keine Gedanken mehr um dich machen und du musst keinen Hass gegen mich aufbauen, weil ich nur mit mir selbst beschäftigt bin. Ach, Liebes, ich meine es einfach nur gut.“ Tante Lynn ging einige Schritte auf mich zu und griff meinen Arm. Ohne auch nur einen Hauch einer Reaktion schaute ich dem ganzen Spektakel zu und konnte es nicht fassen. Tante Lynn wollte mich umbringen? Sie wollte mir eine Spritze geben, dass ich einschlafen würde? Und das mit dem Einverständnis von Dr. Miller? Das konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich wollte das nicht und vor allem nicht so. Ich war vor kurzem erst 17 Jahre alt geworden, das war doch viel zu jung, um aufzugeben. Außerdem ging es mir doch besser. Oder nicht? Gerade, als ich etwas sagen und meinen Arm wegziehen wollte, wurde mir schwummrig. Die Nadel steckte bereits in meiner Vene. Tante Lynn ließ meinen Arm los und ging mit den Händen vor ihrem Gesicht mehrere Schritte nach hinten. Im nächsten Augenblick wurde mir schlecht und ich fühlte mich benommen. Die Tür sprang auf und Dr. Miller kam mit einigen Assistenzärzten in mein Zimmer gerannt. Ein großer, junger Arzt stellte sich hinter mich und war bereit, mich aufzufangen. Meine Lippen bewegten sich und ich hörte meine Stimme in einer sehr entschleunigten und dumpferen Version „Warum?“ fragen. Dann fiel ich nach hinten um. Einige schreckliche Sekunden später sah ich nach oben und sah Liam über mir stehen. Er zwinkerte mir zu und hielt meinen Oberkörper fest in seinen Armen. Er passte auf, dass meinem Kopf ein weiterer Schlag auf den Boden erspart bleiben würde. „Wach auf, Emma! Das ist nicht real, es ist noch nicht so weit!“, sagte er mit einer genauso dunklen und langsamen Stimme, wie ich meine vorher vernommen hatte. Meine Augen schlossen sich.
Ich öffnete meine Augen wieder. Wie viel Zeit war vergangen? Wo war ich und vor allem, war ich tot? Ich lag wie gewohnt in meinem Zimmer in der Klinik und schaute verwirrt, traurig und sehr benommen in Richtung Fenster. Hier saß niemand. Und das war auch gut so. Wem konnte ich denn noch trauen? Wer wäre für mich da und würde mir helfen? Das würde ich in den nächsten Wochen definitiv noch herausfinden.