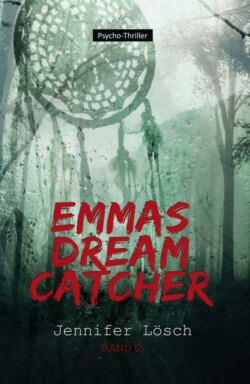Читать книгу Emmas Dreamcatcher - Jennifer Lösch - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 4 – DER BESUCHER
ОглавлениеAm nächsten Morgen betrat Dr. Miller mein Zimmer und grinste mich an. Sie zog wie immer die Vorhänge auseinander, damit etwas Tageslicht eintreten konnte, und öffnete das Fenster einen Spalt, damit frische Luft hineinkam. Danach stellte sie mir ein Tablett mit meinem Frühstück hin und eine neue Pillendose. Es musste also Montag sein. Denn immer Anfang der Woche bekam ich eine neue Pillendose mit allen wichtigen Tabletten für mich. Das Grinsen verging Dr. Miller auch nicht, als sie meine Werte am Monitor ablas und sich zu mir drehte, um mich zu fragen, wie ich denn geschlafen hatte. Ich lag noch in meinem Bett und streckte mich genüsslich.
„Gute Laune?“, fragte ich stumpf.
„Jap“, kam knapp von ihr herüber und sie lächelte noch mehr. „Da haben Sie Mr. Brown aber ganz schön eine verpasst, muss ich sagen.“
Nun musste ich ebenfalls lachen. „Das war ein Reflex“, log ich. Und Dr. Miller wusste, dass es gelogen war.
„Nun ja, Sie werden wohl miteinander auskommen müssen. Denn Sie können Ihrem ehemaligen Freund nicht jedes Mal die Nase brechen, wenn Sie ihn sehen. Das wäre dann nun täglich!“, zwinkerte mir Dr. Miller zu.
„Bitte was?“, erschrak ich, als der Stolz bezüglich der gebrochenen Nase durch das tägliche Sehen in meinem Gehirn ersetzt wurde.
„Ja, Sie haben richtig gehört, Mr. Brown ist nun ebenfalls Patient hier.“ Dr. Miller wirkte besorgt.
„Aber …?“, wollte ich fragen, da lieg sie bereits von meinem Bett weiter weg.
„Das sind mir in letzter Zeit zu viele Jugendliche und zu viele seltsame Ereignisse. Das sollte nicht zum Trend werden“, drehte sich Dr. Miller um und schaute mich nachdenklich an. „Ich möchte, dass es Ihnen und Mr. Brown schnell wieder besser geht und Sie ein Leben ohne die Klinik meistern können. Ich werde immer da sein, wenn Sie Hilfe benötigen. Aber mein Ziel ist es, dass Sie hier rauskommen. Sie beide.“
Mit einem Anflug von Erstaunen über den plötzlichen Gefühlsausbruch von Dr. Miller nickte ich ihr zu. Ihr Gesicht erhellte sich sogleich wieder und sie rückte ihre Bluse gerade. „Gut“ sprach sie nun zufriedener und ging in Richtung Zimmertür.
„Der Kaffee kommt auch gleich“, lächelte sie mir zu.
Gerade, als ich ein „Danke“ mit meinen Lippen geformt hatte, ergänzte Dr. Miller: „Mit Besucher.“ Und ich erstarrte. Das war keine gute Kombination. Erst Kaffee, dann Liam, ja! Aber nicht beides zur gleichen Zeit. Das konnte heiter werden. Soweit ich Dr. Miller kannte, wäre ein „Nein“ egal gewesen in dem Moment. Sie mochte es nicht, wenn man Besucher nicht wertschätzte. Denn manche Patienten in der Klinik bekamen nie Besuch. Und das konnte man ihnen ansehen. Daher sollte es einem immer viel bedeuten, wenn Besuch vorbeikam. So die Theorie. Nur dass es sich hier um einen Verräter handelte, der plötzlich weg gewesen war, als man ihn am meisten gebraucht hatte. Und Menschen in meinem Umfeld, die mordlustige Gedanken hegten und eine Gefahr für jedermann waren, wurde hier wohl außer Acht gelassen. Ich hatte mich bisher sicher in der Klinik gefühlt. Bis jetzt.
Nur wenige Minuten später, als ich die morgige Stille zu genießen vermochte, ging die Tür erneut auf. Dr. Miller hatte nicht zu viel versprochen. Liam stand in der Tür, mit zwei Bechern Kaffee in der Hand. Seine Nase zierte ein weißes Tape und seine Augen waren rötlich unterlaufen. Ich musste ihn doch fester getroffen haben, als mir in dem Moment des Wutausbruchs bewusst gewesen war. Gut so, dachte ich fröhlich und verschränkte meine Arme.
Liam schien dies wahrzunehmen und er stellte meinen Kaffeebecher auf den Tisch neben meinem Bett, anstatt ihn mir hinzuhalten. Als wäre er nun in Abwehrhaltung mir gegenüber. Was ich seltsamerweise verstehen konnte. Daher lockerte ich meine Arme und legte sie neben mir auf mein Bett. „Was willst du hier? Ich brauche keinen Besuch, und deine Nummer im Park war nicht nett. Ich …“
„Ich weiß“, sprach Liam leise und unterbrach meinen aufkommenden Redeschwall. „Es tut mir leid, Emma. Ich war nicht da, als du mich gebraucht hast. Ich habe es mit der Angst zu tun bekommen. Mit der Angst, so zu enden wie meine Schwester hier in der Klinik. Wie Ava damals, die keinen Ausweg mehr gekannt hat und …“
„Die keinen Ausweg mehr gekannt hat?“ Mein Hals wurde trocken und ich begann seltsam zu krächzen. „Keinen Ausweg? Meinst du das ernst? Du hast sie doch mit mir gefunden. Du hast ihr Leben doch gekannt. Na ja, nicht gut, aber immerhin etwas. Glaubst du wirklich, sie hat keinen Ausweg mehr gesehen? Glaubst du immer noch, dass es Selbstmord war?“ Entsetzt setzte ich mich etwas auf in meinem Bett und schlug die Decke zurück. Fest entschlossen aufzustehen und auf Liam loszugehen.
Als ich die Decke zurückschlug, ging Liam ein paar Schritte zurück. Ich dachte, weil er nach dem Fausthieb im Park nun verstanden hatte, dass ich auch anders konnte. Aber nein, er deutete auf meine Beine und starrte mich mit offenem Mund an.
Ich schaute an mir herunter und sah meine mit Schlamm verschmierten Füße. Sie waren so dreckig, dass auch das komplette Bett hätte schmutzig sein müssen. Aber das war es nicht, dass Liam in diesem Augenblick verstummen ließ. Meine Beine waren mit Blut verschmiert, sodass man erst nicht erkannte, wo genau es herkam oder ob es mein eigenes war. Leider war es das, meine Beine waren aufgeschnitten. So tief und akkurat, dass es gewollt sein musste. Wann war das passiert? Ich sah nun in der Ecke meines Zimmers etwas, das vorher nicht da gewesen war. Das glaubte ich zumindest felsenfest. Ein Traumfänger hing in schönen, bunten Farben von der Decke hinab und drehte sich langsam im Kreis. Die Federn strahlten etwas Beruhigendes und Warmes aus. Fast hypnotisierend zog er mich in seinen Bann. Dann plötzlich bemerkte ich heftige Schmerzen, die vorher nicht da gewesen waren. Der Schmerz zog sich hoch bis zu meinem Kopf, der sich nun wieder so anfühlte, als wäre der Schlag darauf vor wenigen Minuten gewesen. Meine Beine bluteten, die Schnitte waren jeweils rechts und links neben dem Schienbeinknochen sauber gesetzt. Mein Gesicht verzerrte sich, als die Schmerzen schlimmer wurden. Ich sah Liam an und hielt ihm meine ausgestreckte Hand hin. „Hilf mir bitte!“ Dann sah ich, warum Liam mich weiterhin mit dieser Schockstarre im Gesicht anstarrte. Ich hielt eine Glasscherbe in der Hand. In der Hand, die auf Liam zeigte. Sie war blutverschmiert und bereits angetrocknet. Wie lange hatte ich in diesem Bett gelegen, mit einer Glasscherbe in der Hand, und nicht mal bemerkt, dass ich mich selbst damit verstümmelte? Das konnte nicht sein. Fing alles wieder an? Was war hier los? Ich hatte mich doch so gut gehalten und meine Genesung war bereits weit fortgeschritten.
Liam bewegte sich nun endlich und half mir, mich auf mein Bett zu setzen. Das Blut lief weiter an meinen Beinen hinunter. „Warte, ich hole die Ärztin!“ Und weg war er. Ich verstand noch immer nicht, was hier gerade geschehen war. Da hörte ich es … Ein Lachen. Ein leises und weit entferntes Lachen. Ruckartig hielt ich mir die Augen zu. Ich wollte das nicht wiedersehen. Keine Gestalten, die es vermutlich nur in meinem Kopf gab. Ich wollte nicht verrückt werden. Aber das Lachen wurde lauter und lauter. Nur verstand ich erst nach wenigen Minuten, dass dieses Lachen von draußen kam und nicht von drinnen. Ich nahm die Hände von meinen Augen und schaute mich im Zimmer um. Noch immer lief mir das Blut an meinen Beinen hinunter. Es brannte fürchterlich. Mein Blick glitt erneut zu dem Traumfänger in der Ecke, der weiterhin vor sich hin baumelte. Mit jedem Tropfen Blut, der an meinem Bein hinabrann, schmerzte es mehr und mehr. Als es kaum noch auszuhalten war, nahm ich meinen Mut zusammen und schaute aus dem Fenster. Eine Frau stand unten im Park und schaute zu mir hinauf. Sie lachte, laut und herzlich. So laut, dass auch andere Patienten nun auf sie aufmerksam wurden. Gerade, als ich versuchen wollte, zu erkennen, wer es war, drehte sie sich um und ging lachend vom Gebäude weg. Meinte sie mich? Konnte sie mich sehen? Wer war das? Becky?
Mir wurde schwummrig, das musste der Blutverlust sein. Mittlerweile hatte sich eine stattliche Pfütze unter mir gebildet. Ich kippte nach vorne weg. Nun lag ich da, wieder einmal am Boden. Wieder einmal allein und ohne Hilfe. Diesmal in meinem eigenen Blut. Was war hier geschehen und warum tat man mir das schon wieder an?
Ich hörte Schritte. Dr. Miller und noch weitere Personen betraten mein Zimmer. Das erkannte ich an den verschiedenen Schritten, die nun auf mich zukamen. Liam war auch wieder dabei. Er half den Ärzten, mich aufzuheben, und stellte sich, als ich endlich wieder saß, hinter mich. Als ich erkennen konnte, wer nun alles hier im Raum war, legte Liam beide Hände auf meine Schultern und sagte: „Ich bin hier, Emma, und ich gehe nicht wieder weg. Ich bin da. Du bist nicht mehr allein!“
Nun kamen weitere Personen und Schwestern mit einer Trage in mein Zimmer und luden mich darauf. Dr. Miller sah mich besorgt an. Ihr Blick sprach Bände, aber ich hatte keine Kraft, mich zu verteidigen. Als ich lag, schloss ich meine Augen und kämpfte nicht mehr gegen die Müdigkeit an. Ich fühlte in den letzten Sekunden, in denen ich bei Verstand war, eine Hand, die meine hielt und diese nicht mehr losließ, bis ich mich nicht mehr erinnern konnte und einschlief.