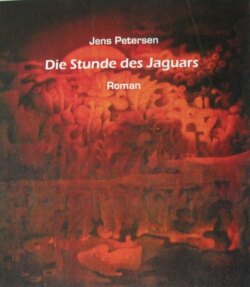Читать книгу "Die Stunde des Jaguars" - Jens Petersen - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Beginn der Regenzeit
ОглавлениеSchwül und stickig war es, als er den Bus verließ. Eine Wolke von Fliegen nahm sich umgehend seiner an. Mit beiden Händen vor dem Kopf fuchtelnd beschleunigte Cuevas seinen Schritt.
Außer ihm waren nur wenige ausgestiegen. Schon bald hatte er die Gewissheit, niemand würde ihm folgen. In den oft unübersichtlichen Menschenmengen der Hauptstadt hätte er sich dessen nie sicher sein können. Hier jedoch war alles viel überschaubarer.
Beim Mittagessen, in einem einfachen, volkstümlichen Restaurant, in der Nähe seines Hotels, hatte er nach reiflichem Überlegen beschlossen, in einer dieser kleinen, idyllischen Kolonialstädte erst einmal Station zu machen. Seine Wahl war auf San Miguel gefallen, welches er mit Sicherheit noch vor der Dämmerung erreichen würde. In Ruhe wollte er die weiteren Schritte hier überdenken. Seine Entscheidung hatte sich als richtig erwiesen. Die Stadt gefiel ihm auf Anhieb. Alles war geruhsam und übersichtlich. Hier würde er die nötige Muße finden.
(Wozu eigentlich soll ich mir diese weite Fahrt noch einmal antun? Die zwei nicht endenden Tage und die Nacht dazwischen kann ich mir sparen. Was meinen Auftrag betrifft, so wird in Sonoyta am wenigsten zu erfahren sein. Für den Fall, dass auch dort irgendwelche Typen darauf angesetzt sind mich zu observieren, sollen sie doch in Sonoyta so lange herumlauern wie es ihnen beliebt. Hier werden sie mich jedenfalls nie vermuten.
Und was den Dienstablauf angeht, da weiß Mantega Bescheid. Es wäre eigentlich nichts, was ich ihm sagen müsste. Anrufen aber sollte ich, dass mit einer längeren Abwesenheit von mir zu rechnen sei. Warum? Was könnte ich ihm da schon erzählen? Soll er sich doch seinen eigenen Reim darauf machen. Das wird er ohnehin tun, ganz gleich was er von mir hört.
Meine kleine Reisetasche ist handlich und enthält alles was ich vorerst brauche. Mehr wäre nur eine unnötige Belastung. Wenn erforderlich, kann ich mir das eine oder andere jederzeit unterwegs kaufen.)
Nach solchen Überlegungen gleich um einiges gelöster, bummelte Cuevas durch die Gassen, jetzt nur noch erwartungsvoll, was die nächste Zeit so bringen würde. Sich frei und unbeobachtet wähnend, sagte San Miguel ihm jedenfalls schon einmal zu. Anheimelnd wirkte es, mit malerischen Häusern und von Blumen überrankten Mauern zwischen denen er ahnungslos flanierte. So wie er es auf Fotos von Andalusien gesehen hatte, erschien es ihm. Doch war so manches anders, eben Mexikanisch, nicht nur die Trachten der Frauen vor den Waschbecken am Eingang der Stadt. In einigen Nischen der oberen Hauswände gewahrte er kleine Figuren aus Stein oder Ton, wie sie seit alten Zeiten als Hausgottheiten gehalten wurden.
(Das passt genau zu dem romantischen Ambiente, diese Harfenklänge, die da aus der Seitengasse dringen. Anfänglich hatte ich gar nicht auf den Text des Gesangs geachtet, bis der Refrain mich aufhorchen ließ.)
„Ay, que me duelen las bolas.”
(Bei dieser schwülen Stimmung eigentlich nicht verwunderlich. Dennoch muss ich über solch unverfrorene Frivolität lächeln.)
Seiner Neugier in die betreffende Seitengasse folgend, sah er einen Jüngling hinter seiner Harfe stehen, den Blick geheftet auf ein Fenster im ersten Stock.
„Muchacha enamorada“,
klang es jetzt schmachtend, eine neue Strophe des Ständchens ankündigend.
(Garantiert wird die wieder in dem gleichen Refrain enden. Aber wie dieser schlüpfrige Hilferuf ankommt bei der Angebeteten, die da oben hinter dem schmiedeeisernen Fenstergitter sichtbar war, will ich denn doch nicht unbedingt abwarten.)
Bis zum Sonnenuntergang war eigentlich noch geraume Zeit. Aber die Zusammenballung der schweren, dunklen Wolken am Himmel wurde zusehends dichter und erzeugte so etwas wie eine vorzeitige Dämmerung. Die altmodischen Lampen, die mit ihren eisernen Trägern abstanden von den Wänden der niedrigen Häuser, glommen jetzt auf und verstrahlten ein trautes Licht. Cuevas schaute prüfend in den Himmel.
(Das kann jeden Moment losgehen. Es wird auch höchste Zeit, nach dem, was ich schon auf der Fahrt von Sonoyta nach Mexico beobachten konnte. Über weite Strecken waren nur Felder mit dürrem, gelblich grauem Gras zu sehen, dazwischen Gestrüpp und Bäume, die ihr gewohntes saftiges Grün vermissen ließen.)
Die dunklen Wolken, die mittlerweile lückenlos den ganzen Himmel bedeckten, hatten ein magisches Zwielicht erzeugt. Wie verstreute Glühwürmchen hoben sich die vor den alten Häusern warm schimmernden Lampen davon ab.
Als er die Plaza betrat mit der kleinen Kirche, kam ihm schon ein frischer Windzug entgegen, wie er so häufig auftritt als Vorbote größerer Regengüsse. Er fegte durch die offenen Gewölbe auf dem Dach der Kirche, ließ die aufgehängten Glocken leicht anklingen und zerzauste die Wipfel der Palmen. Auch die zuvor so aufdringlichen Fliegen hatten sich, nichts Gutes ahnend zurückgezogen. Die Feuchtigkeit der Luft war nahezu greifbar. Waren schon zuvor auf den Gassen nur wenige Menschen zu sehen, so traf er die Plaza völlig leer und dunkel an.
Ein erster Blitz zuckte durch die Wolkendecke. Auf den Punkt zugleich mit dem folgenden Donnerschlag setzten die Mariachi ein. Sie standen da vor dem Café in ihren schwarzen Uniformen und den wagenradgroßen Sombreros wie dräuende Statuen in einer immer grauer und dämmriger werdenden Welt. Wild aufreizend spielten sie. Mit jedem Blitz und jeden Donnerschlag, die jetzt immer dichter folgten zu einem gewaltigen, alles beherrschenden Stakkato, wurden auch ihre Rhythmen heftiger. Vom Donner angefeuert brach es hervor, dieses spontane Zusammenspiel von Naturgewalten und menschlicher Kunst. Als wären Donner und Blitz ihnen in die Adern, die Trompeten, Violinen und Gitarren gefahren. Im Griff dieses überirdischen Spektakels spielten sie mit unerreichter Leidenschaft. Wie gebannt setzten sie dieses himmlische Geschehen fort, ließen von den krachenden Schlägen sich durchdringen, um sie infernalisch, in urwüchsiger Schönheit wieder von sich zu geben. Bizarre Szenerien blinkten, von den Blitzen nur kurz erhellt, über ihren Köpfen auf, für Bruchteile von Sekunden der Dunkelheit entrissen. Kein Zeuge war auf der leeren Plaza, außer Cuevas, der allein diesem einmaligen Schauspiel folgte. Für niemand sonst spielten die Männer, als für die Naturgewalten über ihren Köpfen.
Mit dem Ende des letzten Donners verstummten auch die Mariachi, war dieses verwunderliche Zusammenspiel wie ausgeschaltet. Nichts war nur mehr wahrzunehmen als das gleichmäßige Rauschen dichten Regens, der jedes andere Geräusch aufsog.
Cuevas, bis eben noch gebannt von diesem seltsamen Erlebnis, flüchtete mit wenigen Sätzen in das Café. Dennoch war er bis auf die Haut durchnässt, was bei den gegebenen Temperaturen ebenso schnell wieder trocknete.
Nicht allein seine Abendmahlzeit konnte er hier einnehmen, sondern auch in Ruhe sich darüber klar werden, wie es weitergehen sollte.
(Da wäre keinerlei Punkt, an dem ich ansetzen könnte. Einer von den Dreien wird der Mörder sein. Da bin ich mir sicher. Keiner von ihnen wird auffindbar sein. Henson und Stilton gewiss wieder in den Vereinigten Staaten und damit außerhalb meiner Reichweite. Der alte Indianer, auf den tippe ich am ehesten. Wer sonst käme auf dieses magische Gift? Ihn irgendwo auffinden zu wollen erscheint mir am aussichtslosesten. Selbst angenommen einmal den Fall, rein hypothetisch, ich könnte den Mörder überführen und verhören, welche brauchbare Erkenntnis brächte mir das? Vermutlich wusste der nicht mehr, als dass Gonzalves Wichtiges bei sich trug. Diese Notizen von Gonzalves aber wird der Täter längst bei seinem Auftraggeber, wer immer das sein mag, abgeliefert haben.)
(Das Einzige, was überhaupt etwas verspricht, wäre, wenn ich da ansetze, wo Gonzalves seine Erfahrungen gemacht hat, bei den Lacandonen. Genau da aber fangen bereits wieder die Schwierigkeiten an. Die Lacandonen sind einer der Mayastämme, die, um den spanischen Eroberern zu entgehen, sich in den tiefsten Urwald von Chiapas geflüchtet haben. Dort leben sie seit Generationen völlig abgeschirmt von allen anderen. Kein Weg führt zu ihnen. Zu sonderlicher Kontaktfreundlichkeit werden sie wohl wenig Anlass haben. Selbst wenn mir eine Annäherung gelingen sollte, so wäre da immer noch die sprachliche Barriere. Anzunehmen, dass keiner von ihnen Spanisch spricht.)
Er grübelte weiter:
(Es hilft alles nichts, das ist aber der einzige Ansatzpunkt. Schließlich ist es Gonzalves ja auch gelungen. Ich sollte wohl als Erstes seine Fakultät in der Universität von Mexico aufsuchen und sehen, was ich bei Kollegen über ihn erfahren kann und vielleicht auch in den Archiven über die Lacandonen. Das Nächste wäre dann, nach Palenque in Chiapas zu fahren, um dort weiter zu recherchieren. Denkbar, dass ich dort unten jemanden auftreiben kann, der Kontakt zu ihnen hat. Wenn ich Glück habe, damit auch einen Dolmetscher.)
Mit dem Beginn der Regenzeit war ein wesentlicher Wandel in der Natur eingetreten. Nicht nur die Luft, die Temperatur, die Erde und die Vegetation waren anders geworden. Auch das Empfinden aller Lebewesen war davon beeinflusst. Manche Menschen spürten so etwas. Cuevas gehörte zu denen, die dafür nicht verschlossen waren. Alles Grübeln und Kombinieren brachten ihn nicht wirklich weiter. Wie immer, so hatten die Dinge ihre Eigendynamik. Und soeben, mit diesem radikalen Wandel in der Natur, hatte auch mit seinem Anliegen ein Umschwung stattgefunden. Irgendetwas sagte ihm, dass mit seinem Vorhaben und seinem Schicksal soeben eine Veränderung eingetreten war. Allerdings dachte er nicht an so etwas wie das, was ihn als Nächstes erwartete.
Nichtsahnend blickte er hoch und traute seinen Augen nicht. Zum Greifen nahe vor sich sah er eine unbewegte Gestalt. Absolut nichts hatte er kommen hören. Sie war einfach plötzlich da und hatte das regungslose Gesicht eines älteren Indianers. Augenblicklich schlossen sich ihm die Augen, kniffen sich zusammen, mehr ein Reflex als beabsichtigt. Verschreckt beeilte er sich sie wieder zu öffnen. Kein Irrtum, keine Einbildung, dieses Gesicht war immer noch da. Es war auch nicht der Juan Albanil, der ihm beim Verhör in Sonoyta gegenüber gesessen hatte. Aber er war es doch, kein Zweifel. Natürlich war da keine Spur mehr von einem tumben Dörfler. Dieser hier wirkte plötzlich auf unerklärliche Weise jünger. Kontrollierte Energie strahlte er aus und war der Herr der Situation.
(Hatte ich doch recht mit meiner Vermutung, er ist ein Brujo! Wie macht er das, so plötzlich vor mir zu sitzen, ohne dass ich etwas gemerkt habe? Wie überhaupt konnte er mich hier finden, in diesem Café oder in San Miguel mich ausmachen? Ich bin mir doch absolut sicher, niemand wusste davon und niemand ist mir gefolgt. Das heißt auch, ich muss jetzt sehr auf der Hut sein. Wer weiß was der vorhat? Alle polizeiliche Erfahrung hilft mir da wenig weiter.
Beseitigen wird er mich nicht wollen. Das darf ich mit ziemlicher Sicherheit ausschließen. Wofür oder für wen er auch arbeitet, es wird bekannt sein, das ich über den Fall Gonzalves noch gar nichts weiß. Dass ich die Untersuchung geführt habe ist amtlich vermerkt, also hinlänglich bekannt. Mit der Ermordung eines Polizeibeamten würde er nur verschärfte Verfolgung im ganzen Land auf sich ziehen.)
Es dauerte eine Weile, bis Cuevas sich wieder gefangen hatte und versuchte in seiner gewohnten Rolle Halt zu finden.
(Der traut sich, mir unter die Augen zu kommen! Weiß der denn nicht, wie verdächtig er ist?)
Sagte er sich, mehr zu seiner eigenen Beruhigung.
(Nein, so dämlich ist der keineswegs. Also was will er? Verdammt, ich muss mich jetzt konzentrieren und beweisen, dass ich hart bleiben kann.)
„Na, du hast Nerven, hier so direkt vor meinen Augen aufzutauchen!“
Brachte er endlich hervor nach einer schon viel zu langen, ihm peinlichen Pause des Schreckens. Wenigstens gefangen hatte er sich damit endlich wieder. Dennoch sollte es ihm nicht gelingen den Eindruck abzuschütteln, er wäre derjenige, der hier vernommen wird.
Juan schaute ihn interessiert musternd und ohne Hast von oben bis unten an, wie einen Gegenstand, den man unter Umständen erwägt zu kaufen. Schließlich kam er mit dem Entschluss herüber:
„Von den erwähnten Nerven einmal abgesehen, habe ich auch gute Gründe.“
(Mein Anblick hat also dem Herrn Comisario einen richtigen Schrecken eingejagt. Aber allmählich scheint er sich wieder zu fangen und wird ganz der Alte.)
„Wenn ich nicht zufällig mich entschlossen hätte, heute noch loszufahren, und wenn mir die lange Fahrt nach Sonoyta nicht zu lästig wäre, und wenn ich nicht kurzfristig entschieden hätte, in einer hübschen, kleinen Kolonialstadt Station einzulegen, ja, dann wärest du mir hier nicht begegnet.“
Mit unberührter Gelassenheit betrachtete ihn Juan weiter.
„Wenn, wenn und nochmals wenn. Dabei war es einfacher als du denkst. Ich brauchte nur am Schalter im Terminal del Norte zu fragen, wohin du gebucht hattest.“
(Jetzt besitzt er auch noch die Unverschämtheit, mich zu duzen.)
„Und das soll man dir verraten haben?“
„Die Info war mir schon 20 Peso wert.“
„Nun ja, vorstellen könnte ich mir das.“
Cuevas musste nun doch lächeln. Lange genug hatte es zwar gebraucht, aber diese kleine Erheiterung hatte ihm geholfen sich endgültig zu fangen.
„Aber wie hast du mich hier gefunden? Mit Observierung kenne ich mich schließlich aus und weiß genau, dass in San Miguel mir niemand gefolgt war.“
„Das war auch nicht nötig. Es genügte, auf der Plaza dich zu erwarten. Auch das war denkbar einfach. Die Mariachi hatten dich so in ihrem Bann, dass nichts anderes dir aufgefallen ist.“
„Und was willst du jetzt von mir?“
„Richtig vermutet, grundlos werde ich nicht hergekommen sein. Also will ich was von dir, nämlich dir auf die Sprünge helfen, den Mörder von Gonzalves zu finden.“
Jetzt überkam Cuevas doch ein mitleidig, spöttisches Lächeln.
„Ach ja, für so dämlich hältst du mich, glaubst mich damit zu übertölpeln.“
Juan betrachtete ihn immer noch wie einen Gegenstand über dessen Weiterverwertung man sich seine Gedanken macht, bevor er unbeeindruckt fortfuhr:
„Wenn ich in Sonoyta gemordet hätte, wie du immer noch glaubst, dann wäre ich wohl kaum hier aufgetaucht. Also, den Mörder findest du in San Blas, Nayarit, im Hotel San Angel. Sollte nicht schwer sein. Er ist z.Zt. der einzige Gringo dort.“
„Woher willst du das denn schon wieder wissen? Oder soll ich jetzt vielleicht auch noch glauben, du wärest inzwischen nur um dies zu erfahren mal eben in dem immerhin ziemlich weit entfernten San.Blas gewesen?“
„Es steht dir natürlich frei, zu glauben was du willst.“
„Und damit hoffst du, den Verdacht von dir abgewendet und mich irgendwohin ins Blaue geschickt zu haben?“
„Eigentlich hatte ich dich für besonnener gehalten. Warum sollte ich denn gekommen sein, nur um dich irgendwohin ins Blaue zu schicken, wie du es nennst? Wäre es nicht viel einfacher gar nicht erst hier aufzutauchen? Wenn ich wollte, wäre es mir ein Leichtes zu verhindern, dass wir uns überhaupt jemals begegnen.“
(Jetzt spielt er hier die Nummer des völlig Abgeklärten. Meint mich damit zu beeindrucken. Das kommt bei mir ebenso wenig an wie beim Verhör in Sonoyta die mit dem einfältigen Dörfler. Nun wäre wohl der Zeitpunkt einmal die Tatsachen auszuspielen.)
„Das hört sich alles ganz schön an. Aber was sagst du dazu: Unser Labor hat herausgefunden, dass Gonzalves ein schnellwirkendes Gift gespritzt wurde, wie es eigentlich nur indianische Brujos kennen.“
„Das sagt mir nur, warum dein Verdacht sich so an mir festgebissen hat. Um welches genau handelt es sich denn?“
„Um Xomil-Xihuite!“
„Ein sehr unangenehmes Zeugs. Ich erinnere mich, dass 1932, als man versuchte einen Schnaps daraus zu panschen, es in Topolobampo, Sinaloa, eine Massenvergiftung gab. Ich weiß aber auch, dass in den USA die Pharmaindustrie sich dafür interessiert und systematische Versuche damit angestellt hat. Daher, vermute ich, wird der Mörder es haben. Kein Brujo gibt seine Rezepte so einfach weiter.“
„Ich werde der Sache nachgehen. Erst einmal aber muss ich dich verhaften und auf der hiesigen Station verhören.“
Er hätte das ebenso gut zu einer der antiken Statuen im Museo Anthropologico sagen können oder zu dem Denkmal Cuautemocs in der Mitte des Paseo de la Reforma.
Nicht mal ein Bedauern zeigte das Gesicht Juans. Vielleicht war es kritikloses Einverständnis mit gegebenen Tatsachen, als er sagte:
„Schade Alfonso, oder sollte ich kurz Alf sagen? Ich hatte dich für klüger gehalten. Wahrscheinlich bewirkt die Polizeiarbeit, dass man auf einem Auge blind wird und grundsätzlich erst einmal das Schlechteste für die Wahrheit hält. Du wirst da in der nächsten Zeit noch so manches lernen, u.a. auch, dass man eine Idee weder verhaften, noch einsperren oder erschießen kann.“
„Was ist das? Was lässt dich und auch die ganze Umwelt auf einmal so verschwommen erscheinen?“
„Das war nur meine Rückversicherung. Sie lag in deinem Drink. No tenga pena, keine Angst! Sie ist nicht weiter gefährlich. In einer Stunde, wenn das Café zumacht, wird der Kellner dich wieder wachrütteln und hinausbegleiten. Du fällst damit nicht weiter auf. Wenn du vernünftiger gewesen wärest, hätte ich dir das Gegenmittel angeboten. Aber so?“
Genau so kam es auch. Als der Kellner ihn fürsorglich hinausbegleitete, sagte er noch:
„Ihr Freund erklärte mir schon, Sie hätten wahrscheinlich einen über den Durst getrunken. Na, ich sehe, jetzt geht es schon leidlich wieder. Dann kommen Sie gut heim, y buenas noches, borrachito.“
„Borrachito“,
murmelte er vor sich hin,
„so muss ich mich noch nennen lassen!“
Etwas benommen war er immer noch, als er durch das beinahe kniehoch stehende Wasser in den Gassen stapfte. Zu stark war der erste Regen gewesen. Das Wasser konnte gar nicht schnell genug abfließen. An seiner linken Seite tauchte ein Boot auf, beladen mit Früchten. Der Indianer am Heck stakte es mit einer langen Stange an ihm vorbei. Jetzt gewahrte er auch einige Chinampas, diese schwimmenden Gärten, üppig bewachsen mit Gemüse und Früchten. Manche trugen sogar kleine Bäume.
(Wie kann denn das angehen?)
Benebelt wie er immer noch war, versuchten seine Gedanken dennoch das Wahrgenommene zu ordnen.
(Ich bin doch hier in einer Stadt. Da dürften rechts und links eigentlich nur Häuser
sein.)
Während er sich solches noch fragte, sah er sich vor dem Tor eines Palastes, wie es aussah präkolumbianisch, der aus dem Wasser heraus ragte. Aufs Prächtigste verziert war er mit Blumen, Vögeln und Schmetterlingen, alle aus farbigen Steinen, manche davon wie schillerndes Glas, mosaikartig eingesetzt. Alles spiegelte sich noch einmal im Wasser darunter, nur glatter und glänzender. Seine Faszination und Neugier waren grösser als irgendwelche Zurückhaltung. Niemand hinderte ihn auch, durch das Portal hinein zu gehen. Drinnen sah er die Wände ebenfalls auf das Schillerndste ausgestaltet, überwiegend mit Blumen und Vögeln.
(Seltsam, wo bleiben denn die üblichen Darstellungen der Götter? Nirgends sehe ich finster dreinblickenden Monster, die bei antiken indianischen Bauten üblichen Zähne fletschenden und Krallen spreizenden Ungeheuer, noch irgendeinen schlangenköpfigen Drachen. Nicht einmal die sonst so unverzichtbaren Totenköpfe kann ich irgendwo ausmachen. Nur überall Blumen und Vögel in prächtigsten Farben, als gäbe es nichts anderes als eine liebliche Welt, dominiert von Friede und Schönheit.)
Aber hier befand er sich erst im Vorraum zu einem Saal. Der war angefüllt mit Menschen, soweit er erkennen konnte, ausnahmslos Indianer. Farbige, gewebte Umhänge trugen sie und reichhaltigen Federdekor auf den Köpfen. Alle schauten nach vorn, auf eine Art gemauertes Podest, welches soeben ein besonders prächtig Gekleideter bestieg.
„Das ist Netzahualcoyotl“,
raunte sein Nebenmann, und fügte erläuternd hinzu:
„Dichter, Philosoph, Baumeister und König von Texcoco. Er trägt gerade einige seiner Gedichte vor:
„Lebt man denn wirklich mit Wurzeln auf der Erde?
Nein nicht für immer auf der Erde,
nur ein wenig hier.
Auch wenn Jade zerbricht,
auch wenn Gold entzwei geht,
auch wenn Quetzalfedern zerreißen,
nicht für immer auf der Erde,
nur ein wenig hier.“
Hörte er den Vortragenden, als sein Nebenmann wieder wisperte:
„Er vertritt z.Z. den auf einer langen Reise befindlichen Hausherren, keinen anderen als Eins-Rohr oder auch Quetzalcoatl genannt. Hier nämlich befinden wir uns in Eins-Rohrs Wasserpalast.“
Cuevas wollte noch Näheres erfahren und drehte sich zu seinem Gesprächspartner. Doch in dem Moment vergaß er, was er fragen wollte, denn er schaute erneut in das jetzt erheiterte Gesicht von Juan Albanil. Der sagte nur aufmunternd:
„Wir sehen uns also dann, in San Blas.“
Aber als er aufwachte, befand Cuevas sich im Bett seines Hotelzimmers und im Unklaren darüber, wie er dorthin gekommen war.
Dave schlug die Augen auf und war ebenso erschöpft wie verwirrt. Er lag wieder in der Hütte, aber jetzt scheinbar endgültig. Kein Obsidianspiegel war auf dem Tisch zu sehen, weder Jaguarmänner, noch Opferpriester, Inquisitoren oder Militärs irgendwo in Sicht. Allein Juan saß verkehrt herum auf dem einzigen Stuhl, die Arme auf der Lehne verschränkt und beobachtete ihn.
Dave war sichtlich bemüht, wieder in dieser Realität zu landen. Schließlich entrang sich ihm die Frage:
„Hatte ich geträumt?
„Das wäre eine ungenaue Bezeichnung dafür.“
„Oder hattest du mir irgendwelche Drogen eingegeben?“
„So wie diese Frage gestellt ist, ist mir erlaubt sie zu verneinen.“
Den ungläubigen Blick beruhigend, fügte er noch hinzu:
„Ich bevorzuge grundsätzlich die Wahrheit. Zwar gibt es Fälle, in denen Unwahrheiten, also Täuschungen notwendig sind. Aber Lügen können leicht dem eigenen Denken Fesseln anlegen. Nur wird die Wahrheit leicht missverstanden. Man sollte da schon genau hinhören.“
Dave betastete sich, fuhr mit der Hand in das Hemd, sich zu vergewissern, ob einige Knöpfe abgerissen waren. Dann fühlte er die linke Brustseite ab in Herzhöhe nach einer Schnittwunde, spürte aber nicht einmal einen Kratzer. Nun kam ihm auch die Erinnerung. Das war der Moment, als ihn das erste Mal das Bewusstsein verließ. „Dann war also alles real?“
„Wer nicht die erlebte Welt interpretiert und aus sich selbst heraus neu entwickelt, wer einer imaginären nachjagt, der landet auf die eine oder andere Art auf dem Opfertisch. Man erlebt das, wovor man sich gefürchtet hat.“
Er betrachtete ihn aufmerksam eine Weile bevor er fortfuhr:
„Du hast doch etwas gesucht, als du mir folgtest in Sonoyta und schon vorher seit Guaymas?“
„Ja.“
„Das Ergebnis einer derartigen Suche offenbart sich erst allmählich und endgültig gegen Schluss. Es ist die Erkenntnis, was wirklich von Bedeutung ist. Fast das gesamte menschliche Streben und Tun ist unwichtig, sozusagen Spielerei, Zeitvertreib und nicht selten auch noch destruktiv. Müßiges Streben nach Macht, Reichtum und Ruhm, heute nennt man es Promi-Status, ist sehr kurzlebig, selbst echter Ruhm vergänglich. Obgleich geistiges, kulturelles Schaffen noch zu dem Ehrenwertesten gehört.“
„Was wäre geschehen, wenn ich mich nicht umgesehen hätte?“
„Garnichts, du hättest nur immer weiter in den schwarzen Spiegel geschaut.“
Dann ist der Obsidianspiegel also nutzlos, nur ein Stück Dekor?“
Juan konnte sich ein Lachen nicht mehr verkneifen.
„Er ist so nutzlos, dass manche Menschen die absurdesten Verrenkungen anstellen, um in seinen Besitz zu kommen. Versprechen sie sich doch Geld und Macht davon. Richtig ist, der Obsidianspiegel ist die Pforte zu so manchen Dingen. Diese haben aber nichts zu tun mit einem schnell erreichbaren Zustand des Glücks. Es gibt keine Alternative, als weiterhin auf dem langen Weg des Leidens und Lernens zu bleiben. Um ihn vor Missbrauch zu bewahren, muss der Obsidianspiegel stets wieder verschwinden, unerreichbar, unauffindbar sein.“
Eine weitere Pause und ein prüfender Blick sagten ihm, dass Dave jetzt angebissen hatte, fest an der Angel hing.
„Einen langen Trip hast du vor dir auf dem du noch die Fragwürdigkeit deiner Wahrnehmung kennenlernen wirst. Wirklichkeit und Fantasie werden oft nicht zu unterscheiden sein. Von neuen Realitäten wirst du nicht nur erfahren, du wirst sie durchleben. Nur einige der verschiedenen Zeiten und Kulturen hast du soeben durchlebt, um zu erkennen, wie sich in unendlicher Folge alle diese Belanglosigkeiten der menschlichen Geschichte wiederholen, um endlich zu begreifen, was wirklich von Bedeutung ist. Der Obsidianspiegel ist ein Öffner dazu.“
Das Gesicht von Dave war wiederum Anlass zur Erheiterung.
„Ich kann Dich beruhigen, langweilig wird es nicht!“
Da war noch etwas, das Dave weiterhin beunruhigte.
„Sollte ich tatsächlich den Göttern geopfert werden?“
„Zumindest solltest du die Erfahrung machen, wie so etwas ist.“
„Wieso sind die Götter so grausam und furchterregend, verlangen Menschenopfer? Angst und Schrecken sind doch dadurch an der Tagesordnung. Warum hatten die Indianer keine gütigen, wohlmeinenden Götter wie anderswo?“
„Weil ihre Götter so sind.“
„Können Götter sich denn nicht ändern?“
„Nein.“
„Also, bleiben sie ohne Hoffnung?“
„Keineswegs“
„So, was denn?“
„Diese Götter fortschicken und andere holen.“
„Geht das denn so einfach?“
„Ganz einfach so“,
antwortete Juan und schnippt dazu mit den Fingern.
„Aber ich gebe zu, die Meisten tun sich dennoch schwer damit, können sich nicht von den einmal angenommenen Göttern trennen, auch wenn diese noch so unheilig für sie sind.“
„Aber die Götter sind doch gar zu mächtig. Sie sind überall, sie sind der Himmel, die Erde, die Sterne, einfach alles.“
„Nein, du verwechselst sie mit der Welt der Erscheinungen.“
„Aber der eine Gott der Spanier und der meisten anderen Abendländer, der ist so.“
„Was der ist, wird dir keiner der Spanier wirklich erklären können und auch keiner ihrer Padres. Wenn du mich fragst, ist er nur ein Begriff, um nicht an der Welt der Erscheinungen zu verwirren.“
„Dann sind die alten Götter also Geister?“
„Nein, Götter sind Götter und Geister sind Geister.“
„Wieso haben denn verschiedene Völker verschiedene Götter?“
„Du sagst es.“
„Wie?“
„Du sagst es, sie sind verschieden, und so eben auch ihre Götter. Götter leben von dem Glauben der Menschen an sie.“
„Sterben sie, wenn niemand mehr an sie glaubt?“
„Ja, aber nicht endgültig.“
„Wie das?“
„Sie können jederzeit wieder auferstehen, wenn wieder an sie geglaubt wird.“
„Und auf diese Art kann man dann auch die Götter fortschicken?“
„So ist es. Besonders, wenn sie sich als lästig und schädlich erweisen, oder ihre Anhänger zu Taten verleiten, die Unheil bringen über die Menschen, die Tiere oder die Natur überhaupt. Man muss dann ihre Anhänger dazu bringen, an heilsamere Götter zu glauben. Es gab da einen sehr deutlichen Fall.“
„Ja, welchen?“
„Na, hier in diesem Lande. Hätten wir freundlichere Götter, so hätte es keine Menschenopfer gegeben, weniger Unterdrückung, weniger Leid, weniger Rachegefühle. All das hat so viel Negatives, soviel Verzweiflung erzeugt, dass es genügte, unsere Kultur zu zerstören.“
„Wie das?“
„Eine gesunde Kultur, ein Ergebnis heilsamerer Götter, hätte den Spaniern schon nach deren Landung Einhalt geboten, in dem später Vera Cruz genannten Ort. Es wäre beim Austausch von diplomatischen und Handelsbeziehungen geblieben. So aber schlossen sich riesige Scharen von Kriegern der Unterdrückten ihnen an, weil sie die Gelegenheit zur Rache und Befreiung in ihnen sahen. Nicht ahnend, dass sie damit neues Leid, auch auf sich selbst, heraufzogen. Die Menschen sehnten sich nach gütigeren Göttern, nach der Rückkehr Quetzalcoatls. Der Prophezeiung nach sollte er aus der Richtung der aufgehenden Sonne wiederkommen, über das Meer, und ausgerechnet in demselben Jahr, als Cortez mit seinen Leuten landete. Dass diese alles andere als Götter waren, davon überzeugte sie schon der sie umgebende Gestank.
Aber jetzt ruh dich erst einmal aus. Es ist zwar kein Fehler auch geistige Nahrung gründlich zu kauen, bevor man sie verinnerlicht. Nur sollte man sie nicht wie Kaugummi behandeln.“