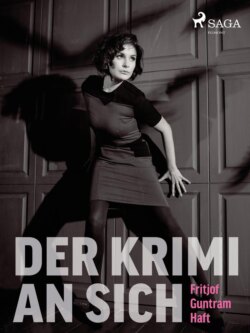Читать книгу Der Krimi an sich - Jerry Cotton - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
A. Einleitung
ОглавлениеDer Krimi ist die älteste aller literarischen Gattungen. Schon in der Bibel finden Sie im ersten Buch Mose Kapitel 3 alles, was auch heute noch für einen Krimi erforderlich ist, einen Bösewicht im Hinter- (genauer: Unter-)grund, nämlich die Schlange, eine Täterin, das Weib, einen weiteren Täter, den Mann, eine Tat, den Mundraub, einen Aufklärer, den HERRN und eine Strafe, die Ausweisung aus dem Garten Eden. Aus der Sicht des heutigen Strafrechts handelt es sich bei dem Handeln von Weib und Mann um einen Fall echter arbeitsteiliger sukzessiver Mittäterschaft i. S. d. § 25 Abs. 2. Strafgesetzbuch (StGB) bei der Begehung eines Diebstahls, § 242 StGB (den früheren Tatbestand des Mundraubs gibt es im Sozialstaat nicht mehr), wobei die erforderliche Beweglichkeit der Sache durch das Abpflücken vom Baum (an sich Bestandteil einer unbeweglichen Sache, nämlich des Paradiesgartens) herbeigeführt wurde, was nach der wegweisenden Entscheidung des Landgerichts (LG) Karlsruhe in der Neuen Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 1993, S. 542 am Fall abgefressenen Grases unter einhelliger Zustimmung des Schrifttums geklärt wurde. Die Tat ist auf eine Anstiftung der Schlange, § 26 StGB, zurückzuführen, deren Strafe jedoch gemäß §28 Abs. I StGB nach §49 Abs. I StGB zu mildern ist, da besondere persönliche Merkmale, welche die Strafbarkeit der Täter begründen, bei der Schlange fehlen. Vielleicht wollen Sie jetzt wissen, was »besondere persönliche Merkmale« sind. Nun, ein Blick auf § 14 Abs. I StGB schafft hier Klarheit. Das sind »besondere persönliche Eigenschaften, Verhältnisse oder Umstände«. Und wenn Sie weiter fragen, was das ist, kann ich nur sagen, daß die Strafrechtswissenschaft noch nicht so weit ist. Wir arbeiten aber daran. Wahrscheinlich fällt der Wunsch, so zu sein wie der HERR und zu wissen, was gut und böse ist (was heute noch kein Allgemeinwissen ist, wie jeder Gefängnisdirektor bestätigen wird) unter diese Rubrik, auch wenn der Bundesgerichtshof für Strafsachen (BGHSt) das noch nicht abschließend geklärt hat. Nach der Bibel wollte das Weib überdies von dem Baum essen, weil er lieblich anzusehen und ein lustiger Baum wäre (diese Übersetzung stammt m. E. nicht von Martin Luther) und weil er klug machte, weshalb sie auch ihren Mann davon essen ließ; daß dies jedenfalls »persönliche Umstände« sind, scheint mir richtig zu sein, aber bis zu einer höchstrichterlichen Entscheidung muß ich diese Feststellung unter Vorbehalt stellen und von der Autorenhaftung ausnehmen. Die Strafe war vergeltend im Sinne der absoluten Straftheorien von Kant und Hegel, nämlich Verfluchung zum lebenslangen Auf-Dem-Bauche-Gehen-Und-Erde-Essen sowie zum »Kopf-Zertreten-Werden« (Schlange), zu Schlangenbissen in die Ferse, schmerzhaften Schwangerschaften und Unterordnung unter den Mann (Weib), die bis heute trotz des segensreichen Wirkens von Alice Schwarzer anhält, und zu kummervoller lebenslanger Berufsausübung im Großraumbüro während der Mobbingpausen der lieben Kollegen (Mann). Wie modern die Bibel bei alledem ist, hat P. G. Wodehouse mit der Geschichte eines Kaliforniers aufgezeigt, der seine liebe Frau loswerden wollte. Da nach kalifornischem Recht die Frau im Falle einer Scheidung die Hälfte des Vermögens des Ehemannes bekommt, erinnerte er sich aus seinem Konfirmationsunterricht an die Geschichte mit der Schlange. Er besorgte sich eine Klapperschlange, steckte sie in die Hosentasche und legte die Hose auf einen Stuhl im Schlafzimmer. Seine Frau kam und wollte wie üblich Geld von ihm haben. »Es ist in meiner Hose im Schlafzimmer«, sagte er. Sie ging dorthin und rief: »Meinst du die Hose, die auf dem Stuhl liegt?« – »Ja«, sagte er wohlgemut. Er vernahm ein rasselndes Geräusch, dann kam sie zurück und sagte: »Da ist nichts, bloß eine Klapperschlange.«
Auch das zur biblischen Zeit in Mesopotamien verbreitete Gilgamesch-Epos war ein Krimi. Gilgamesch, der König von Uruk, herrschte als Despot und zwang seine männlichen Untertanen zu gigantischen Bauprojekten, was deren sexuelle Leistungsfähigkeit verringerte. Ihre Ehefrauen beschwerten sich bei der Göttin Ištar, die sich an ihren Vater, den Himmelsgott An, wandte, dem dieser Weiberkram aber lästig war, weshalb er die Muttergöttin Aruru anwies, aus Lehm Enkidu zu schaffen, ein wildes, menschenähnliches Wesen, das später in die Rocky Mountains der USA auswanderte und dort den Namen Bigfoot erhielt. Enkidu sollte den Gilgamesch ermorden, aber es kam ein Traum dazwischen, ferner eine Dirne, die Erfindung des Bierbrauens und aus letzterem folgend der Erwerb des Verstandes bei Enkidu. Vereint betranken sich Gilgamesch und Enkidu. Es folgten dann diverse Heldentaten. Ich breche ab. Ich denke, Sie haben erkannt, daß es sich auch hier um einen klassischen Krimi handelte. Der geplante Mord, §211 StGB, wurde infolge eines strafbefreienden Rücktritts vom Versuch, § 24 StGB, nicht ausgeführt, wobei bis heute darüber diskutiert wird, ob ein im Zustand der Schuldunfähigkeit gemäß § 20 StGB, also jenseits von 4 Promille Blutalkoholkonzentration, begangener Rücktritt als freiwillig zu beurteilen ist, was zwingende Voraussetzung des Rücktritts ist. Ich kann das hier nicht näher ausführen und verweise interessierte Leser auf den hilfreichen StGB-Kommentar von Schönke/Schröder, §34, Rzn. 42 ff. (die Auflage ist egal, da sich im Trunkenheitsbereich nichts zu ändern pflegt).
Daß die Ilias von Homer ebenfalls ein Krimi war, liegt auf der Hand. Ich sage nur: »Zorn des Achilleus«, ein klassischer sthenischer Affekt der Stärke, der keinesfalls die Überschreitung der Grenzen der Notwehr gemäß § 33 StGB entschuldigen kann. Der Rest ist Vorbereitung eines Angriffskrieges, §80 StGB, Beleidigung in allen Varianten, §§185 ff. StGB, Mord, §211 StGB, Totschlag, § 212 StGB, Störung der Totenruhe, § 168 StGB, Betrug, §263 StGB, Brandstiftung, §306c StGB, Gefährdung des Schiffsverkehrs, §315a StGB, Völkermord und dergleichen mehr. Daß die fahrenden Sänger in Mykene und anderswo mit diesem Krimi auf begeisterte Zuhörer stießen, zeigt, daß der heutige TV-Krimi, wie er auf allen Sendern an allen Abenden bis zum Ab(Er-)-brechen gesendet wird, nur ein Glied in einer langen Tradition ist. Stellen Sie sich vor, die Sänger hätten davon gesungen, wie fleißige Bauern ihre Felder bestellten, genügsam lebten, Weib und Kinder versorgten, freundlich zu ihren Nachbarn waren und das Ersparte bei der mykenischen Raiffeisenkasse anlegten. Homers Recken hätten sie erschlagen. Und stellen Sie sich dasselbe am Freitagabend um 20:15 Uhr im Fernsehen vor. Die Quote sänke unter eine meßbare Größe.
Diese drei Beispiele, denen ich viele weitere hinzufügen könnte – nehmen Sie etwa den Beginn der deutschen Literatur im Nibelungenlied – belegen, was die Menschen bewegt, was sie lesen, hören und heutzutage, da das Lesen zusehend in Vergessenheit gerät, abends im TV sehen wollen: Krimis. Die andere große Literaturgattung, die Liebesgeschichte, kam historisch erst in späteren Dekadenzzeiten hinzu und hatte gegen den Krimi niemals eine echte Chance. Am Ende wurde aus der Liebesgeschichte dann immer doch ein Krimi. So etwa bei Ovid, der in seinen Metamorphosen die nach Meinung von Kennern schönste Liebesgeschichte aller Zeiten geschrieben hat: Philemon und Baucis. Der Gott Zeus und sein Sohn Hermes verkleideten sich als arme Wanderer (warum sie das taten, verrät uns Ovid nicht), besuchten eine Stadt (welche es war, wissen wir nicht) und begehrten Einlaß. Natürlich kriegten sie den nicht. Würden Sie etwa ein Obdachlosenpaar von der Straße zum Essen mitbringen? Ihre Frau respektive Ihr Mann würden Ihnen etwas husten! Nicht so Herr Philemon und nicht so Frau Baucis, ein liebes, altes Ehepaar mit verrunzelten spinnwebgeschmückten Gesichtern, aus denen gütige Augen gütig blickten. Sie bewohnten eine ärmliche Hütte im Glasscherbenviertel der Stadt, aber sie nahmen die beiden vermeintlichen Penner auf und teilten ihr karges Mahl mit ihnen. Daraufhin gaben sich die Götter als solche zu erkennen, verwandelten die Hütte in einen goldenen Tempel und ernannten beide zu dessen Priestern. Auf die Frage, ob sie sonst noch etwas für die beiden tun könnten, sagten diese Gütigen lediglich, sie wollten sich nie trennen müssen und beide gleichzeitig sterben. So geschah es, und nach ihrem Tod verwandelten die Götter sie in zwei Bäume. Philemon wurde eine Eiche, Bauds eine Linde. Das Ganze erinnert an die Szene im alten Wiener Vorstadttheater, in der die arme Häuslerfamilie an Heiligabend in der kalten Stube hockt, frierend, hungrig, krank, ohne Weihnachtsbaum, voller Jammer und Verzweiflung. Da tritt eine goldbetresste Gestalt in die Stube, stellt einen reich gefüllten Gabenkorb auf den Tisch, und damit es kein Mißverständnis gibt, schlägt der Wohltäter den Mantel zurück, so daß die Orden auf seiner Brust blinken, und spricht ins Publikum: »Meinen Namen sollt's nie derfahren. I bin der Kaiser Joseph.« Da schluchzt das Publikum, und auch Ovid schluchzte am Ende seiner rührenden Geschichte, und damit des Schluchzens ein Ende war, ließ er Zeus die Stadt mit den hartherzigen Menschen in einen See verwandeln, in dem alle jämmerlich ersoffen. Heute steht dort zweifellos ein Resorthotel, das man über die TUI buchen kann. So kam es dann doch noch zu einem Krimi.
Einer der größten Krimischreiber aller Zeiten war der römische Geschichtsschreiber Tacitus, dessen Annalen eine einzige Kette von Verbrechen der Kaiser Roms enthalten. Der Oberschurke in dieser wahrhaft beeindruckenden Menagerie ist natürlich Kaiser Nero. Unter dem Namen Peter Ustinov wurde er wiedergeboren. Alteren Kinofreunden ist er eine vertraute Gestalt. Im Buch XIV der Annalen beschreibt Tacitus, wie Nero seine liebe Mutter Agrippina vom Leben zum Tode beförderte. Der Kaiser hatte es auf eine gewisse Poppaea abgesehen, war aber dummerweise schon mit einer Octavia verheiratet, von der sich scheiden zu lassen ihm Mama Agrippina nach Mütterart verboten hatte. Sie sehen, hier hätte eine wunderbare Liebesgeschichte beginnen können, wie wir sie am Sonntagabend in dem Konkurrenzfilm »Im Tal der wilden Rosen von Cornwall« zum Tatort »Massenmord in Münster« sehen könnten, aber natürlich nicht sehen wollen. Denn im Zweifel hat der Krimi 9,3 Mio Zuschauer gegen schlappe 2,4 Mio bei den Rosen, von denen die meisten überdies in Altenheimen vor dem Fernseher bzw. vor sich selbst dahindämmern. Übrigens endet die Geschichte auch im Rosental in einem Krimi, weil Sir Simon Montesfieu-Bachelor auf Blendigstottenham Castle den jungen, aber armen Liebhaber Monty Ballerstreem enterbt, worauf der Butler Jeeves dem Whisky von Sir Simon auf Geheiß der bösen Tante Lady Julia Knotchfight-Hamham in seinen abendlichen Whisky eine Prise ... Aber ich will den Schluß hier nicht verraten. Es könnte ja sein, daß einer der Cornwallzuschauer noch wach ist.
Zurück zu Tacitus. Dieser beginnt seinen Krimi mit Ausführungen zur Blutschande zwischen Kaisermutter und Kaisersohn, wobei er angeblich nur fremde Quellen zitiert ohne sich diese zu eigen zumachen, eine Methode, die auch heute noch bei Beleidigungsdelikten praktiziert wird, die aber nicht mehr vor Strafe schützt, weil der aufgeweckte Gesetzgeber schon anno 1871 dem »Behaupten« in den §§186 f. StGB das »Verbreiten« einer üblen Nachrede gleichrangig an die Seite gestellt wird. Man darf also nicht mehr straflos sagen: »Wie ich aus gut unterrichteter Quelle weiß, hat der Kollege Müller Zwo vom Vertrieb als Kinderschänder im Zuchthaus gesessen.« Nero hätte bei Bekanntwerden der Üblen Nachrede (und sie wird immer bekannt – nichts ist öffentlicher als eine vertrauliche Mitteilung) sicher ähnliche Wünsche gehabt wie Müller Zwo, als er von dem Gerücht hörte, aber im Unterschied zu diesem benötigte er keinen Straftatbestand der Üblen Nachrede. Er hatte nämlich die Machtmittel zur Erfüllung seiner Wünsche bei der Hand. Tacitus wusste das natürlich und schrieb seinen Krimi sicherheitshalber erst einige Jahre nach Neros Tod, so daß bezüglich seiner Person aus heutiger Sicht nur eine Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, §189 StGB, in Betracht käme, ein Tatbestand, der lediglich Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe vorsieht, also, wie wir Strafrechtler sagen, ein Mickey-Mouse-Paragraph, der normalerweise mit einer Einstellung und ein paar Groschen für den Kinderschutzbund endet.
Laut Tacitus überlegte Nero nach Mamas Verdikt, ob er »Gift« oder »das Schwert oder eine andere gewaltsame Weise« anwenden sollte. Gift verwarf er; es war zu sehr verbreitet und galt als weibisches Mittel. Außerdem hatte sich Agrippina, die ihrerseits eine erfahrene Giftmörderin war, durch die regelmäßige Einnahme aller gängigen Gegengifte immunisiert. »Wie man einen Mord durch Erstechen heimlich vollziehen könne, wusste niemand zu sagen«, fuhr Tacitus in seiner Beschreibung der kaiserlichen Kabinettssitzung fort. Das kann man verstehen, denn alle Profis mit einschlägigen Kenntnissen hatte Nero schon längst sicherheitshalber umbringen lassen. Das wussten alle potentiellen Meuchelmörder in Neros Umgebung und hielten deshalb ihre Talente unter der Decke. Da Nero dieses Problem kannte, fürchtete er mit Grund eine Befehlsverweigerung des zu dingenden Mörders mangels angeblich fehlenden Fachwissens (»Faßt man einen Dolch am Griff oder an der Klinge an, Majestät?«). Man kann sich vorstellen, wie sich die Diskussion im kaiserlichen Rat im Kreise drehte. Auch der ansonsten kluge Philosoph Seneca tat so, als hätte er keine Idee, wie man Mama meucheln könne. Da hatte ein Freigelassener namens Anicetus eine brillante Idee. Er war Befehlshaber der vor der Küste liegenden Flotte und schlug vor, ein Schiff zu bauen, »von dem sich ein Teil auf hoher See künstlich lösen und die Ahnungslose versenken könnte. Nichts biete dem Zufall so viel Raum wie das Meer.« Wie sehr diese Erkenntnis zutraf, wurde im Jahre 2012 deutlich, als das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia vor der italienischen Küste einem mißglückten Grußmanöver des Kapitäns unter dem Begleitruf »Vada a bordo, cazzo1!« zum Opfer fiel. Die von Anicetus empfohlene Methode wird übrigens heute noch gerne praktiziert. Auf jeder Kreuzfahrt mit dem Traumschiff verschwinden einige Passagiere spurlos, ohne daß sich – von den Erben abgesehen, die aber erst später, nach Ablauf der gesetzlichen Fristen, aktiv werden und den Verlust von Onkel Heinz oder Tante Irmingard melden – jemand weiter darum kümmert. Man kann ja nicht täglich Zählappelle durchführen, und daß immer jemand wegen Seekrankheit am Kapitänstisch fehlt, wundert niemanden. Es sind durchweg ältere, betuchte Zeitgenossen, welche dieses Schicksal erleiden. Der Steward entfernt das Namensschild und im Heimathafen werden sie ordnungsgemäß ausklariert. Irgendwann gibt es dann ein Verfahren nach dem Verschollenheitsgesetz mit anschließender Erbscheinserteilung. Aber zurück zu Nero. Wer würde, so Anicetus, nach einem Schiffbruch »so unbillig sein, einem Verbrechen das zuzuschreiben, was Wind und Wogen verschuldet? Hinterher würde der Kaiser ja doch der Verblichenen einen Tempel, Altäre und andere Dinge weihen, um seine kindliche Liebe zur Schau zu stellen.«
Wer jemals Peter Ustinov im Film gesehen hat, kann sich den Beifall vorstellen, den diese »listige Erfindung« (so Tacitus) fand. Gesagt, getan! Nero überredete Agrippina zu einer kleinen Seefahrt. Die irritierten Götter sandten freilich »eine sternhelle und bei unbewegter See ruhige Nacht ..., als ob sie die Schandtat enthüllen wollten.« Agrippina wurde von zwei Vertrauten begleitet, Crepereius Gallus und Acerronia. Auf ein verabredetes Zeichen stürzte das mit Blei beschwerte Dach der Kajüte herab. Crepereius war auf der Stelle tot. Die beiden Damen wurden dagegen durch die hervorstehenden Lehnen eines Ruhesofas geschützt. Das Schiff brach dann jedoch nicht wie geplant auseinander. So geht es immer. Schon Moltke hat darauf hingewiesen, daß der beste Kriegsplan die erste Feindberührung nicht überlebt. Alles geriet in Verwirrung, und »die Ausführenden (wurden) von der Menge der Uneingeweihten behindert« (Tacitus). Acerronia wurde irrig für Agrippina gehalten und erschlagen. 2 Agrippina sprang ins Meer und konnte sich schwimmend an das nahe Ufer und von da in ihr nahe gelegenes Landhaus retten. Sie dachte über alles nach und kam zu dem Ergebnis, daß dies kein gewöhnlicher Schiffbruch gewesen war. So sind sie, die Frauen, sie kriegen einfach alles raus! Nero beriet sich währenddessen mit seinem Erzieher Seneca, dem bereits erwähnten berühmten Philosophen, der für später schon auf seiner Liste stand, was dieser aber noch nicht wusste. Seneca kam auf die gänzlich unphilosophische Idee, nunmehr dem Befehlshaber der Prätorianer den Mord an Agrippina zu befehlen, was dieser aber offiziell aus Gründen des Soldateneides ablehnte (zu den inoffiziellen Gründen siehe oben). Immerhin war Agrippina die Tochter des Germanicus, der schon frühzeitig aus dem Weg geräumt worden war, und der als einziger aus der Julisch-Claudischen Sippe im Volk ein gewisses Ansehen genoß. Daraufhin bekam Anicetus den Mordbefehl. Als Freigelassener hatte er keinen Vorwand sich zu weigern. Er salutierte, klappte die Hakken zusammen, sprach »Jawoll, Majestät!« und drang in das Landhaus von Mama ein, wo er Mama gemeinsam mit seinen Mordgesellen zur Strecke brachte. Agrippina streckte dem Mörder ihren Schoß hin und sprach in klassischem Latein die Worte: »In den Leib stoße (der Nero getragen hat)“3. So geschah es, und in dieser Art geht es bei Tacitus weiter. Nero hat öffentlich geweint, als ihm dieser Spruch gemeldet wurde. Lest Tacitus, Leute, den großen Geschichtsschreiber. Alle Mordmerkmale, die wir heute in §211 StGB versammelt haben (»Mordlust«, »Befriedigung des Geschlechtstriebs«, »Habgier« usw.), hatten die römischen Cäsaren bereits verwirklicht, und dazu noch viele weitere, die inzwischen in Vergessenheit geraten sind.
Der moderne Krimi etablierte sich seit dem frühen 19. Jahrhundert. In Deutschland gilt »Das Fräulein von Scuderi«, eine Novelle von E. T. A. Hoffmann (1776-1822) aus dem Jahre 1819 als erster Krimi. Ich muß Sie an dieser Stelle fragen: Wissen Sie, was eine Novelle ist? Falls ja, überschlagen Sie bitte das Folgende. Falls Nein, folgendes: (Für alle Plagiatsjäger: Ich zitiere hier aus einer Quelle, die ich hier nicht nenne, ohne Gänsefüßchen, einfach so. Falls Sie es aber wirklich wissen wollen, finden Sie die Fundstelle am Ende des Buches. 4»Die Novelle ist eine eigene Kunstform die Ihren Namen aus dem Juristischen entlehnt hat. Bekanntlich ist das justinianische Gesetzgebungswerk vom Jahre 534 in der Folgezeit durch zahlreiche Einzelgesetze fortgeführt worden, und weil diese den Codex nicht nur ergänzten, sondern wichtige Teile ganz neu regelten, nannte man sie ›leges novellae‹. Das Merkmal des ›Neuen‹ ist es denn auch, was die Novelle als Form der erzählenden Dichtung (sie entstand im späten Mittelalter) mit diesen Gesetzesnovellen gemein hat, freilich in einem analogen Sinne: Die verkürzende und verdichtende Darstellungsweise läßt den für die Novelle charakteristischen Wendepunkt als etwas Unerwartetes, kausal nicht Ableitbares, ja als etwas Unerhörtes erscheinen. Goethe hat dafür eine sehr treffende Formulierung gefunden (in den ›Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten‹ von 1794/95): ›Was gibt einer Begebenheit den Reiz? Nicht ihre Wichtigkeit, nicht der Einfluß, den diese hat, sondern die Neuheit. Nur das Neue scheint gewöhnlich wichtig, weil es ohne Zusammenhang Verwunderung erregt und unsere Einbildungskraft einen Augenblick in Bewegung setzt ...‹« (Ende des nicht zitierten Zitats).
Das Neue, die »Novität«, stürzt also wie ein Falke aus heiterem Himmel in das Behagen des arglosen Lesers, und so haben die Literaten eine Falkentheorie entwickelt, die auch E. T. A. Hoffmann in seiner Novelle angewandt hat. Das Fräulein von Scuderi (Alter 73) dichtet am Hofe König Ludwigs XIV. In Paris treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Alle Opfer sind Männer, die mit einem Schmuckgeschenk auf dem Weg zu ihrer Geliebten erstochen werden, wobei stets der Schmuck gestohlen wird. Der König bespricht die Mordserie mit Fräulein von Scuderi. Sie, geistreich wie sie ist, produziert ein Bonmot »Un amant qui craint les voleurs, n’est point digne d’amour« (»Ein Liebhaber, der Diebe fürchtet, ist der Liebe nicht würdig«). Majestät sind beruhigt und verfügen die Einstellung der Ermittlungen. Daraufhin bebedankt sich der Serienmörder, indem er dem Fräulein anonym durch einen jungen Mann eines der geraubten Schmuckstücke zukommen lässt. Das Fräulein kriegt heraus, daß der Schmuck von René Cardillac, dem angesehensten Goldschmied der Stadt, stammt. Sie ruft ihn, er gibt die Taten zu und erklärt dem 73-jährigen Fräulein seine Liebe (bitte keine Zwischenrufe an dieser Stelle – wir sind mitten in der großen Literatur), nur für sie habe er geschmuckfertigt und gemordet. Nachdem das Fräulein mehrere Monate vergeblich an einem neuen passenden Bonmot gearbeitet hat, erscheint der Jüngling erneut bei ihr und fordert sie auf, den Schmuck zu Cardillac zurückzubringen, widrigenfalls er sich in ihrem Hause umbringen werde (fragen Sie nicht nach dem Grund für das letztere – es gibt keinen). Das Fräulein folgt der Aufforderung und erlebt bei ihrer Ankunft in Cardillacs Haus, daß dessen Leichnam gerade weggebracht und der junger Mann, ein Geselle von Cardillac namens Olivier Brusson, als dessen Mörder verhaftet wird. Soweit die Story. Und nun stürzen gleich mehrere Falken aus dem Himmel auf den arglosen Leser. Olivier und Cardillacs Tochter Madelon sind ein Liebespaar. Olivier ist der Sohn der ehemaligen Pflegetochter des Fräuleins. Er sagt aus, Cardillac habe seriengemordet, weil sich nie wirklich von seinen Kunstwerken habe trennen können. Olivier habe der Polizei aus Liebe zu Madelon nichts verraten. Cardillac sei bei seinem letzten Mordanschlag von einem Offizier in Notwehr getötet worden. Um nicht in Verdacht zu geraten, sei dieser geflohen. An seiner Statt sei Olivier als mutmaßlicher Mörder verdächtig worden. Wenn der Tatort im TV so weit gediehen ist und der Blick auf die Uhr Ihnen zeigt, daß es noch fünf Minuten bis zum Schluß dauert, wissen Sie, daß jetzt ein Geständnis fällig ist. Der Offizier, der Graf von Miossens, legt es bei der Scuderi ab, diese meldet es dem König, und der sorgt für die Freilassung von Olivier, der seine Madelon heiraten darf. Sicherheitshalber sorgt der König noch dafür, daß die beiden Frankreich verlassen und nach Genf ziehen – man kann ja nie wissen ...
In den USA begründete Edgar Allan Poe mit einer Kurzgeschichte namens »The Murders in the Rue Morgue« (1841) das Genre. Darin schuf er zwei wesentliche Elemente des modernen Krimis, den genialen Detektiv und die Technik des verschlossenen Raums. Der Detektiv heißt C. Auguste Dupin und der umschlossene Raum ist eine verschlossene Wohnung im vierten Stock eines ansonsten leerstehenden Hauses in Paris. Zwei Frauen werden dort bestialisch ermordet. Der einen wird mit einem Rasiermesser die Kehle durchschnitten. Die andere wird erwürgt. Türen und Fenster sind verschlossen. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Wie ist der Täter in die Wohnung und wieder heraus gekommen? Dupin löst das Rätsel. Der Täter ist ein Orang Utan, der seinem Halter, einem Seemann, entflohen ist. Der Affe hatte beim Rasieren zugeschaut und das Rasiermesser mitgenommen. Er war an der Außenfassade des Hauses hochgeklettert. Das alles erkannte Dupin mit Hilfe seines analytischen Detektivverstandes. »Morgue« bedeutet übrigens im Englischen wie Französischen Leichenschauhaus. Poe machte seine Sache gründlich.
In England schuf der Arzt und Schriftsteller Arthur Conan Doyle die Figur des »Sherlock Holmes« (1887). Dieser lebte in London in der Baker Street 221b, und wenn Sie einmal dorthin kommen, sollten Sie sein Wohnhaus aufsuchen, wo noch viele Gegenstände an ihn erinnern, so seine Dunhill-Pfeife, seine Deerstalker-Mütze und sein Inverness-Mantel. Holmes war »Consulting detective«, also Privatdetektiv, der im Unterschied zum »police detective« für Klienten tätig wurde. Sein Mitbewohner und Gesprächspartner war der Arzt Dr. John H. Watson, der als Stichwortgeber und Gesprächspartner das Vorbild für unzählige derartige Partner in modernen Krimis abgeben sollte (etwa im Derrick: »Harry, hol schon mal den Wagen.«) Seinen ersten Krimi veröffentlichte Doyle im Alter von 27 Jahren unter dem Titel »A Study in Scarlet«. In ihr lernen Holmes und Watson sich kennen und beziehen die Wohnung in der Baker Street. Ein gewisser Tobias Gregson gibt ihnen den ersten Auftrag. In einem verlassenen Haus wurde ein Ermordeter namens Drebber gefunden. An der Wand steht mit Blut geschrieben das deutsche Wort »Rache«. Holmes soll den Fall aufklären. Er findet einen Ehering bei ihm. Um den Mörder anzulocken, gibt Holmes eine Zeitungsanzeige auf, wonach ein Ehering gefunden worden und bei Dr. Watson abzuholen sei. Tatsächlich kommt eine alte Frau, Mrs. Sawyer, um den Ring abzuholen, den ihre Tochter angeblich verloren hat. Holmes folgt ihr, indem er auf ihre Droschke springt, aber am Ziel ist die Droschke leer. Es kommt dann die Polizei, und es gibt noch einen zweiten Toten. Die Polizei verhaftet wie üblich den Falschen, ehe Holmes dem Richtigen Handschellen anlegt. Es war – nein, nicht der Gärtner – es war der Kutscher.
In der Folgezeit waren zahlreiche Autoren erfolgreiche Krimischreiber, Edgar Wallace mit dem Hexer, Agatha Christie mit Hercule Poirot und Miss Marple, Georges Simenon mit Kommissar Maigret und viele andere. Heute ist ihre Zahl unübersehbar und wächst stetig an. Während das Gedichteschreiben – von gelegentlich »mit letzter Tinte« verfassten Ausnahmen abgesehen – stagniert, rollt eine wahre Krimiwelle über uns hinweg. Sie hat noch längst nicht ihren Scheitelpunkt erreicht. Die Wellenforscher sprechen von einer drohenden Monsterwelle, die man auch als Krimi-Kaventsmann 5 bezeichnen kann. Erbarmen ist hier so wenig zu erwarten wie auf dem Atlantik.
Der Krimi, ob wahr oder erfunden, erfüllt also eine wichtige literarische Funktion. Er zeigt uns, wozu wir fähig wären, wenn wir nicht so gehemmt wären. »Ich habe noch niemals von einem Verbrechen gehört, von dem ich mir nicht hätte vorstellen können, dass auch ich es hätte begehen können«, soll Goethe einmal zu Eckermann gesagt haben. Ich bin nicht sicher, daß er das wirklich gesagt hat, aber Goethe ist jemand, dem man das zutraut, und das ist praktisch dasselbe. Seine Aussage trifft sicher auch auf Sie und mich zu. Ich könnte Ihnen etliche Personen nennen, die ich sehr gerne mit einem Einschussloch in der Stirn sehen würde. Ein gut geplanter Mord ist ein »Genuß«, wie eine bekannte Brauerei zum Schluß eines jeden Tatorts im TV der wohlig erschauernden Community so treffend mitteilt. Die Produktion von Krimis in Form von Büchern, Fernsehserien und Filmen boomt daher, und sie wird immer mehr boomen bzw. Kaventsmänner produzieren.
Bei dieser Flut gibt es einen wichtigen Unterschied zur Liebesgeschichte und zu allen anderen inzwischen entstandenen Literaturgattungen (Roman, Novelle, Drama, Gedicht usw.). Anders als bei diesen können Sie das Schreiben von Krimis erlernen. Bei einem Gedicht ist das ganz und gar unmöglich. Stellen Sie sich vor, Sie säßen an einem Sommerabend allein vor einer Holzhütte auf einem von Wäldern umgebenen Berg. Sie hätten einen Korb mit mehreren geleerten Flaschen Würzburger Stein neben sich stehen, wären also betrunken, und in den Tälern würde sich der Nebel ebenso ausbreiteten wie in ihnen die Rührung. Ist der neblige Abend nicht ein Sinnbild des Vergehens im Leben? Sie wollten das in einem Gedicht beschreiben? Gelänge Ihnen das? Nein, never, na bitte! Und jetzt geben Sie bei Google die Zeile »Über allen Gipfeln ist Ruh« ein und lesen Sie, wie Goethe diese Aufgabe gelöst hat. Oder stellen Sie sich vor, Sie hätten zu Fuß den Brocken erklommen und stünden nach stundenlanger Keucherei nun oben und sähen vor lauter Nebel überhaupt nichts. Könnten Sie das in Gedichtform ausdrücken? Garantiert nicht! Heinrich Heine konnte es dagegen und schrieb in das Gästebuch der Gipfelwirtschaft:
»Viele Steine
Müde Beine
Aussicht keine
Heinrich Heine.«
So etwas kann man nicht lernen, trotz aller gegenteiligen Behauptungen der Veranstalter von kreativen Schreibkursen.
Bestensfalls kommt so etwas heraus wie ein Beispiel, das ich einmal in einer Illustrierten gelesen habe. Es ging um einen Sturm und um den Seemann Uwe, der gerade irgendwelche Schiffbrüchige rettete. Daraus sind mir zwei Zeilen im Gedächtnis geblieben:
»S'ist Uwe, ruft es durch die Gischt
Ich gucke, doch ich sehe nischt!«
Die verzweifelten Bemühungen, reimen zu wollen, ohne reimen zu können, erleben wir ständig auf Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, karnevalistischen Veranstaltungen – es ist furchtbar. Auch Google hilft da nicht weiter. Ich habe einmal dort das Stichwort »Hochzeitsgedicht« eingegeben, und das erste von 1.983.678 Gedichten begann wie folgt:
»Zur Hochzeit sind wir heut geladen
das finden wir ganz wunderbar.
Dem jungen Paar möchten wir raten
pflegt Eure Liebe Jahrfür Jahr.«
Grrrrrrrrrr!
Im 19. Jahrhundert dichtete Friederike Kempner, der schlesische Schwan bzw. die schlesische Nachtigall, so schauerlich, daß der Schriftsteller Alfred Kempner, der nicht mit ihr verwandt war, seinen Geburtsnamen in Alfred Kerr änderte, weil sie »die schlechtesten je auf diesem Planeten bekanntgewordenen Verse« geschrieben habe. So dichtete sie über eine Stadt in Frankreich:
»Ihr wißt wohl, wen ich meine
Die Stadt liegt an der Seine.«
Da half auch nicht, daß die Frau oftmals recht hatte, so in dem Vierzeiler:
»Besessen ist die Welt
Von Eigennutz und Geld
Und alles zum
Verzweifeln dumm!«
Friederike Kempner fand viele Nachahmer, so daß man geradezu von einer Pseudo-Kempneriana spricht. So dichtete ein Anonymus unter ihrem Namen zu Johannes Kepler:
»Ein ganzes Blatt der Weltgeschichte
Du hast es vollgemacht!«
Also, Freunde von den Schreibseminaren. Das Reimen kann man nicht lernen. Beim Krimi ist das anders. Ob grüne Witwe im Münchener Nobelvorort Grünwald, ob emeritierter Juraprofessor, ob Fernsehmoderator im Ruhestand, ob Senioranwalt, den die Juniopartner hinausgemobbt haben, ob Kabarettist, den die Realität überholt hat – was immer auch – ein, Krimi schreibt sich fast von selbst. Im Grunde ist das vorliegende Buch daher überflüssig. Aber zwischen »schreibt sich von selbst« steht das Wörtchen »fast«. Hier scheiden sich die Böcke von den Schafen und die Spreu vom Weizen. Die Konkurrenz ist groß. Mein Buch wird Ihnen helfen, zu den Böcken respektive zum Weizen zu gehören.
Aber auch für die Krimi-Leser und -Zuschauer habe ich das vorliegende Buch geschrieben. Was bedeutet es, wenn der Tatortkommissar zu dem Verdächtigen drohend sagt: »Ich kann Sie auch auf das Präsidium vorladen.« Oder wenn er die Tür zu einer fremden Wohnung eintritt und seinem Gehilfen zuruft: »Gefahr im Verzug!« Oder wenn er dem verstockten Verdächtigen eine klebt und erklärt: »Wir ermitteln in einem Mordfall!« Warum kommen die Kommissare immer zu zweit? Und etwas allgemeiner gefragt: Was ist das eigentlich, ein Verbrechen? Wann ist der Krimi spannend, wann nicht? Woran erkennen Sie im Buchladen, ob ein dort ausgelegter Krimi den Kauf lohnt? Warum brechen so viele Verdächtige am Schluß zusammen und legen ein Geständnis ab, obwohl ihnen nichts nachzuweisen ist. Was ist ein Indiz, was ein Beweis? Fragen über Fragen. Ich will sie alle und mehr beantworten.
Vielleicht fragen Sie an dieser Stelle, woher ich meine Kenntnisse und Erfahrungen habe. Nun, da gäbe es viel mitzuteilen. Ich beschränke mich auf das Wesentliche.
Zunächst verweise ich auf meinen Namen »Haft«. Er ist etwas edler als »Zuchthaus« oder »Strafkolonie«, aber nur etwas. Ein Vorfahre von mir nahm diesen Namen Mitte des 19. Jahrhunderts an, ohne daß ich die näheren Umstände erforscht habe. Man muß nicht alles wissen. Der Name reizt irgendwie. Ein bekannter Fernsehmoderator hatte einmal eine witzige Sendung, in der die Personen mit seltenen Namen, die zu ihrem Beruf passten, in einen Schrank gestellt wurden. Die Kandidaten sollten entscheiden, ob es diese Person gebe oder nicht. Wurde die Frage richtig bejaht, trat der Betreffende aus dem Schrank, das Publikum klatschte Beifall, für eine halbe Minute war er berühmt, und der Kandidat, der das richtig erraten hatte, durfte eine Woche nach Mallorca zum Ballermann fahren. Wenn also ein Bäckermeister »Semmel« hieß oder ein Polizist »Bulle«, war er ein natürliches Zielobjekt dieses Moderators. Auch mich rief er an und fand die Vorstellung unglaublich witzig, ein Strafrechtler trete aus dem Schrank und bekenne sich zu seinem Namen »Haft«. Ich hielt es freilich mit Goethe und lehnte ab. Goethe war, wie Sie alle wissen, während seiner Studienzeit in Straßburg mit einem Vorgänger unseres Moderators, einem gewissen Herder, befreundet, dem im Unterschied zu stud. jur. Goethe bzw. einem modernen Kandidaten die Bildung aus allen Poren platzte und der einfach alles wusste. Wie Goethe in »Dichtung und Wahrheit« (2. Teil, 10. Buch) schreibt, wollte Herder einmal von ihm ein Buch mit Ciceros Briefen ausleihen, das bei Goethen auf dessen Bretterregal ungelesen stand, und schickte ihm dazu ein Billet, das wie folgt lautete:
» Wenn des Brutus Briefe dir sind in Ciceros Briefen
Dir, den die Tröster der Schulen von wohlgehobelten Brettern
Prachtgerüstete, trösten, doch mehr von außen als innen
Der von Göttern du stammst, von Goten oder vom Kote
Goethe, sende mir sie.«
Goethe fand das überhaupt nicht lustig. Noch im Alter knödelte er, das sei »nicht fein [gewesen], daß er [= Herder] sich mit seinem [= Goethes] Namen diesen Spaß erlaubte, denn der Name eines Menschen ist nicht etwa ein Mantel, der bloß um ihn her hängt und an dem man allenfalls noch zupfen und zerren kann, sondern ein vollkommen passendes Kleid, ja wie die Haut selbst ihm über und über angewachsen, an der man nicht schaben oder schinden darf, ohne ihn selbst zu verletzen« Ich kannte die Stelle natürlich und verzichtete im Einklang mit Goethe darauf, ein Fernsehpromi zu werden.
Der Name »Haft« ist übrigens noch unter einem anderen Aspekt problematisch. Wenn ich einen Anruf bekomme und gerade am anderen Ende meines Büros bin und über Papierkörbe und Stühle stolpernd zum Telefon eile, geht mir regelmäßig die Luft aus, so daß ich nur etwas japsen kann, was wie »Affft« klingt. Hieße ich Nick Knatterton, hätte ich das Problem nicht. Ich habe mir deshalb angewöhnt, eine Erläuterung hinzuzufügen, also etwa zu sagen »Haft – wie das Gefängnis« oder »Haft – wie das Einsperren.« Daraufhin erhielt ich einmal einen Brief mit einer Urkunde, beide ausgestellt auf »Fritjof Knast«. Absender war die Notarkammer Bayern und unter diesem unschönen Namen habe ich vor Jahren einmal eine Karriere als Notarassessor begonnen, die ich natürlich bald abbrach. Notar Knast in Landsberg am Lech oder in Straubing – das wäre wirklich nicht gegangen.
Sodann bin ich, wie eben schon angedeutet, Jurist. Als solcher ist man bekanntlich für alles kompetent, vom Urknall bis zum Perpetuum Mobile. Ein Vorsitzender Richter hat einmal in einem Arztprozess gegen einen Krebsarzt bei der Urteilsverkündung gesagt: »Das Gericht hat sich aufgrund der Sachverständigengutachten vollständige Kenntnisse über die Krankheit Krebs und deren Behandlungsmethoden verschafft.« (Ich zitiere aus dem Gedächtnis, aber im wesentlichen lüge nicht.) Es ist kein einfaches Los, Jurist zu sein, aber manchmal nützt es. Es gab einmal in Bayern einen Fall von Kindsmißhandlung, der die Öffentlichkeit erregte und zu den üblichen Reaktionen führte (Forderung nach Verschärfung der Gesetze, mehr Überwachungskameras, Aufklärung, Kastration aller Verdächtigen, mehr Geld, wofür auch immer). Der Bayerische Rundfunk rief mich an und bat mich um ein Interview. Ich sagte nicht schnell genug »Nein«, weshalb ich die Forderung nicht mehr abwehren konnte, als ich die Uhrzeit erfuhr (»Unser fröhlicher Morgenwecker um sechs Uhr in der Früh«). Mein damals noch kleiner jüngerer Sohn bekam Wind von der Sache und sagte zu mir: »Ich stelle mir den Wecker und werde neben Dir sein. Solltest Du gefragt werden, ob Du jemals ein Kind geschlagen hast und Du antwortest mit ›Nein‹, greife ich mir den Telefonhörer.« Der Morgen kam und graute. Schon um fünf Uhr war ich wach und gurgelte. Um sechs Uhr bezog mein Sohn neben mir und dem Telefon Stellung. Wir warteten. Kurz vor Schluß des fröhlichen Morgenweckers um acht Uhr kam der Anruf. Was ich denn von Kindsmißhandlung hielte, wurde ich als Experte gefragt. »Nichts« sagte ich. Was denn darauf stünde? Ich war auf diese Frage vorbereitet und hatte das Strafgesetzbuch vor mir liegen, aufgeschlagen bei den Körperverletzungsdelikten. Ich las die Antwort vor. Die Leute denken immer, so etwas wüssten wir Strafrechtler auswendig. Und dann kam die Frage aller Fragen. Ob mir denn selbst schon einmal die Hand ausgerutscht sei. Mein Sohn sah mich an. Ich sah ihn an. Im Hintergrund spielte eine Mundharmonika das Lied vom Tod. Jedenfalls hörte ich es. Clint Eastwood ritt in die Stadt mit den Worten: »Alles Weitere wird sich finden.« Mein Sohn beugte sich vor. Seine Hand schwebte Millimeter über dem Colt. Da fiel mir ein, daß wir Juristen ja ähnlich wie die Mediziner eine Sprache pflegen, die das gemeine Volk in Tombstone nicht versteht. Das war meine Rettung. »Gelegentliche leichte taktile Einwirkungen«, so hub ich an, »die zudem sozialadäquat sind, möchte ich nicht a priori ausschließen ...« Und so ging es weiter. Das erstaunte Bayern hörte zu. Mein Sohn war verwirrt. Er hat dann später Fortswirtschaft studiert, und ich denke, er weiß bis heute nicht, was eine »leichte taktile Einwirkung« ist. Ralf, solltest Du dieses Buch während der einsamen Stunden auf dem Hochsitz lesen – es ist eine Watschen.
Als Professor gehöre ferner ich zur Fraktion der berufsmäßigen Rechthaber, was in einer Welt voller Ignoranten kein leichtes Los ist. Ich teile dieses Los mit den Lehrern und kann Ihnen versichern, es ist hart. Nicht grundlos erreicht kaum ein Lehrer das Pensionsalter. Bei uns ist das zwar anders; wir Professoren müssen keine Elternsprechstunden abhalten und können uns leicht gegen Klagen der Studenten wehren. Einen Anwalt, der mich einmal wegen einer mit »Ungenügend« bewerteten Strafrechtshausarbeit verklagen wollte, belehrte ich, daß die Universität Tübingen seit dem 15. Jahrhundert eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts mit eigener Gerichtsbarkeit sei, weshalb er mich vor dem staatlichen Gericht nicht verklagen könne; wir wären insoweit autonom, wie man an der Existenz unseres Karzers sehen könne (den es tatsächlich noch gibt.) Er bedankte sich für die Aufklärung und ich habe nie wieder von ihm gehört. Wir haben also keinen Lehrerstreß und werden deshalb steinalt. Aber ein Gutteil unserer Zeit vertrödeln wir damit, den Kollegen nachzuweisen, daß diese im Unterschied zu uns Unrecht haben. Ein Kollege schrieb mir einmal: »Ihre Ausführungen zum Thema X sind falsch, weil Sie nicht verstanden haben, was ich alles nicht verstanden habe.« Ich arbeite heute noch an einem Antwortschreiben.
Last but not least habe ich vor Jahren mein Jurastudium mit dem Schreiben von Krimis verdient. Begonnen habe ich mit Leihbüchern (wie sie heute ausgestorben sind – »Blaulicht in Manhattan« (ich weiß bis heute nicht, ob es nicht »Rotlicht« heißen müsste) und Heftchen-Romanen, etwa in den Serien »Kommissar X« und »Jerry Cotton« (siehe auch das Kapitel über den Heftchen-Krimi). Daß diese Tätigkeit bereits durch bloße Nachahmung erlernbar ist, stellte ich in dem Studentenheim fest, in dem ich damals wohnte. Es gab skrupellose Mitbewohner, wahre Schurken, die sich während meiner Abwesenheit an meine Triumph Schreibmaschine setzten (Schreibcomputer gab es damals noch nicht) und meine Geschichten fortschrieben, ohne daß ich es merkte. Auf diese Weise kam mir wertvolles Personal abhanden. Höchst verdächtige Personen, mit denen ich noch viel vorhatte, wurden in Feuergefechten in der New Yorker Unterwelt reihenweise niedergemäht und fielen damit als zu überführende Verbrecher aus. Ich merkte es nicht, der Verlag auch nicht, und als ich einmal einen längst verstorbenen Bösewicht am Schluß unter seiner Schuld im Geständnis zusammenbrechen ließ, löste das überraschte Leserbriefe aus. Den meisten Lesern fiel aber gottlob nichts auf. Der typische Heftchen-Leser jener Zeit war der Taxifahrer, den immer an der spannendsten Stelle ein Fahrgast störte, der zu einer Straße gefahren werden wollte, die er nicht kannte. Navis waren damals unbekannt. An ihrer Statt verwendete man einen Faltplan, bei dem sich die gesuchte Straße immer auf dem Knick befand. Das ist übrigens heute noch so. Wer einmal als Autofahrer am Knick dabei ist, etwa die Löwithstrasse in München-Schwabing zu finden, der weiß hinterher nicht mehr, daß der Gangster A1 Costello schon seit fünfzig Seiten tot ist.
Übrigens habe ich kürzlich an einem Bahnhofskiosk gesehen, daß die Jerry-Cotton-Hefte immer noch verkauft werden und unentwegt neue produziert werden. Sogar ein neuer Jerry Cotton Film erschien 2010. 6 Ich schrieb daraufhin an den Verlag, wies darauf hin, daß Jerry nach meinen Berechnungen inzwischen neunzig Jahre plus X alt sein müßte, und bot ihm an, einen Krimi zu schreiben, der auf der Pflegestation eines Seniorenheims in Floriada spielt, wo Jerry im Rollstuhl dämmert und seine gelegentlichen luziden Phasen nutzt, um einem Massenmörder das Handwerk zu legen, der, ebenfalls im Rollstuhl sitzend, seine luziden Phasen nutzt, um die Mitbewohner des Heimes abzumurksen. Die Antwort des Verlages war förmlich und abweisend. Die Jungs nehmen Jerry Cotton richtig ernst. Er bringt anscheinend noch immer Geld. So habe ich diesen Krimi nicht mit letzter Tinte geschrieben.
Bei der Aufzählung meiner besonderen Qualitäten für den Krimi will ich abschließend nicht verschweigen, daß ich im westlichen Kulturkreis der einzige akademisch gebildete Mensch bin, der jemals Menschenfleisch gefressen – pardon, verzehrt – hat und weiß, wie es schmeckt. Meine Frau mag diese Geschichte nicht, aber sie ist wahr, und ich erzähle sie immer dann gerne, wenn wir auswärts zum Essen eingeladen sind. Als Student trampte ich vor vielen Jahren einmal durch Griechenland. In einem Dorfladen irgendwo auf dem Peloponnes erwarb ich eine vergammelte Blechdose, die der Form nach Ölsardinen enthielt und der vergilbten Aufschrift nach aus der Zeit stammte, als Griechenland noch unter türkischer Herrschaft schmachtete. Ich verzehrte den Inhalt, und als ich die dritte Ölsardine abnagte, fiel mir auf, daß sie statt Gräten einen Knochen enthielt, an dessen Ende ein menschlicher Fingernagel hing. Ich will das hier nicht weiter ausführen, nur soviel: Menschenfleisch schmeckt nach Fisch!
Also, um es kurz zu machen – Sie können das Krimischreiben lernen. Dieses Buch wird Ihnen dabei helfen. Fangen Sie einfach an und halten Sie sich nach der Lektüre dieses Buches (keinesfalls vorher!) an die alte russische Weisheit: »Probirski geht über Studirski«.