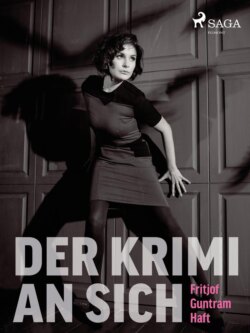Читать книгу Der Krimi an sich - Jerry Cotton - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. Spannung
ОглавлениеEin Krimi muß spannend sein. Aber was heißt das? Die Begriffe »Spannung« und »spannend« werden in unserer Zeit geradezu inflationär verwendet. Wenn in einem Unternehmen ein neues »Projekt« gestartet wird, das die Verlagerung der Produktion des neuen Bullshit Pepulators in das Niedriglohnland Lummernesien vorsieht, sind alle beteiligten BWLer und Consultants geradezu verpflichtet, dies als eine »spannende« Aufgabe zu bezeichnen, sofern sie sicht nicht im Aktenkeller in dem garantiert spannungsfreien Archiv der Firma wiederfinden wollen. Dabei frage ich: Ist es wirklich »spannend«, in ein Land zu ziehen, wo Kinder als billige Arbeitskräfte mißbraucht werden und korrupte Verwaltungen einen Unternehmer vor Steuern und Umweltschutzauflagen bewahren?
Der Begriff »Spannung« stammt aus Zeiten, in denen man Geschosse mit Geräten abfeuerte, die mit Muskelkraft bedient wurden. Schon in der Antike gab es Kanonen, die manuell gespannt wurden. Sie feuerten Steinkugeln ab, mit denen man massive Steinmauern zum Einsturz brachte. Im Mittelalter gab es Langbogen, die Pfeile bis zu einer Entfernung von 200 Metern mit einer solchen Wucht abschossen, daß eiserne Rüstungen von etwa 2,5 cm Dicke durchschlagen wurden. Zu sehen, ob das klappte, vor allem dann, wenn man als Mongole die Pfeile im vollen Galopp vom Pferedrücken aus verschoß und gepanzerte deutsche Ritter als Ziele dienten – das war fraglos »spannend«.
Ein wenig abstrakter ausgedrückt bedeutet »Spannung«, daß ein Übel im Anmarsch ist und man wissen will, ob es eintrifft oder nicht. Das englische Wort dafür lautet »Suspense« (= »Gespanntheit«), welcher Begriff sich aus dem lateinischen »suspendere« (= aufhängen) ableitet und die Unsicherheit hinsichtlich eines künftigen Ereignisses bezeichnet. Trifft dann nicht das erwartete Ereignis, sondern etwas anderes ein, löst sich die Spannung auf. Alfred Hitchcock, der »Master of Suspense«, bezeichnete das als »Surprise Mystery«. Wenn Detektiv Knatterbumm unerlaubterweise, aber der Dramaturgie gehorchend (»Gefahr im Verzug«) in das Apartment des Serienmörders Hackmann eingedrungen ist und dort das Album mit den Fotos der von Haarmann gemeuchelten Opfer findet, so ist das mäßig interessant, aber noch nicht spannend. Die Sache ändert sich, wenn Mörder Hackmann unerwartet vorzeitig zurückkehrt und unten das Haus betritt. Assistent Harry, der für diesen Fall als Aufpasser im Auto vor dem Haus postiert wurde, und der Knatterbumm gegebenenfalls warnen soll, stellt fest, daß sein Handy im Auto keinen Netzempfang hat. Er springt aus dem Auto und fummelt verzweifelt an seinem Handy herum. Inzwischen ist Hackmann mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren und nähert sich seiner Wohnungstür. Kantterbumm, immer noch ahnungslos, betrachtet derweil kopfschüttelnd die Bildergalerie der Opfer des Massenmörders. Die Spannung steigt. Hackmann steht jetzt vor seiner Wohnungstür, sucht den Schlüssel in der Manteltasche – findet ihn nicht. Die Spannung steigt und steigt. Eine kleine Hoffnung keimt. Hat der Mörder den Schlüssel vielleicht vergessen? Nein, die Hoffnung trügt. Er findet den Schlüssel in der Hosentasche, steckt ihn ins Schloß. Es ist dies der Augenblick, in dem ein messbarer Prozentsatz der Zuschauer die Spannung nicht mehr erträgt und zum Sommerfest der Volksmusik umzappt, wo Marianne und Michael sich gerade gegenseitig vorsingen, wie lieb sie sich haben. Die Tapferen umklammern ihre Fernbedienung mit schweißnassen Händen und sehen, wie Knatterbumm aufmerkt, das Album zuklappt und blitzschnell zur Wohnungstür huscht, wo er sich in den Winkel stellt, den die aufgehende Tür mit der Wand bildet. Hier ist er nicht sofort zu sehen. Mörder Hackmann tritt ein, bleibt stehen. Als erfahrener Verbrecher spürt er, daß etwas nicht stimmt. Er zieht seine Pistole aus der Tasche, lädt sie durch (»spannt« sie), de Spannung steigt. Der Mörder geht einen Schritt vorwärts, die Spannung steigt weiter und ist kaum noch zu ertragen. Die Zuschauer winden sich und ringen ihre feuchten Hände. Hackmann vermutet das Unheil in seinem Wohnzimmer und wendet sich dorthin. Das ist Knatterbumms Chance. Lautlos drückt er sich an der Tür hinter Hackmanns Rücken entlang, erreicht unbemerkt den offenen Ausgang, nur ein Schritt fehlt noch und er ist in Sicherheit. Da klingelt sein Handy. Harry, der dusslige Assistent hat nämlich genau in dieser Sekunde ein Netz bekommen. Hackmann fährt herum ... An dieser Stelle pflegte man früher, als es noch die Fortsetzungsromane gab, zu schreiben: »Fortsetzung folgt.«
Viele Krimiautoren meinen, es sei spannend, dem Leser im geschlossenen Raum eine Gruppe von Verdächtigen vorzuführen und die schon erwähnte »Who-dunit-Veranstaltung« aufzuführen. Da ist Onkel Eduard, der gesetzliche Ersatzerbe dritter Ordnung, der tief in Schulden steckt. Da ist Sofia, die Rachepläne schmiedet, seit der Ermordete sie vor dreißig Jahren verschmäht und statt ihrer die blonde Veronika geheiratet hat, die wiederum eine »Affäre« (ja, das Wort gibt es noch) mit Heinrich hat, der seinerseits, was Veronika nicht weiß, mit Sharon liiert ist, einer Ziehtochter des Mordopfers, die mit Hilfe des hochverdächtigen Agenten Krause bei der Hannoverschen Allgemeinen eine Lebensversicherung auf das Leben respektive den Tod des Opfers über eine Million Euro abgeschlossen hat, die aber nicht eingelöst wurde, weil die Sekretärin Tipper die Prämie veruntreut hat, was wiederum auf enttäuschte Liebe zu Onkel Eduard ... Ich breche ab. Nur einer ist nicht mehr dabei, weniger, weil er verbraucht ist, sondern mehr, weil er als Beruf heute nicht mehr existiert, nämlich der Gärtner. Den Garten pflegt heute die Casa Bianca Immobilien Service GmbH & CoKG unter Einsatz von ungelernter Billiglohnkräften aus Billiglohnländern, und dieser Servicebetrieb ist nicht nur steuersparend, sondern als Mörder gänzlich ungeeignet. Wie soll man jemanden verdächtigen, der nur Kiezdeutsch kann und einem sagt: »Ey, rockst du, lan, Alter Ischwör, war so.«
Das Whodunit-Treiben ist nicht spannend. Es ist das, was man in der Branche »Mystery« nennt. So etwas war vielleicht früher spannend, als die Menschen noch Patiencen legten und sich in englischen Adelshäusern zum Dinner umzogen, ehe Inspektor Hercule Dreyfuß sie alle im Salon versammelte, ihnen nacheinander ihr Sündenregister erzählte, um zum Schluß der bislang völlig unverdächtigen Harriett, Studentin der Kunstgeschichte, die Tat auf den Kopf zuzusagen, weil sie infolge ihres Studiums als einzige wusste, wie man die Schrauben der Ritterrüstung lockern konnte, die von derem seit Jahrhunderten innegehabtenStandort im dritten Stock durch den offenen Treppenschacht just zu dem Zeitpunkt nach unten gestürzt war, als das Mordopfer dort seine Sammlung von Dunhill Pfeifen sortierte, was weder ihm noch den Pfeifen bekam. Auch das Tatmotiv kann der Inspektor liefern. Harriet hat nämlich über Jahre hinweg die zahlreichen Gemälde in der Schloßgalerie von Tizian, Rubens, Constable und anderen Kunstmalern gegen Fälschungen ausgetauscht, die John Cruft, ihr Kommilitone an der Kunstakademie und zugleich ihr skrupelloser Liebhaber, angefertigt hatte, um die Originale auf dem internationalen grauen Kunstmarkt an Scheichs und andere Geldbonzen zu verkaufen, denen es nichts ausmachte, geklaute Kunstwerke zu besitzen. Früher war so etwas vielleicht spannend. Heute ist es das nicht mehr.
Der berühmteste Spannungskrimi ist mir noch genau im Gedächtnis geblieben, weil ich ihn als Kind gelesen habe und noch lange über den angeblichen Tod des Autors an der spannendsten Stelle empört war. Ich meine »Die denkwürdigen Erlebnisse des Arthur Gordon Pym« von Edgar Allan Poe (1809-1849), dem Erfinder des amerikanischen Krimis. Der Ich-Erzähler Pym ist ein Seefahrer, der sich als blinder Passagier an Bord eines Walfängers schleicht, auf welchem eine blutige Meuterei stattfindet, die ihn beinah das Leben kostet. Doch gelingt ihm in der Verkleidung des Gespenstes der halbverwesten Leiche eines toten Meuterers mit einigen Kameraden die Rückeroberung des Schiffes, das alsbald in einen Sturm gerät und in ein kieloben treibendes Wrack verwandelt wird. Ein fliegender Holländer, ein holländisches Schiff voller Leichen, treibt vorbei. Hunger und Durst schwächten Pym und seine Kameraden, so daß sie auslosen, wer sterben und den anderen als Nahrung dienen soll. Es kommt zum Kannibalismus. In letzter Minute rettet ein englisches Segelschiff Pym. Dessem Kapitän segelt auf der Suche nach Reichtum nach Süden, weiter als je ein Mensch das geschafft hat, durchquert große Eisfelder und kommt schließlich in eine warme (!) Strömung, die in Richtung Südpol führt. (Niemand hatte mir damals gesagt, daß die Antarktis ein Kontinent ist. Meine einzige Lesehilfe war eine Taschenlampe, da ich nachts unter der Bettdecke anknipste.) Unterwegs treffen sie auf eine Inselgruppe, in der schwarze Wilde beim Anblick von etwas Weißem in panischen Schrecken geraten und den Ruf »tekeli-li« ausstoßen, was ungefähr soviel wie »Mahlzeit« bedeutet. Die Eingeborenen tun ungeachtet ihrer Panik freundlich, locken die Abenteurer dann aber in einen Hohlweg, in dem es zum Kampf kommt. Das Schiff explodiert (ob im Hohlweg,weiß ich nicht mehr). Nur Pym und sein Freund Peters können sich retten und zusammen mit einem Eingeborenen, den sie gefangengenommen haben, in einem Kanu fliehen. Die Strömung treibt das Kanu weiter nach Süden, das Meer erhitzt sich mehr und mehr (am Südpol!), weiße Vögel fliegen umher, vom Himmel regnet weiße Asche, das Meer fängt an zu kochen, das Wasser leuchtet, Strudel bilden sich. Der Eingeborene stirbt vor Grauen. Eine lautlose Stromschnelle wird sichtbar, Bildgestalten erscheinen, »ungeheure und fahlweiße Vögel« fliegen umher. Die Vögel stürzen in einen Katarakt und sehen eine verhüllte, gewaltige, übermenschliche Gestalt, kein »Menschengezeugter«, mit einer Haut von »makellosem Weiß des Schnees« ... An dieser Stelle bricht die Erzählung ab und ein gewisser Mr. Edgar Allan Poe teilt dem Leser mit, sein Freund Mr. Gordon Pym, der Autor des Buches, sei an dieser Buchstelle plötzlich verstorben. Ich denke, Sie können meine Empörung verstehen. Sie galt damals dem Mr. Pym, der so unzart war, an der spannendsten Stelle seines Berichtes zu versterben. Heute weiß ich, daß Mr. Poe selbst es war, der diesen Bericht geschrieben hatte, und ich bin doppelt empört über diesen hundsgemeinen Trick, dem ich als argloses Kind zum Opfer gefallen bin. Erst als ich aus Hans-Dieter Gelferts Biographie »Poe -Am Rande des Malstroms« (erschienen 2008 bei C. H. Beck) erfuhr, daß das Buch über Pym seinerzeit auf dem Buchmarkt ein Flop war, habe ich mich ein wenig beruhigt. Es gibt doch noch eine Gerechtigkeit auf Erden.