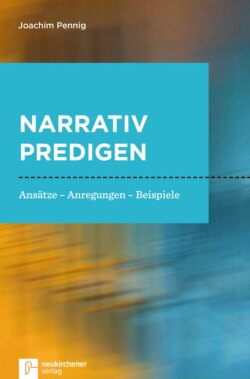Читать книгу Narrativ predigen - Joachim Pennig - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеNo-says und Do-says
Spätestens seit Paul Watzlawick und der psychologischen Kommunikationsforschung wissen wir: Sprache verrät das Denken und formt es zugleich.1 Deshalb ist Rede immer auch Inhalt, und Sprache darf nicht beliebig verwendet werden.
Ich erkläre es an meinem Lieblingsbeispiel: „Umwelt“. Auch wenn es sich noch so sehr eingebürgert hat als Begriff für das, was die Welt bezeichnet, in der wir Menschen leben, prägt es doch eine bestimmte Vorstellung bei jedem Gebrauch heimlich mit. Nämlich die Vorstellung, dass die „Welt“ „um“ mich her-um- sei.
Damit erkläre ich mich zum Mittelpunkt der Welt, und die Welt um mich herum zur nachrangigen Funktion des Menschen. Eine verheerende kleine Ursache, die letztlich zur individualistischen Egozentrik der Jahre – grob – ab 2000 führte, die in politischen Verhältnissen wie der Ära Trump oder der Diktatur der neokapitalistischen Wirtschaft gipfeln. Hätten wir uns rechtzeitig angewöhnt, „Mitwelt“ zu sagen, hätte ein anderes Bewusstsein wachsen können, das den Menschen als Teil der Schöpfung und „Welt“ zu sehen begonnen hätte, „mit“ der zu leben allein eine Zukunft in Gerechtigkeit, Frieden und Glück bescheren kann. Ich bin überzeugt, dass der Begriff „Mitwelt“ auch ein anderes Bewusstsein für die Phänomene der Klimaveränderungen hervorgebracht hätte. Doch auch die Evangelische Kirche, „meine“ Kirche – wiewohl immer wieder daran erinnert –, hatte nicht die Kraft und den Mut, ich wage nicht zu sagen: auch nicht die Einsicht, diese elementaren Zusammenhänge ernst zu nehmen.2 Damit hätte Kirche in einem wichtigen Feld des zeitgemäßen Themenspektrums klares Profil gewinnen können. Mich macht das einfach sehr traurig und spornt mich an, noch sorgfältiger hinzuschauen, was ich in einer Predigt verwende und was eben nicht.
Speziell für die Predigt ist also auf den Zusammenhang von Sprache und heimlichen dahinterstehenden Denkmustern umso mehr zu achten, als eine Predigt von vielen Menschen ernst und für wahr genommen wird und sie ihr Leben danach ausrichten, was ja auch im Sinne der Aktualisierung des Evangeliums von der Predigt intendiert ist. Dies betrifft auch scheinbar formale Dinge, weil auch sie Inhalte transportieren, Werte mitschleifen, Haltungen verkünden.
Ich schaue deshalb alle Predigten auf sog. „No-says“ durch, also auf kritische Formulierungen, die ich herausstreiche, wenn ich sie entdecke. Ich frage mich dann, was ich damit wirklich intendieren oder sagen will, und schreibe das anstelle der „No-says“ hin. Das Wort „Umwelt“ beispielsweise würde sich in keiner meiner Predigten finden! Das hoffe ich doch, trotz aller menschlichen Unzulänglichkeit.
No-says sind also kritische sprachliche Formulierungen, die Hörer zum Aussteigen oder Abschalten bringen oder deren transportierter Wert dem Evangelium, der Theologie, dem Interesse der Predigt widersprechen und den/die HörerIn beeinflussen, sodass sie der Predigt nicht mehr oder nur erschwert folgen können. Sie sind deshalb im Vorfeld gut zu überlegen oder eben notfalls zu streichen. Hier ein paar immer wiederkehrende Beispiele (machen Sie sich Ihre eigene Liste!):
muss: widerspricht dem zentralen Grundgedanken der Freiheit vor Gott und hat deshalb in einer Predigt nichts zu suchen. „Muss“ gibt es im Evangelischen nicht! Eine Haltung, die dem von Gott intendierten Leben in Freiheit, Glück und Gerechtigkeit folgt, braucht kein MUSS, sondern tut, was Gott will, was dem Leben dient, aus Einsicht und freien Stücken, wo immer es dem Individuum möglich erscheint.Ich streiche deshalb jedes „muss“ konsequent raus, das mir beim Schreiben vielleicht reinrutscht. Wo mir das passiert, denke ich besonders genau nach, was ich – vielleicht auch heimlich – sagen will und ob es theologisch so stimmt.
man: verallgemeinert und führt dazu, dass der Zuhörer alle anderen sieht, nur nicht sich selbst.Ich verwende deshalb lieber einen fiktiven (wann immer möglich bedeutungsvollen) Namen, der innerlich zum Vergleich mit sich selbst anregt, z. B.: „Manni Friedlos ging am Sonntag nur noch sehr selten in die Kirche …“ Der Clou eines Namens lässt sich an einer einfachen Szene zeigen. Stelle ich mich auf den Marktplatz und rufe: „Man liebt!“, halten mich alle Leute zu Recht für verrückt. Rufe ich aber „Marion, ich liebe dich!“, werden alle Leute sich umdrehen und Marion suchen. Machen Sie ruhig den Test!
sollte: ist ein unbestimmter Konjunktiv, der zu nichts verpflichtet, keine wirkliche Aussage hat, völlig unverbindlich bleibt und so den „inneren Schweinehund“ mehr bedient als ehrliches Bemühen. „Sollte“ bedient die Haltung des Wegschauens und Im-Fernsehsessel-Bleibens. Wenn alle Menschen in den Gottesdienst kommen, die sich sagen: „Ich sollte heute mal in die Kirche gehen“, predige ich vor leeren Reihen. („Man müsste mal“ und „sollte“ ist vor allem bei PolitikerInnen sehr beliebt, weil es keine konkrete, überprüfbare Bindungskraft besitzt.)Ich streiche deshalb jedes „sollte“ heraus und überlege, was ich denn für mich an dieser Stelle tun will oder hinbringe: „Der Mensch sollte gut sein“, heißt: Wenn er es nicht ist, ist es auch nicht schlimm! Besser also: „Ich nehme mir vor, gut zu sein, und gelegentlich gelingt es mir auch. Zum Beispiel, wenn ich am Sonntag früh tatsächlich in die Kirche gehe, obwohl es in meinem Bett warm und kuschelig ist! Und wenn ich heimkomme, merke ich, wie gut es mir getan hat.“
eigentlich: verschleiert das, was zu sagen oder zu tun ist, und damit wird es in die Beliebigkeit gestellt oder gar verneint. Eigentlich halte ich die Gebote Gottes = ich halte sie in Wirklichkeit aber nicht! Ich will nur so tun, will zeigen, dass ich die richtige Seite kenne, auch wenn ich sie gleichzeitig ignoriere.Ich versuche zu sagen, was tatsächlich zu tun ist. „Ich bemühe mich, die Gebote zu halten, erlebe aber, wie schwer das ist und wie oft ich daran scheitere. Doch das spornt mich umso mehr an, das nächste Mal Erfolg dabei zu haben.“
Fragen stellen: Wenn ich eine Frage stelle, sucht der/die HörerIn eine Antwort. Dazu fordere ich ja mit der Frage auf. Stelle ich mehr als zwei Fragen hintereinander, verliere ich die ehrlich zuhörenden HörerInnen mit sehr großer Wahr-schein-lich-keit, weil ich sie auf eine große innere Reise schicke, bei der sie die Außenwelt erst einmal abmelden werden. Und zwar zu Recht, ich habe es von ihnen mit meinen Fragen ja so verlangt. Und wenn sie eine Antwort gefunden haben – falls –, können sie eventuell nicht mehr zurückkehren zur Predigt, weil sie auf einer ganz anderen Ebene rausgekommen sind als der/die PredigerIn.Ich stelle also höchstens eine Frage oder – noch besser – ich biete gleich die vom Predigtabschnitt angebotene Antwort an. „Unser Predigtabschnitt antwortet auf die Frage nach dem Sinn des Lebens mit der Aufforderung: Halte die Gebote Gottes.“
wir: Das „wir“ hat viele Funktionen, und es ist darauf zu achten, welches „wir“ ich gerade meine:
Aufforderndes Wir: „Wir beten“ (sagt klar an, was jetzt kommt, lässt keine Wahlmöglichkeit)
Vereinnahmendes Wir: Wir sind alle kleine Sünderlein! = Ich merke, dass ich es bin, und vereinnahme mit dem „wir“ alle anderen (dann bin ich nicht so allein!) – auch noch in der Verkleinerungsform –, um meine eigene Sünde zu kaschieren. Das ist fies! Und auch ich als HörerIn will so nicht behandelt werden.
Heimliches Du-Wir: „Wir rufen da einfach mal bei Meyers an, dann können wir was ausmachen.“: Ich meine aber: Du machst das. Ruf doch du mal dort an und vereinbare etwas.
Verschleierndes „Wir“: „Wir Menschen denken oft, dass es Gott nicht gibt.“ = Es gibt welche, die so denken, aber es gibt auch welche, die ganz anders denken, aber ich glaube, dass du zu denen gehörst, die so denken. Sag ich aber nicht so klar! Dann kannst du mich dafür nicht angreifen.
In der Predigt wird deshalb jedes „Wir“ auf seine ehrliche Funktion hin überprüft. Zur Not wird erklärt, was oder wer mit dem „Wir“ an dieser Stelle gemeint ist, damit der Zuhörer / die Zuhörerin Klarheit bekommt. Also statt: „Wir Menschen denken, dass es Gott nicht gibt“ besser und gleich narrativ: „Karl saß unter dem Baum und dachte nach: ob es Gott wohl wirklich gibt?“ Hierin kann ein/e HörerIn sich wiederfinden.
schon immer/ noch nie / immer überall …: Unkonkrete Summarien machen Schubladen auf, in die dann alle hineingesteckt werden, ohne sich wehren zu können. Das erzeugt inneren Widerstand: Stimmt doch gar nicht! Ich doch nicht! Was fällt dem ein! Alles, was danach kommt, kann nicht mehr neutral gehört werden.Die sog. „Konkretheitsregel“ hilft da sehr: Benenne ein konkretes Verhalten in einer konkreten Situation. Also statt: „Es war schon immer so, dass Menschen gesündigt haben.“ besser: „Gestern Abend hatte ich einen kurzen Streit mit meiner Frau und dachte für einen Moment: Ich könnte sie umbringen! Und dann fiel mir plötzlich ein, dass das ja schon eine Übertretung des 5. Gebotes ist. Und plötzlich erschrak ich über mich. Ich also auch!“
so-nicht-Aufzählungen: Gerne ergießen sich RednerInnen darin aufzuzeigen, was andere alles falsch machen, was diese Definition auf keinen Fall sein will und kann, was alles unmöglich so sein kann, wie es auf gar keinen Fall gedacht werden darf, … um dann am Ende anzudeuten, wie es besser sein könnte.
Das führt HörerInnen auf einen langen energiezehrenden Weg, der die Aufmerksamkeit in epischer Breite auf das Falsche zieht, was dann viel mehr und intensiver hängen bleibt als das, was die Rednerin sagen will. „Paulus meint hier keinesfalls, dass … und meint auch nicht …“ usw. Deshalb:
Ich sage das, was ich weitergeben will. Ich benenne das positive, das gewollte Verhalten, die erwünschte ethische Position. Ich kann und darf darauf vertrauen, dass HörerInnen sofort merken, wenn sie selbst ein anderes Verhalten / eine andere Einstellung / andere Werte-Prioritäten haben und dann für sich ins Nachdenken kommen. Aber jede/r hört dabei nur EIN, nämlich SEIN Fehlverhalten als Kontrastfolie, und deshalb gewinnt der positive, gewollte Aspekt ein viel größeres Gewicht. Und das ist erwünscht.3
Den No-says gegenüber gibt es natürlich auch die Do-says, die ja zum Teil schon in den Beispielen angeklungen sind oder zu erraten waren. Auf sie kommt es an. Auch hier ist die „Liste“ beliebig zu erweitern, und das hier genannte kann nur Impuls-Charakter haben:
Do-says sind hilfreiche sprachliche Mittel, die den/die HörerIn zum Mitgehen und Dranbleiben anregen. Auch hier einige Beispiele:
Ich rede von mir, ohne mich zum Maßstab zu machen„Ich denke, das Problem liegt in unserem Menschsein an sich.“ -> Du darfst anders denken, aber ich biete dir das mal so an.
Ich erzähle eine konkrete Situation„Paloma hatte ein ganz normales Leben, aber heute stand sie vor dem Spiegel und konnte sich nicht ausstehen …“ -> Du kennst solches oder Ähnliches vielleicht auch von dir, aber nicht ICH lege dich darauf fest.
Ich benenne ein konkretes Verhalten„Masuna runzelte die Stirn, fletschte die Zähne, zog die Wangen hoch und murmelte vor sich hin: Ich hasse mich!“ -> Das Bild bietet dir an, hinzuspüren, ob du das auch von dir kennst …
Ich zeige den Zusammenhang einer Aussage zum Thema / zum Predigtabschnitt auf„Gewaltfreies Reden ist die erste Maßnahme, mit der ich Frieden schaffen kann, der in meiner Umgebung anfängt. So sagt es auch Jesus in unserem Predigtabschnitt: ‚Meinen Frieden gebe ich euch.‘“ -> Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber hier ist, was ich aus der Bibel lese, und ich mache es zum Angebot für dein eigenes Nachdenken …
Ich spreche darüber, was das bei mir auslöst, ohne das zur Regel zu machen„Vielleicht kennen Sie das auch: Ich fühle mich dabei beschämt und verlegen.“ -> Du darfst das anders empfinden, aber möglicherweise geht es dir auch so, und dann hörst du gut hin, was als Lösung dafür kommt …
Beschreiben hilft, Wertungen und Urteile (Schubladen) zu vermeiden„Ich habe gesehen, wie du auf den anderen mit geballten Fäusten losgingst, und dabei hast du laut gerufen: Du Schwein, ich mach dich kalt! Ich bin sehr darüber erschrocken. So habe ich dich vorher noch nicht erlebt.“ -> In dieser konkreten Situation finde ich dein Verhalten befremdlich, aber das macht keine Aussage über dich und dein Verhalten anderswo …
Ich rede lieber von dem, was ich für gut halte, als stundenlang aufzuzählen, wie ich es für schlecht halte, damit die Hörenergie nicht unnütz vergeudet wird.„Ich gehe am Sonntag in die Kirche, weil sich ein Sonntag ohne Gottesdienst für mich ganz hohl und leer anfühlt und ein verlorenes Gefühl hinterlässt, als ob ich ein Stück Frieden, einen Hauch der Gerechtigkeit und ein Quantum meines Glücks versäumt hätte.“ -> Ich will ja keine Negativ-Liste erzeugen, was alles schlecht ist, sondern Argumente und Überzeugungen benennen, die es nachahmenswert erscheinen lassen …
Natürlich: Es gibt noch viel mehr: Ich sage natürlich „Mitwelt“ für „Umwelt“, und im theologischen Zusammenhang rede ich von Schöpfung, ich sage Bußzeit statt Fastenzeit und Christkind statt Weihnachtsmann, Predigtabschnitt statt Predigttext usw. Ich hoffe doch, dass Sie, lieber Leser, liebe Leserin, sensibilisiert und motiviert wurden, anderes für sich selbst zu entdecken und umzusetzen. Das, was Sie zu sagen haben, hat es verdient, so gut anzukommen, dass es gehört und bestenfalls verstanden werden kann. Dafür lohnt sich die Mühe. Wenn wir nichts mehr zu sagen haben, ist es auch egal, wie wir es sagen.
Natürlich können Sie auch sagen, dass das Erbsenzählerei ist. Aber machen Sie mal die Probe auf Exempel in einer Predigt oder ähnlichen Hörsituation, was Sie bei kritischem Zuhören hindert, dem Inhalt zu folgen. Sie werden schnell Ihre Liste haben, und ich wette, da ist was von meiner Liste dabei!
1 Paul Watzlawick, österreichisch-amerikanischer Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut, Soziologe, Philosoph und Autor. Aktuelle Forschungsergebnisse dazu bei Elisabeth Wehling, Politisches Framing, Wie eine Nation sich ihr Denken einredet – und daraus Politik macht, Köln 2016.
2 Siehe Tagung der Landessynode der ELKB, Aschaffenburg vom 22. bis 26. November 2009, Protokoll zu E 49: Gebrauch Wort „Umwelt“.
3 Siehe S. 145-147.