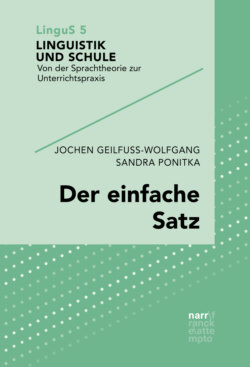Читать книгу Der einfache Satz - Jochen Geilfuß-Wolfgang - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.5 „Das Nomen ist mehr als ein Dingwort“ – Ausbildung von syntaktischen bzw. morphologischen Begriffen
ОглавлениеDer Einstieg in die Arbeit mit Wortarten erfolgt in der Grundschule zumeist semantisch. In Lehrplänen, Curricula oder Lehrwerken finden sich Termini wie „Dingwort“ oder „Gegenstandswort“ wieder. Den Schülerinnen und Schülern soll durch die Eindeutschung des Terminus Nomen der Zugang zu der Wortartenklassifikation erleichtert werden.1 Eine Wortartenklassifikation allein auf der Grundlage eines semantischen Begriffs ist jedoch unzureichend und führt zu Zuordnungsfehlern bei den Schülerinnen und Schülern. Diese zeigen sich häufig im Bereich der Nominalisierungen.
In Beispielsätzen wie (18a–b) werden Nominalisierungen in Formaten wie Übungsdiktaten zumeist nicht erkannt, weil sich die Schülerinnen und Schüler auf ihre semantische Begriffsausbildung stützen. Schöne sowie Gelb werden an dieser Stelle häufig als „Eigenschaftswörter“ – folglich als Adjektive benannt, was wiederum zu Problemen bei der Groß- und Kleinschreibung führt.
Zur Identifizierung eines Nomens bietet sich die Artikelprobe an. Wichtig ist jedoch, dass die Schülerinnen und Schüler zweiteilige Einheiten wie das Gelb oder der Fuchs bilden. Dreiteilige Einheiten wie das helle Gelb oder der kleine Fuchs sollten im ersten Schritt vermieden werden. Hier würde die Gefahr bestehen, dass die Lernerinnen und Lerner die Artikelprobe übergeneralisieren.
Schülerinnen und Schüler sollten von Beginn an mit syntaktischen Termini arbeiten. Der Versuch, in den weiterführenden Klassenstufen (Sekundarstufe I und II) den semantischen Begriff durch einen syntaktischen oder morphologischen vollständig abzulösen bzw. zu erweitern, schlägt in vielen Fällen fehl. Es zeigt sich, dass es den Schülerinnen und Schülern schwerfällt, das einmal Erlernte (semantischer Begriff) zu verwerfen oder zu erweitern. So ist auch bei Studierenden zum Teil noch zu beobachten, dass sie an dem erlernten semantischen Begriff vor allem bei Unsicherheiten in Bestimmungsübungen festhalten.
Problematisch ist auch der Pronomenterminus in der Schule, dem nicht einheitlich und transparent ein syntaktischer oder morphologischer Begriff zugrunde liegt. Als Pro-Nomen, das stellvertretend für ein Nomen bzw. eine komplexe Nominalphrase steht, kann z. B. das Personalpronomen (ich, du, er usw.) bezeichnet werden.
Wie die Beispiele unter (19a–c) zeigen, können die Personalpronomen er, sie und mich eine Phrase mit einem Nomen ersetzen oder durch eine solche ersetzt werden. Anders verhält es sich jedoch zum Beispiel mit den Possessivpronomen wie mein, dein, sein, unser. Sie treten meistens wie ihre in (19d–g) in der Syntax als Artikel auf. Es ist lediglich die Semantik, die das „besitzanzeigende Fürwort“ als solches definiert. Der Pronomenbegriff aus der Schulgrammatik muss demnach dringend überarbeitet werden. Die Lehrkraft sollte hierbei eine differenziertere Aufbereitung vornehmen, als sie aktuell in den meisten gängigen Lehrmaterialien zu finden ist.