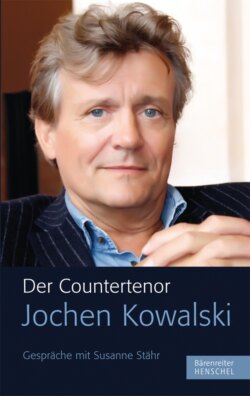Читать книгу Der Countertenor Jochen Kowalski - Jochen Kowalski - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
»Olle Jochen ist halt etwas verrückt«
ОглавлениеEine Kindheit im Havelland
Herr Kowalski, das Erinnerungsvermögen des Menschen setzt zu ganz verschiedenen Zeitpunkten ein. Für manche ist alles, was vor dem fünften oder sechsten Lebensjahr geschah, im Dunkel des Vergessens weggeblendet, andere dagegen warten mit erstaunlichen Gedächtnisleistungen auf. Igor Strawinsky zum Beispiel will sich sogar an seine Taufe erinnert haben, die er im zarten Alter von sechs Wochen in der Petersburger Nikolski-Kathedrale empfangen hat – es war für ihn offenkundig ein traumatisches Erlebnis … Wie sieht das bei Ihnen aus: Was sind Ihre frühesten Erinnerungen?
An meine Taufe erinnere ich mich garantiert nicht, da kenne ich nur die Erzählungen, dass es ein schrecklich heißer Tag gewesen sein muss, irgendwann im Sommer 1954: ein Riesenfest in unserer Familie, mit vierzig oder fünfzig Gästen. Das waren alles wohlgenährte Handwerker, wir befanden uns in der DDR-Aufbruchszeit – die gab es ja wirklich. Nein, meine Taufe hat keine Erinnerungsspuren bei mir hinterlassen, da kann ich Strawinsky nur wieder einmal bewundern, nicht nur seines Gedächtnisses wegen …
Meine ersten Erinnerungen setzen ein auf Rügen, im Sommerurlaub in Binz, wo ich mit einem Eisbären fotografiert wurde. Es war damals Mode, dass Fotografen am Strand rumliefen, mit einem Komparsen im Eisbärenfell, und mit dem wurde ich dann aufgenommen. Eine andere ganz frühe Erinnerung betrifft einen Besuch im Zoo in West-Berlin 1961, kurz vor dem Bau der Mauer. Wir hatten damals ausdrücklich gesagt bekommen, dass wir im Kindergarten nicht darüber sprechen dürften, wo wir hinfahren, sondern nur erzählen sollten, dass wir im Tierpark gewesen wären, also in Ost-Berlin – aber tatsächlich waren wir im Westen, die Grenze war ja noch offen. Vor dem Zoobesuch sind wir auch über den Kurfürstendamm und den Tauentzien spaziert, haben in die Schaufenster des KaDeWe geguckt. Ich hatte noch nie solche Auslagen gesehen! Eine Vitrine zum Beispiel war voll mit bunten Kugelschreibern – so etwas gab es bei uns nicht. Und auf dem Bürgersteig begegneten wir einer Inderin, im Sari und mit einem schwarzen Punkt zwischen den Augen – die hat mich besonders fasziniert. Ich bin immer hinter ihr hergelaufen, sie sah so toll aus …
Sommerurlaub in Binz 1957 © Privatarchiv Jochen Kowalski
Sie stammen aus Wachow im Havelland, einem Dorf von nicht einmal 1.000 Einwohnern, zwischen Nauen und Brandenburg an der Havel gelegen. Ihr Name aber, Kowalski, weist noch weiter ostwärts, nach Polen, und leitet sich von der Berufsbezeichnung »Schmied« ab, ist also der polnische Schmidt. Kommen Ihre Vorfahren aus Polen – oder lebt dieser Strang der Kowalskis schon im Märkischen, solang die Erinnerung zurückreicht?
Nein, meine Großeltern väterlicherseits kamen als Saisonarbeiter aus Südostpolen nach Brandenburg, sie stammten aus dem Gebiet um Kielce. Das war noch vor dem Ersten Weltkrieg, sie heuerten bei hiesigen Bauern an, um überhaupt überleben zu können. In den ersten Jahren gingen sie über Winter noch immer nach Polen zurück, aber irgendwann entschieden sie sich dafür, ganz hierzubleiben. Mein Vater Franz Kowalski jedenfalls wurde 1911 schon in Natterheide in der Altmark geboren.
Haben Sie in Ihrer Kindheit noch die polnische Sprache zu hören bekommen?
Aber natürlich, meine Großeltern haben miteinander nur polnisch gesprochen! Es war für sie gewiss nicht ganz einfach hier. Stellen Sie sich nur vor: Der einzige Sohn, der geliebte Franz, heiratet eine Deutsche, und diese Deutsche ist zu allem Überfluss auch noch evangelisch – ganz im Gegensatz zu den erzkatholischen Polen. Auch meine Mutter wiederum hatte es nicht leicht, in eine Familie zu heiraten, die, wenn man unter sich war, nur polnisch sprach.
Mein Vater allerdings hatte schon früh den Drang, sich selbstständig zu machen und etwas Eigenes aufzubauen. Er ist mit vierzehn von zuhause fortgegangen, abgehauen mit dem Fahrrad, denn er wollte um keinen Preis in die Landwirtschaft. Deshalb hat er sich in die nächstgrößere Stadt aufgemacht, nach Rathenow an der Havel, und hat dort Fleischer gelernt. Und da hat er dann auch meine Mutti Katharina kennengelernt, 1934/35 war das: Sie war damals noch blutjung, Jahrgang 1919. Wenig später, 1936, haben sie schon gemeinsam in Berlin die Olympischen Spiele besucht. Als ich sie einmal fragte: Und habt ihr denn in Berlin auch zusammen übernachtet, da hat sie nur gelacht …
Geheiratet haben die beiden allerdings erst 1941, und das war eine reichlich komplizierte Geschichte. Denn mittlerweile befanden wir uns im Zweiten Weltkrieg, Deutschland hatte zwei Jahre zuvor Polen überfallen, und mein Vater galt als Staatenloser, er hatte ein »P« in seinem Pass: »P« wie »Pole«. Ich weiß nicht, wie er es angestellt hat, aber meinem Vater ist es noch 1941 gelungen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Dadurch konnten meine Eltern zwar vor den Traualtar treten, aber anschließend ist mein Vater gleich in den Krieg eingezogen worden. Da er Fleischer war, hatte er wiederum Glück und wurde für die Versorgung eingesetzt: Er war in Kiel in einer Küche tätig. Meine Mutter blieb zunächst in Rathenow, wo 1942 mein ältester Bruder Gerhard zur Welt kam, wechselte dann aber auch nach Kiel. Und nach Kriegsende sind sie zu dritt wieder zurückgekehrt, aus dem Westen freiwillig in die Ostzone! Aus Heimweh!
Da noch alles am Boden lag und mein Vater anfangs keinen Job hatte, arbeitete er eine Zeitlang als Privatchauffeur für den Architekten Hermann Henselmann, der später die Stalinallee, die heutige Karl-Marx-Allee, bauen sollte. Bis er schließlich erfuhr, dass in einem kleinen Dorf, in Marzahne bei Rathenow, ein Fleischerbetrieb zu verpachten war. Da hat er dann zugegriffen, 1947 muss es gewesen sein, und fing ganz klein an – mit einem Handwagen ist er in der ersten Zeit noch über die Dörfer gezogen. Immerhin hatte er sich dadurch etwas ansparen können, und als er 1950 hörte, dass in Wachow bei Nauen ein größerer Fleischerladen zum Verkauf stand, hat er diesen Betrieb übernommen.
Mit den Eltern Katharina und Franz sowie den Brüdern Gerhard (l.) und Reinhard (r.) 1955 © Privatarchiv Jochen Kowalski
Ging das damals so einfach in der DDR, eine Fleischerei zu kaufen? Konnte Ihr Vater denn als freier Unternehmer arbeiten, oder war er in irgendeine genossenschaftliche Struktur eingebunden?
Damals war das noch nicht so, die eigentliche Bodenreform, die Kollektivierung fand erst 1960 statt, im sogenannten sozialistischen Frühling, als die Landwirte reihenweise in die LPGs getrieben wurden. Das führte dazu, dass damals diverse Wachower Bauern einfach in die S-Bahn gestiegen sind und nicht mehr wiederkamen – es war ja nicht weit nach Berlin. 1950 sah das noch anders aus: Die Großbauern waren zwar schon weg, aber der Mittelstand funktionierte noch, es gab Handwerker aller Arten, Bäckereien, Fleischereien. Insofern konnte auch mein Vater als selbstständiger Fleischer tätig werden. Ich erinnere mich allerdings an einige Diskussionen in meiner Kindheit, als meinen Eltern ans Herz gelegt wurde, doch besser in eine PGH, eine Produktionsgenossenschaft des Handwerks, einzutreten. Das wäre dann eine Verstaatlichung gewesen, meine Eltern wären zu Betriebsleitern degradiert worden. Aber meine Mutter sagte: »Nur über meine Leiche!«
Sie hat auch im Geschäft mitgearbeitet?
Ja, sie war die Chefin, überhaupt von allem. Und hat den Laden mit ihrem Optimismus und Elan geschmissen.
Und heute existiert die Fleischerei Kowalski noch immer …
Die gibt’s noch immer, die leitet mein mittlerer Bruder Reinhard. Und die Wurst von meinem Bruder ist wirklich unvergleichlich, das kann ich beurteilen, denn ich habe ein fast krankhaftes Verhältnis zu Wurstwaren, ich kann kaum an einem Wurststand vorbeigehen, ohne etwas zu kaufen. Aber sehr oft bin ich enttäuscht, denn so etwas Tolles wie bei meinem Bruder kriegt man nicht mal im KaDeWe: Alles ist selbstgeräuchert, mit ausgewählten Hölzern. Sie müssen nur diese verschiedenen Schlackwürste probieren oder die Leberwurst – ich schicke das bis nach München, und alle kriegen strahlende Augen, wenn es Kowalski-Wurst gibt. Alle zwei Jahre gebe ich in Wachow ein Konzert, nur für die Wachower, die Einheimischen. Das steht auch nicht im Internet, sondern wird ausschließlich über die Kirchengemeinde angekündigt. Als Gage erhalten die Mitwirkenden, also zum Beispiel die Musiker der Staatskapelle Berlin, jeweils ein Wurstpaket, Leckerli von Kowalski. Die ganze Kirche hat danach geduftet, und anschließend waren alle zum Schwein am Grill eingeladen. Sogar Manfred Stolpe war einmal dabei und hat sich gar nicht mehr eingekriegt.
Konzert in der Heimat: mit dem Salonorchester Unter’n Linden und Pfarrer Zastrow in der Dorfkirche Wachow, September 2012 © Marlies Schnaibel
Zwischen den drei Brüdern im Hause Kowalski: Wie war da das Binnenverhältnis? Gab es eine bestimmte Rollenverteilung oder spezielle Etiketten, die den drei Jungs jeweils angeheftet wurden?
Jochen Kowalski (l.) mit seinen Brüdern Reinhard und Gerhard 1956 © Privatarchiv Jochen Kowalski
Na klar. Der große war immer der Star, der ging nach Leipzig, um dort Sprachen zu studieren, Französisch und Russisch und was weiß ich nicht alles. Wenn er am Wochenende nach Hause kam, haben wir uns zwar zunächst gefreut, aber dann versuchte er immer, die Erziehungsmaßnahmen, die meine Eltern bei mir nicht so furchtbar wichtig fanden, durchzusetzen. Weshalb ich manchmal dachte: Hoffentlich ist der nur bald wieder in Leipzig! Im Alter hat sich das allerdings gegeben, und er ist inzwischen nicht nur ein gefragter Raumfahrtjournalist, sondern auch mein treuester Konzertbesucher.
Es lag zwischen uns natürlich auch ein gravierender Altersabstand, wir kamen im Turnus von jeweils sechs Jahren zur Welt, Gerhard war also zwölf Jahre älter als ich. Und Reinhard als der Mittlere hatte es naturgemäß am schwersten: Für ihn war von Anfang an vorgesehen, den Betrieb zu übernehmen, auch wenn er ursprünglich wohl lieber etwas anderes gemacht hätte. Er musste einfach in den sauren Apfel beißen, weil die Fleischerei erhalten bleiben sollte.
Von solchen Ambitionen blieb ich glücklicherweise verschont, ich war das Nesthäkchen, der Liebling, der kleine Prinz. Und hatte es sicher am besten von allen Dreien, darüber witzeln wir noch heute.
Jochen mit Kindermädchen Lotti, Weihnachten 1963 © Privatarchiv Jochen Kowalski
Wer war in der Familie Ihre wichtigste Bezugsperson?
Das war Lotti, mein Kindermädchen Charlotte Wulsche. Nach dem Krieg kam sie als Flüchtling mit Mutter und Bruder aus Schlesien nach Wachow. Dort bewohnten die drei zwei Dachkammern in der Fleischerei, die meine Eltern 1950 kauften, und noch im gleichen Jahr fing Lotti als »Mädchen für alles« bei uns im Haushalt zu arbeiten an. Nach und nach wurde sie immer unentbehrlicher und gehörte bald fest zur Familie. Das ist bis heute so geblieben, und ich hoffe, dass es noch viele Jahre weitergehen wird.
Ansonsten war ich eher ein Vatersohn. Mein Vater war viel emotionaler als meine Mutter, er hatte diese slawische Seele, er liebte es, andere in den Arm zu nehmen oder zu streicheln. Wie nah wir einander standen, das habe ich vor allem am Ende gemerkt, als er schon sehr krank war. Er hatte schweren Diabetes, und ich habe noch alles unternommen, ihn in das Institut von Manfred von Ardenne nach Dresden zu bringen, denn ich wollte einfach noch nicht akzeptieren, dass er sterben musste. Über den Bariton Theo Adam, der mit Ardenne befreundet war, konnte ich das bewerkstelligen. Dort wurde dann bei meinem Vater die ebenso berühmte wie umstrittene Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie angewandt. Ich hab ihn dabei mehrfach nach Dresden begleitet, wir waren dort viele Stunden allein miteinander, und im Grunde haben wir uns erst dabei richtig kennengelernt. Vorher hatte er eigentlich nie Zeit, der Mann hat immer und pausenlos gearbeitet, er hat auch nie Urlaub gemacht. Es war ihm völlig unverständlich, wie man den ganzen Tag nur im Strandkorb sitzen kann.
Und mit wem waren Sie dann auf Rügen?
Mit meiner Mutter natürlich. Sie fuhr immer mit uns drei Kindern in den Sommerurlaub, wir mussten jedes Jahr mit ihr an die Ostsee, das brauchte sie einfach. Sie hatte Verkäuferinnen im Laden, die sie in der Zwischenzeit vertraten und alles regelten; die gehörten fast zur Familie, bis heute übrigens. Und so konnte meine Mutter für ein paar Tage ausspannen. Sobald wir in Wachow ins Auto stiegen, fing sie an zu singen und hörte erst wieder auf damit, als wir angekommen waren, vier oder fünf Stunden ging das also – es gab noch keine Autobahn, und so nahm die Fahrt kein Ende, wie eine Weltreise kam sie mir vor. Heute schaff ich das mit meinem Flitzer in zwei Stunden! Aber irgendwie haben diese frühen Urlaube abgefärbt, mich zieht es noch immer an die Ostsee, mehrfach im Jahr. Das gehört zum Sommer wie der Weihnachtsbaum zu Weihnachten. Ich liebe die Ostsee, besonders die Insel Usedom, und ich verbinde meine Stippvisiten oft mit Konzerten. Viele Musiker aus der Staatskapelle haben dort ihre Datschen, wir treffen uns dann und machen Musik, aus Lust und Laune heraus. Das gibt zwar kein Geld, macht aber viel mehr Spaß als die »offiziellen« Auftritte.
Haben Sie von Ihrer Mutter die Musikalität geerbt?
Ja, das denke ich. Sie hatte eine unglaublich schöne Stimme, so klar und jubelnd. Wenn sie in der Kirche anfing zu singen, dann hat sie alle übertönt – als Kind war mir das manchmal so peinlich, dass ich mich zwischen den Kirchenbänken verkroch … Dabei sang sie überhaupt nicht schrill oder ätzend, eher so wie Elisabeth Grümmer, mit Inbrunst und Innigkeit – vielleicht liebe ich diese Sopranistin auch deshalb so besonders.
In der Kirche habe ich übrigens auch selbst zu singen begonnen und habe bei den Krippenspielen jahrelang den Josef gesungen, noch über den Stimmbruch hinaus, bis ich fünfzehn oder sechzehn war. Und als es gar nicht mehr ging, hab ich wenigstens noch die Weihnachtsgeschichte vorgelesen.
Eine »Rampensau« waren Sie also damals schon?
Wahrscheinlich, dabei ist es etwas paradox, denn eigentlich hat mir nie jemand zugehört. In geselligen Runden falle ich nicht besonders auf und bin eher still. Aber als ich da vorne im Altarraum stand, fand ich plötzlich eine Beachtung, die ich sonst nicht erhielt. Das ist übrigens bis heute so geblieben: Mir hört doch nur jemand wirklich zu, wenn ich neben einem Klavier oder vor einem Orchester stehe.
Wie sah es bei Ihnen in der Familie aus: Wurde da Hausmusik gespielt?
Es gab ein Klavier, das extra für meinen ältesten Bruder angeschafft worden war, und er hat auch hervorragend gespielt. Reinhard und ich sollten es dann dem Großen nachtun. Aber wie habe ich das gehasst! Zunächst musste ich Akkordeon lernen, musste immer nach Nauen zu einem Musikdirektor, jeden Montagnachmittag – ein echter Alptraum! Diese Etüden und der ganze Kram haben mich so zur Verzweiflung gebracht, dass ich schließlich die Stricknadeln meiner Mutter nahm und den Blasebalg durchlöcherte. Aber das Teil spielte immer weiter! Irgendwann haben auch meine Eltern gemerkt, dass sie sich das Geld für den Unterricht sparen konnten. Mein Verhältnis zum Akkordeon ist jedenfalls bis heute ziemlich belastet: Wenn Gerhard bei irgendwelchen Familienfeiern nur mit diesem Ding ankommt und es auspackt, werde ich schon aggressiv.
Wie sind Sie dann zur Musik gekommen? Hatten Sie Radio und Plattenspieler?
Wir hatten alles, Radio, Plattenspieler und auch ziemlich früh schon, seit Anfang der sechziger Jahre, einen Fernseher. Meine Eltern hatten ja Geld, es war alles da: Wir besaßen ein Auto, wir waren die ersten, die eine vollautomatische Waschmaschine bekamen …
Kam man denn da so einfach ran als »normaler« DDR-Bürger?
Ach, die Handwerker der DDR kannten doch alle ihre Tricks! Meine Eltern hatten Schinken, Wurst und Fleisch, und da wurde dann einfach ein bisschen umgeschichtet. Die privaten Geschäftsleute haben sich untereinander alle geholfen, das war das perfekteste Netzwerk, das man sich vorstellen kann. Wir waren einfach Jäger und Sammler. Jeden Samstag kamen die Freunde meiner Eltern zu Besuch: Der eine hatte ein Lebensmittelgeschäft, der nächste war Kfz-Mechaniker, und dann haben sie ihre Schätze ausgetauscht. Damit haben sie ganze Wochenenden zugebracht.
Welche Fernseh- und Radioprogramme wurden bei Ihnen eigentlich gesehen und gehört? West oder Ost?
Fast ausschließlich West. Viele der DDR-Fernsehfilme habe ich in den letzten Jahren, bei den Wiederholungen im MDR, zum ersten Mal überhaupt gesehen. Zum Beispiel WEIHNACHTSGANS AUGUSTE, der als großer DDR-Hit gehandelt wird – so einen Schwachsinn haben wir uns nie angeguckt, und ich muss sagen: Wir haben nichts verpasst. Der Ostsender wurde bei uns nur montagabends angeschaltet, weil da die alten UFA-Filme liefen. Und eine Musiksendung wurde angedreht, Die goldene Note, das DDR-Pendant zu Anneliese Rothenberger lädt ein. Und diese beiden waren dann auch meine absoluten Lieblingssendungen, später kam noch Theo Adam lädt ein dazu.
Was hat Ihnen bei Anneliese Rothenberger so gut gefallen?
Sie war immer so elegant! Dieses Ambiente! Ihre Kleider, und dann der Köter auf ihrem Schoß! Ich war einfach begeistert … Wir waren ja auch die ersten in Wachow, die einen Farbfernseher hatten, und dann sogar noch einen, mit dem man West-Sendungen sehen konnte. Der normale DDR-Farbfernseher sowjetischer Bauart war technisch nämlich so präpariert, dass darauf nur die beiden DDR-Programme eingespeist werden konnten; wir aber hatten einen Apparat, der sowohl PAL- als auch SECAM-fähig war, der kostete damals die Kleinigkeit von 4.000 Mark. Durch irgendwelche wunderbaren Beziehungen stand der eines Tages bei uns im Wohnzimmer, und so konnte ich Anneliese Rothenberger mit ihren prächtigen Abendroben und Kulissen sogar in Farbe sehen. Und dann, sehr viel später, stand sie eines Tages leibhaftig vor mir …
Haben Sie ihr erzählt, was sie für Sie bedeutete?
Ja, das hab ich, und ich besitze noch heute einen ganz wunderbaren Brief von ihr. Als ich sie kennenlernte, in München, da wirkten wir beide an einer Benefizgala im Nationaltheater mit. Ich war noch ganz jung, und sie hat mich wohl gleich gemocht. Wir haben uns dann lange unterhalten. Anneliese Rothenberger hatte kein leichtes Leben, sie kam aus einem schwierigen Elternhaus und hat sich alles hart erarbeiten müssen. Heute machen sich viele Leute über sie lustig, aber man darf nicht vergessen, welche Pionierleistungen sie vollbracht hat, gerade in der Vermarktung der Klassik – es war ja noch eine ganz andere Zeit. Ich habe die Stars, die sie präsentierte, allesamt geliebt: Hermann Prey, Josef Metternich und Rudolf Schock, der war der Allergrößte! Auch Rudolf Schock weiß heute keiner mehr richtig zu würdigen, er ist durch seine Heimatfilme aus den fünfziger Jahren etwas in Verruf geraten, und darüber vergisst man leicht, was das für ein Sänger war! Seine klassischen Aufnahmen sind hinreißend.
Sind Sie damals, als Sie Die goldene Note und Anneliese Rothenberger gesehen haben, auf die Idee gekommen, selbst Sänger werden zu wollen?
Ja, das war die Initialzündung. Ich war wie verrückt, vor allem nach Rudolf Schock, und habe bei seinen Platten immer mitgesungen. Und dann waren da noch meine ersten Theaterbesuche. Ich war zwölf oder dreizehn Jahre alt, als ich zum ersten Mal ins Theater ging, in Brandenburg an der Havel. Und dort habe ich etwas später auch meine ersten Opernaufführungen gesehen, den FREISCHÜTZ und den RIGOLETTO, teilweise erinnere ich mich sogar noch an die genauen Besetzungen. Ich fand das damals natürlich schön, aber ich wusste schon instinktiv: Da will ich nie landen. Doch dann habe ich ausgerechnet dort zum allerersten Mal auf einer Opernbühne gestanden, als Student im Jahr 1982, mit dem Don Basilio aus Mozarts FIGARO: Es muss grauenhaft gewesen sein. Übrigens war das genau drei Wochen vor meinem Debüt als Countertenor in Halle.
Wenn Sie da eigentlich nicht landen wollten: Hatten Sie denn Vergleichsmaßstäbe? Waren Sie als Jugendlicher auch schon an der Berliner Staatsoper gewesen?
Ja, da bin ich immer heimlich hingefahren mit dem Motorrad. Auch in die Komische Oper, dort habe ich Walter Felsensteins sensationelle Aufführung von HOFFMANNS ERZÄHLUNGEN gesehen, die ich nie vergessen werde: mit Melitta Muszely in den vier Frauenpartien, Hanns Nocker als Hoffmann und dem tschechischen Bassbariton Rudolf Asmus in der Rolle der Bösewichte. Als Asmus die SPIEGELARIE sang, da wusste ich ganz genau: Das ist es, was ich einmal machen will. Ich war von diesem Gedanken so besessen, dass ich sogar einen Brief an die Komische Oper schrieb und anfragte, ob ich bei ihnen eine Ausbildung zum Opernsänger machen könnte. Und wer, glauben Sie, hat mir darauf geantwortet? Es war Götz Friedrich, der damals dort als Oberspielleiter engagiert war. Er teilte mir mit, dass für die Ausbildung von Opernsängern die Musikhochschulen zuständig seien, und wünschte mir alles Gute für meinen weiteren Weg. Rückblickend muss ich sagen: Toll, dass die damals überhaupt auf meine Anfrage reagiert haben. Und dann meldet sich gleich Götz Friedrich in Person!
Nur eine Woche später hatte ich mir Karten gekauft für LOHENGRIN an der Staatsoper, und dieses Erlebnis war so überwältigend, dass ich dachte: Ich werde ohnmächtig. Der Vorhang ging auf und öffnete sich für einen strahlend blauen Rundhorizont – wir befinden uns ja am Ufer der Schelde –, dazu dieser Klangrausch, und Lohengrin erschien in einem silbernen Kostüm auf einem silbernen Schwan. Und dann sang er, Kammersänger Martin Ritzmann: Das vergesse ich mein Lebtag nicht, ich wäre bereit gewesen zu sterben, wenn ich so hätte singen können. Ritzmann sang an diesem Haus übrigens alles, es war ja wirklich ein Ensembletheater, und er sang es fantastisch, auch wenn ihn im Westen kaum einer kannte.
Wie sind Sie anschließend zur Tat geschritten? Was haben Sie unternommen, um sich dem Traum einer Sängerkarriere zu nähern?
Ich hab mir als erstes den Klavierauszug von LOHENGRIN gekauft und habe die Partie dann mithilfe von Schellackplatten auswendig gelernt – Franz Völker sang darauf die Titelrolle, der große Heldentenor der Berliner Staatsoper aus der Zeit vor dem Krieg. Sein Lohengrin ist bis zum heutigen Tag nicht wieder erreicht, er brauchte keine Zuckungen und Anstrengungen zu unternehmen, der stand einfach da und hatte es perfekt drauf. Wenn ich mit ihm mitgesungen habe, dann wurde meine Stimme auch auf ganz wunderbare Weise frei. Ich habe in Antiquariaten dann alles Erdenkliche gekauft, dessen ich irgendwie habhaft werden konnte: Noten, Textbücher, Platten. Und in meiner Naivität dachte ich: Man stellt sich einfach hin und singt. Natürlich war ich da durch die Gesangsfilme der fünfziger Jahre irregeführt worden. Ich wurde jedenfalls schnell heiser, konnte gerade mal eine halbe Stunde durchhalten, aber das ist auch kein Wunder, wenn ein Siebzehn- oder Achtzehnjähriger Lohengrin schreit.
Was haben Ihre Eltern dazu gesagt?
»Der hat ’nen Knall, lass ihn mal.« Sie haben mich bis zu einem gewissen Grade sogar unterstützt, haben von einer Bekannten ein Grammofon abgekauft, weil sie wussten, wie gern ich alte Platten höre. Und ich hab dann rauf und runter die Schellacks gehört: Richard Tauber, wie er Loewe-Balladen singt, TOM DER REIMER und DIE UHR, zwanzig Mal am Tag hab ich das laufenlassen. Noch heute liebe ich es.
Und in der Schule? Wie haben Ihre Freunde reagiert? Ein Junge, der für Anneliese Rothenberger schwärmt und Balladen von Loewe hört: musste der nicht zwangsläufig ein Außenseiter sein?
Ach, die wussten, olle Jochen ist halt etwas verrückt. Irgendwie haben sie es akzeptiert. Sie haben mich sogar zum Musikverantwortlichen gemacht, wenn es um Klassenfeiern ging, und außerdem war ich in der Schule derjenige, der die Theaterbesuche organisiert hat. Dann bin ich nach Berlin gefahren und habe für alle Opernkarten gekauft, erste Reihe Staatsoper für 2 Mark 50, als einheitlicher Schülerpreis. Bis heute schmunzeln sie über mich und sagen: »Ach, du warst ja früher schon genauso verrückt.« Jedenfalls hab ich nicht darunter gelitten, dass ich mich für etwas anderes interessierte als die Mehrheit.
Für was haben Sie sich denn außer der Musik noch interessiert? Was haben Sie gemocht in der Schule und was nicht?
Deutsch und Geschichte waren meine Lieblingsfächer, Mathematik und Physik habe ich dagegen gehasst – es ist sicher kein Zufall, dass ich bis zum heutigen Tage nicht gut rechnen kann. Auch Staatsbürgerkunde war überhaupt nicht mein Fall, das war mir zu sehr politisch indoktriniert. Wir hatten einen ganz unerschrockenen Mitschüler, Uwe Wulsche, der nie gelogen hat, wenn wir Aufsätze schreiben mussten, über sozialistischen Realismus etwa oder über Romane wie Nikolai Ostrowskis WIE DER STAHL GEHÄRTET WURDE. Das war ja alles so voraussehbar: »Wie muss sich Pawel Kortschagin« – das war der Held – »in dieser oder jener Situation verhalten?«, wurde da gefragt. Und wir wussten genau, was die Lehrer hören wollten. Uwe aber hat das alles in Frage gestellt, was unglaublich mutig war – er wurde später übrigens katholischer Priester. Damals wurde er leider übel denunziert und fast von der Schule geworfen, sein Vater hat deshalb sogar seinen Job verloren – es galt die Sippenhaft. Rückblickend muss ich sagen: Er war eigentlich der Held in unserer Klasse, er war freier als wir alle.
Einschulung 1961 © Privatarchiv Jochen Kowalski
Haben Sie über solche Vorgänge mit Ihren Eltern sprechen können?
Ja, das haben wir schon. Sie haben mir allerdings gesagt: »Du mit deiner großen Klappe, sei lieber ruhig, denk an deine Zukunft.« Sie wollten zwar keine Duckmäuserei – mein Vater erklärte: »Und wenn du auch nur Straßenfeger bist – Hauptsache ist, du machst deinen Job gut.« Aber sie waren andererseits realistisch genug, um zu wissen, wie dieses System funktionierte, und dass man hier Konzessionen machen musste. Das kannten sie ja noch aus der Hitlerzeit, die für meinen Vater als Polen auch alles andere als einfach war. Mein Vater hat das Ende der DDR leider nicht mehr erlebt, er starb 1985; aber meine Mutter, die bis 1990 lebte, sagte mir noch im Herbst 1989: »Jetzt müsste man noch einmal zwanzig Jahre jünger sein, und dann los!«
Wissen Sie, ob Ihre Eltern jemals überlegt haben, Wachow und die DDR zu verlassen?
Soweit ich weiß, haben sie das nie in Erwägung gezogen. Dabei stand meine Mutter wohl auf so einer Art Schwarzen Liste, meine großen Brüder haben mir später erzählt, dass die Stasi Stammgast unter unserem Fenster war. Kein Wunder, denn meine Mutter war ja in der Kirche engagiert, und sie hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. Als ich in der ersten Schulklasse in die Pionierorganisation »Ernst Thälmann« eintreten sollte, hat sie gesagt: »Das unterschreib ich nicht, da gehst du mir nicht rein.« Ich wäre dann der einzige in meiner Klasse gewesen, der da nicht mitgemacht hätte, und das wäre ganz furchtbar für mich gewesen – ich wollte doch auch dazugehören. Also hab ich so lange gejammert, bis mein Vater am Ende unterschrieben hat, aber meine Mutter war so was von sauer … Jedenfalls bin ich dann öfter direkt vom Pioniernachmittag in die Christenlehre gegangen, ein fliegender Wechsel. Ohnehin bin ich zweigleisig gefahren, ich hab den ganzen staatlichen Zirkus mitgemacht, auch die Jugendweihe, und bin zugleich religiös erzogen worden. Der Pfarrer hatte auch nichts dagegen, er sagte nur: »Wichtig ist, dass die Konfirmation nach der Jugendweihe stattfindet und sie dadurch außer Kraft setzt.«
Porträtaufnahme von 1961 © Privatarchiv Jochen Kowalski
Und wo waren Sie lieber: bei den Pionieren oder in der Kirche?
Na, bei den Pionieren haben wir einfach mehr unternommen: Schnitzeljagden, Ausflüge, Theaterbesuche … In der Kirche dagegen musste man immer stillsitzen und anständig sein, aber das wollten wir Kinder doch gar nicht. Ich jedenfalls nicht.
Als Sie in die Pubertät kamen, als Vierzehnjähriger im Jahr 1968, ereigneten sich gesellschaftlich und politisch einige markante Entwicklungen: Im Westen beherrschte die Studentenbewegung die Schlagzeilen, im Osten bildete die Niederschlagung des Prager Frühlings einen Einschnitt. Wie viel haben Sie von dem einen oder dem anderen Ereignis mitbekommen?
Die Studentenrevolte hat mich damals nicht die Bohne interessiert. An den Prager Frühling kann ich mich allerdings erinnern. Wir hörten beim Frühstück immer den RIAS, und ich entsinne mich, dass damals, als die Nachricht vom Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts kam, eine extrem bedrückte Stimmung herrschte. Allerdings haben meine Eltern in Gegenwart der Kinder nicht darüber gesprochen, wir wurden dann rausgeschickt in unsere Zimmer. Und manchmal, wenn wir ins Wohnzimmer kamen, verstummten auch ihre Gespräche.
Gab es in Ihrer Jugend eine Zeit, die man als Phase der Politisierung bezeichnen könnte? Mit siebzehn Jahren sind Sie ja in die damalige Blockpartei CDU eingetreten. Warum?
Weil man mich in der erweiterten Goethe-Oberschule für eine Mitgliedschaft in der SED und die Offizierslaufbahn werben wollte. Ich, ein Offizier! Das ist allein schon ein ziemlicher Witz! Da dachte ich: Na wartet, jetzt bin ich mal eine Spur schneller als ihr! Die CDU-Tante aus Wachow wohnte genau bei uns gegenüber, ich bin zu ihr gegangen und habe sie einfach gefragt: »Kann ich nicht in der CDU mitmachen?« Und von dem Tag an hatte ich meine Ruhe. Es war also eine Schutzmaßnahme und kein Akt der Überzeugung. Die Ost-CDU hat sich bei mir danach erst wieder gemeldet, als sich meine ersten Erfolge einstellten: Da kam dann plötzlich ein Glückwünsch-Telegramm vom Vorsitzenden der Partei, Gerald Götting, voller Stolz auf dieses Mitglied: »Lieber Unions-Freund Kowalski …«
Wann haben Sie sich aus der Partei wieder verabschiedet?
Nach der Wende, als wir vereinigt wurden. Das wollte ich nun nicht mehr.
In der DDR galt die allgemeine Wehrpflicht. Wie ist es Ihnen diesbezüglich ergangen?
Das hat meine Mutter in ihre Hand genommen, sie war klasse in dieser Hinsicht. Mit vierzehn hatte ich nämlich eine Hirnhautentzündung, und sie zeigte sich ganz sicher: »Da machen wir was draus.« Sie ist deshalb mit mir von Arzt zu Arzt gezogen und hat es irgendwie geschafft, dass ich ausgemustert wurde. Ich sehe mich noch in Nauen bei der Nationalen Volksarmee sitzen, ein Offizier erscheint und erklärt: »Es tut uns wirklich sehr leid, dass wir Sie nicht aufnehmen können. Das ist zu gefährlich.« Und ich Trottel hab ihm geantwortet: »Ach, kann ich nicht wenigstens für sechs Wochen kommen?« Meine Mutter behauptete daraufhin: »Irgendwie ist bei dir tatsächlich etwas zurückgeblieben, du hast eine ziemliche Macke.«
Aber dadurch waren Sie mit achtzehn Jahren frei und konnten gleich Ihr Erwachsenenleben beginnen …
Ja, ich war frei und hatte sogar schon einen Studienplatz, es war alles geregelt und organisiert in der DDR. Ich wurde nach Leipzig geschickt, wo ich Binnenhandel studieren sollte, das war mir zugeteilt worden, obwohl ich es überhaupt nicht wollte. Und da ich ein großer Liebhaber der Deutschen Staatsoper Berlin war, habe ich mich lieber der staatlichen Vorsehung entzogen und fing im August 1972 dort als Requisiteur an.