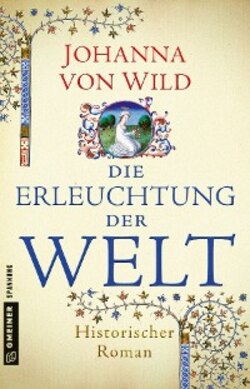Читать книгу Die Erleuchtung der Welt - Johanna von Wild - Страница 9
1428 Heidelberg, Januar
ОглавлениеKurfürst Ludwig war krank von der Pilgerfahrt ins Heilige Land nach Schloss Heidelberg zurückgekehrt. Auch die Pilgerreise hatte ihm den Schmerz über den frühen Tod seines Sohnes Ruprecht, der aus der ersten Ehe mit Blanca von England stammte, nicht nehmen können. Blanca selbst war viel zu früh mit nur siebzehn Jahren am Wechselfieber verstorben, und Ludwig hatte Ruprecht als seinen Thronfolger angesehen. Nachdem dieser vor zwei Jahren seiner Mutter ins Grab gefolgt war, hatte Ludwig die Pilgerfahrt unternommen. Zuvor hatte er mit seinem jüngsten Bruder Otto einen Vertrag über gegenseitige Beerbung geschlossen, und für den Fall, sollte er auf der Reise sterben, diesem die Vormundschaft für seine Kinder übertragen. Außerdem hatte Otto stellvertretend während Ludwigs Abwesenheit die Regierungsgeschäfte mit den kurfürstlichen Räten übernommen. Auf Otto war Verlass.
Das Augenlicht des Kurfürsten wurde zusehends schlechter, und das Lesen, das er so liebte, immer schwieriger.
»Ich vermache meine kostbaren Bücher und Handschriften der Universität«, eröffnete Ludwig seiner Frau, »damit das Wissen all jener Gelehrten, die sie geschrieben haben, künftig den Studenten frei zur Verfügung steht und nicht verloren geht.«
Er nahm einen Schluck Wein aus dem silbernen Pokal und bedeutete einem Diener, ihm ein weiteres Stück Fasan auf den Teller zu legen. Matilde nickte zustimmend und lenkte das Gespräch in eine andere Richtung. »Meister Jorg wünscht, dass du dir die Fortschritte am Langhaus der Heiliggeistkirche ansiehst.«
Ludwig nickte versonnen.
»Ich hoffe, ich erlebe die Fertigstellung noch, es geht mir manches Mal nicht schnell genug voran«, seufzte er. Dann wandte er sich an seine Ratgeber, die mit an der hohen Tafel saßen. »Sigismund will neue Truppen aufstellen …«
»Vater, Vater«, platzte plötzlich seine Tochter Mechthild, die bald ihren neunten Geburtstag feiern würde, aufgeregt mitten in die Unterhaltung. »Ich kann Verse von Petrarca aufsagen. Wollt Ihr sie hören?«
Eigentlich hätte Ludwig seiner Ältesten eine Rüge erteilen sollen, konnte aber ob ihrer kindlichen Freude ein Schmunzeln nicht unterdrücken. Außerdem war er stolz auf sie. Es erfüllte ihn mit Freude, dass sie, genauso sehr wie er, die Liebe zu Büchern teilte. Erst neulich hatte sie ihn zum Lachen gebracht, als er sie mit zur Universität genommen hatte, und Mechthild ein wunderbar verziertes Buch ehrfürchtig berührt und an ihm geschnuppert hatte, den Geruch der alten Seiten tief einatmend. Auf ihren Gesichtszügen hatte ein seliges Lächeln gelegen.
›Nichts riecht so gut wie Papier und Pergament‹, waren ihre Worte gewesen.
»Dann lass uns teilhaben an deinem neu erlernten Wissen.«
Mechthild gab fünf Verse zum Besten, genoss den höfischen Applaus.
»Sehr gut, mein Kind«, lobte Ludwig. »Doch nun denke ich, ist es an der Zeit, zu Bett zu gehen. Jedenfalls für dich«, fügte er hinzu und strich ihr sanft über die Wange.
Nur selten zeigte Ludwig seine Zuneigung zu seiner Tochter so offen. Sie war ein außerordentlich kluges Geschöpf, und bereits jetzt erkannte man, dass sie auch zu einer bildschönen Frau heranwachsen würde. Graf Ludwig von Württemberg konnte sich glücklich schätzen, in einigen Jahren Mechthild als seine Frau heimzuführen. Die Verlobung zwischen dem sieben Jahre älteren Ludwig war bereits acht Monate nach Mechthilds Geburt arrangiert worden. Der Kurfürst konnte nur hoffen, dass Mechthild und ihr zukünftiger Gemahl auch miteinander glücklich wurden. Manch vereinbarte Ehe glich mehr einer Heimsuchung und verursachte den Eheleuten nichts als Kummer.
»Der Kaiser plant eine Steuer, um neue Truppen ausheben zu können«, nahm Ludwig den Faden wieder auf, nachdem die Kinderfrau Mechthild an der Hand genommen und aus der Halle gebracht hatte.
»Er wird schon Hussitenpfennig genannt«, warf einer seiner Ratgeber ein.
»Die Hussiten werden nie Ruhe geben, fürchte ich. Seit der Häretiker Jan Hus in Konstanz verbrannt wurde, folgt ein Kreuzzug dem nächsten.«
»Und dieser verdammte, verzeiht, Euer Durchlaucht …«, unterbrach sich der Rat selbst, doch der Kurfürst winkte ab. »Prediger Prokop wird mit jedem Sieg über die Kaiserheere stärker. In Böhmen steht bald kein Stein mehr auf dem anderen.«
Kurfürst Ludwig seufzte. Er würde seinem Bruder, Pfalzgraf Johann, dessen Land an Böhmen grenzte, weiterhin beistehen müssen. Lieber wäre ihm, er könnte das Geld, das Kriege verschlangen, dafür nutzen, um noch mehr Bücher und Handschriften für seine Bibliothek zu erwerben.
Wigbert saß derweil betrunken in einem Wirtshaus in Neckargemünd, dabei war es noch nicht einmal Mittag. Seit Margrets Tod hatte er sich mehr und mehr in den Suff geflüchtet, die Anzahl der Münzen in der kleinen Truhe war dramatisch zusammengeschrumpft. Nur ab und an fand er Arbeit als Tagelöhner, was im Winter ohnehin schwer war. Zudem sprach es sich langsam herum, dass Wigbert mehr trank, als ihm guttat, sodass die Handwerker lieber jemand anderen für Handlangerdienste einstellten. Nie hätte Wigbert für möglich gehalten, wie sehr ihm seine Frau fehlte.
Helena hielt das Haus zwar in Ordnung, flickte Kleidung, buk Brot, doch sie war kein Ersatz für seine geliebte Margret. Vor allem schlich sie sich, wann immer es ging, zu den Ställen eines Großbauern, der vier Pferde sein eigen nannte. Helena war verrückt nach den Tieren, liebte ihre Sanftheit und die Ruhe, die sie ausstrahlten. Wie oft hatte Wigbert seiner Tochter schon zu Margrets Lebzeiten verboten, dorthin zu gehen, aber sie hörte nicht. Zudem war sie versessen darauf, Lesen und Schreiben zu lernen. Und wenn sie sich nicht zu den Pferden davonmachte, verschwand sie zur Pfarrschule. Dort hatte sie einen Jungen gefunden, der ihr die Buchstaben beibrachte. Manches Mal hatte Wigbert seine Tochter vorgefunden, wie sie selbstvergessen mit den Fingern Buchstaben in den Schmutz malte. Ohrfeigen hielten sie nicht davon ab, sich immer wieder aus dem Staub zu machen. Und Margret hatte stets zu ihr gehalten.
Wigbert vermisste die Gespräche mit seiner Frau. Margret war sein Fels in der Brandung gewesen, wenn es Schwierigkeiten gegeben oder das Geld hinten und vorne nicht gereicht hatte. Sie war eine starke Frau gewesen, viel stärker als er, und Helena wurde ihr, was das anbelangte, immer ähnlicher.
Jemand knuffte ihn in die Seite und riss ihn aus seinen wehmütigen Gedanken.
»Wigbert, du bist dran«, forderte ihn sein Tischnachbar auf.
Wigbert griff nach dem ledernen Würfelbecher, schüttelte ihn und stülpte ihn auf den rohen Holztisch, lüftete ihn. Nur eine Zwei und eine Drei. Das reichte bei Weitem nicht, um die beiden Fünfen, die gerade gewürfelt worden waren, zu übertrumpfen. Verloren. Schon wieder.
»Tja, Wigbert, sieht schlecht für dich aus, ich fürchte, du musst mich bezahlen«, feixte Cuntz. Der Winzer schien das Glück gepachtet zu haben, hatte kaum eine Würfelrunde verloren, und das Häufchen gewonnener Münzen vor ihm wuchs stetig.
»Wie viel?«
»Drei Gulden.«
Großer Gott, das konnte er niemals bezahlen. Für drei Gulden musste er zwei Monate arbeiten. Mit einem Schlag war er nüchtern.
»So viel habe ich nicht«, antwortete Wigbert heiser.
Cuntz’ Gesicht nahm einen harten Zug an.
»Dann gib mir, was du hast, und den Rest zahlst du mir bis Ende Jänner.«
»Aber wovon soll ich dann leben? Jetzt ist keine Erntezeit, kaum einer braucht einen Tagelöhner. Ich komme so schon schlecht über die Runden. Das kann ich nicht, meine Kinder …«, rief Wigbert entsetzt.
»Nicht meine Angelegenheit. Du hast Geld zum Würfelspiel, dann kann es so schlimm nicht sein«, erwiderte Cuntz Wengerter unversöhnlich.
»Er hat recht, Wigbert«, pflichtete einer der Mitspieler dem Winzer bei.
Fieberhaft dachte Wigbert über einen Ausweg nach. Dann kam ihm ein rettender Gedanke. »Meine Tochter Helena könnte die Schulden bei dir auf dem Weinberg abarbeiten oder im Haus. Bald ist Mariä Lichtmess, da kannst du sicher ein paar Hände mehr gebrauchen. Sie ist fleißig, geschickt und nicht dumm. Ich würde sie dir überlassen, bis die Schulden abgetragen sind.«
»Ist sie hübsch?«
Wigbert pries Helenas Vorzüge in den höchsten Tönen. »Feingliedrig und anmutig wie ein Reh ist sie, und trotzdem kann sie zupacken. Ihr Haar hat eine besondere Farbe, dunkelrot, wie das Herbstlaub, und ihre grünen Augen funkeln wie Edelsteine. Und sittsam ist sie, wie es sich für ein anständiges Mädchen gehört. Ein wahrer Engel, gottesfürchtig und gehorsam.«
»Schon gut, Wigbert, bevor du mir noch weismachst, sie ist die Jungfrau Maria, schau ich sie mir lieber selbst an. Und nun lass uns gehen.« Er stieß Wigbert den Ellbogen in die Rippen.
»Jetzt?«
»Natürlich jetzt.«
»Ja, ja, einverstanden, ich versichere dir, ich habe nicht übertrieben, was meine Tochter anbelangt«, beeilte sich Wigbert zu sagen und stürzte sein Bier in dem fast vollen Becher in einem Zug hinunter.
Mühsam und schwankend erhob sich Wigbert von seinem Hocker und verließ, gefolgt von Cuntz, das Wirtshaus. Draußen waren die Gassen matschig. Der Winter hatte in den letzten Wochen die Natur fest im Griff gehabt, doch seit zwei Tagen war Tauwetter eingetreten, das den gefrorenen Untergrund in Schlamm verwandelt hatte. Der Winzer nahm Wigbert mit auf seinen Wagen, ließ die Leinen auf die dunkelbraunen Pferderücken klatschen, und die beiden Tiere zogen geduldig an.
Als Wigbert und Cuntz die Kate betraten, war Helena gerade dabei, einen Brei aus Weizen zu kochen. Mit kräftigen Bewegungen rührte sie im Topf und gab noch ein paar verschrumpelte Zwiebeln hinzu, damit die Mahlzeit nicht ganz so fade schmeckte.
»Helena, bring unserem Gast und mir etwas zu trinken«, forderte Wigbert seine Tochter mit schwerer Zunge auf.
Helena blickte über die Schulter und betrachtete argwöhnisch den Fremden, der neben ihrem Vater stand. Groß gewachsen, breite Schultern, einen stattlichen Bauch vor sich hertragend, hellbraunes Haupthaar und einen etwas dunkleren Bart. Seine Gesichtszüge wirkten hart, und seine braunen Augen musterten Helena kalt. Sie holte zwei Becher und einen Krug mit Dünnbier. Beides stellte sie auf den Tisch, schenkte ein und wollte sich gerade wieder der Feuerstelle zuwenden, als Cuntz sie grob am Handgelenk packte.
»Nicht so schnell, meine Hübsche.«
Helena erstarrte und spürte einen Kloß in ihrem Hals.
»Du hast nicht zu viel versprochen, Wigbert«, wandte sich Cuntz an seinen Gastgeber. »Ein hübsches Mädchen hast du da, und wenn ich mich hier so umsehe, hält sie deine Hütte in Ordnung.«
Helena warf ihrem Vater einen fragenden Blick zu, doch dieser wich ihr aus.
»Ich hab’s dir doch gesagt. Dann gilt jetzt unsere Abmachung«, krächzte Wigbert heiser.
»Was für eine Abmachung, Vater?«, wagte Helena mit klopfendem Herzen zu fragen.
Doch dieser blieb ihr die Antwort schuldig, senkte den Blick beschämt zu Boden. An seiner statt klärte der Winzer sie grinsend auf und gab ihren Arm frei.
»Du kommst mit zu mir und arbeitest die Spielschulden deines Vaters ab.«
Entsetzt riss Helena die Augen auf. »Wie konntest du nur?«, rief sie wütend. »Statt zu arbeiten, versäufst und verspielst du das Wenige, das wir haben! Und das am helllichten Tag. Ich …«
Eine schallende Ohrfeige Wigberts brachte sie zum Schweigen. Ihre Wange brannte und Tränen stiegen ihr in die Augen, doch Helena drückte sie tapfer zurück. Sie würde sich keine Blöße geben und weinen. Fest presste sie ihre Kiefer zusammen. Ihre Augen wurden zu schmalen Schlitzen, als sie seinen Blick erwiderte. Ihr Vater verschacherte sie wie ein Stück Vieh. Das würde sie ihm nie vergeben.
»Koch den Brei fertig, dann gehst du mit Cuntz.«
Seine traurigen Augen ließen sie wissen, es tat ihm leid, sie geschlagen zu haben.
Nur gut, dass Mutter das nicht mehr erleben muss. Bestimmt dreht sie sich im Grabe um, dachte Helena zornig.
»Du kannst deinen Brei alleine kochen, ich gehe gleich«, schleuderte sie ihm entgegen. »Oder frag Siegfried, vielleicht übernimmt der nun die Hausarbeit.«
Cuntz Wengerter gefiel das Mädchen immer besser. Von wegen gehorsam. Eine kleine Rebellin war sie. Die Zeit mit Helena auf seinem Wingert versprach spannend zu werden. Er würde ihr ihre Widersetzlichkeit schon austreiben, freute sich der Winzer diebisch.
»Stimmt genau, Wigbert, jetzt musst du wohl selbst den Brei rühren, es riecht schon ein wenig angebrannt«, feixte er. »Na komm schon, Mädchen, vor uns liegt ein ordentliches Stück Weg.«
»Mein Name ist Helena«, sagte sie mit fester Stimme.
Sie nahm den alten Mantel ihrer Mutter, der schon deutlich bessere Tage gesehen hatte, und verließ hoch erhobenen Hauptes die Kate, ohne ihren Vater eines Blickes zu würdigen. Cuntz folgte ihr auf dem Fuß, nicht ohne Wigbert zuzuzwinkern.
»Steig hinten auf«, forderte der Winzer, hievte sich auf den Kutschbock und nahm die Zügel in die Hand. Der Wagen setzte sich in Bewegung.
Als Winzer verdiente er gutes Geld und konnte sich Pferde und Wagen leisten. Helena war froh, dass sie nicht zu Fuß gehen musste. Ihre schäbigen alten Schuhe hielten mit viel Glück gerade noch diesen Winter über durch. Vielleicht war es ja ein Wink des Schicksals, dass ihr Vater beim Würfeln verloren hatte.
Wenn ich mich anstrenge und fleißig bin und mich unentbehrlich mache, dachte sie, behält Cuntz mich vielleicht als Magd. Das wäre besser, als wieder zurück zu Vater zu gehen. Bestimmt sind die Schlafstätten für die Arbeiter auf dem Wingert trockener und wärmer als die in unserer armseligen, zugigen Hütte.
»Helena! Helena!«
Sie wandte den Kopf. Siegfried lief hinter dem Wagen her. »Wo fährst du hin? Was hat das zu bedeuten?«, schrie er aufgeregt.
»Frag Vater! Und pass auf dich auf, Siegfried!«
Cuntz ließ die Pferde antraben, und der Wagen entfernte sich schnell. Siegfrieds Gestalt, die mit hängenden Armen auf der Straße stand, wurde immer kleiner.
Die ganze Fahrt über sprach Cuntz kein Wort mit Helena, der es aber gerade recht war. So konnte sie die vorüberziehende Landschaft bestaunen, denn aus Neckargemünd war sie kaum jemals herausgekommen. Der Fahrtwind war eisig, und Helena zog den fadenscheinigen Mantel enger um sich, doch es nutzte wenig. Sie hätte doch noch einen heißen Brei essen sollen. Der Gedanke an das karge Mahl ließ ihren Magen sich schmerzhaft zusammenziehen.
Cuntz lenkte das Gespann vom Neckar in Richtung Süden, passierte Äcker und Wiesen und durchquerte Mischwälder. Schließlich gelangten sie zu dem Weingut. Der Wingert, die dazugehörigen Ländereien und die Gebäude waren seit Langem im Besitz der Familie Wengerter und Cuntz war nicht an einen Grundherren gebunden, wie manch andere Winzer. Zudem besaß er Allmendrechte, sodass er Weideflächen für eine kleine Viehherde nutzen konnte, um den Eigenbedarf an Fleisch und Milch zu decken. Ebenso räumten ihm die Allmendrechte ein, Holz für den Winter oder zum Bauen zu schlagen.
Cuntz brachte die Pferde vor einem großen Steinhaus zum Stehen.
»Wir sind da, steig ab«, sagte er und sprang selbst erstaunlich behände vom Kutschbock.
Knechte eilten herbei, um die Pferde auszuspannen und den Wagen in eine Scheune zu schieben. Cuntz legte Helena die Hand auf den Rücken und schob sie in Richtung Haus, aus dem gerade eine ältere, rundliche Frau trat. Sie trug ein dunkelgrünes Oberkleid, das über dem Busen geschnürt war, ein längeres braunes Unterkleid lugte unter dem Saum hervor. Die Mitte ihres Leibes zierte eine ebenso braune Schürze, versehen mit Stickereien. Ihre Haare waren unter einer beigen Haube verborgen, die Füße steckten in warmen Stiefeln.
»Cuntz, was hast du uns denn da nach Hause gebracht?«, fragte sie und wies mit dem Kinn auf Helena.
»Hab ich beim Spielen gewonnen. Wir brauchen so oder so noch eine Magd, Agnes, und die hier ist umsonst.«
»Beim Spiel? Ich hoffe, du hast mehr gewonnen als nur ein Kind. Wolltest du nicht die Finger von den Würfeln lassen?«
Agnes Wengerter, Cuntz’ Schwester, schüttelte nachsichtig den Kopf und musterte das zierliche Mädchen mit hochgezogenen Augenbrauen. Ihre dunklen Augen blickten warm und mitleidig in Helenas blasses Gesicht.
»Viel zu dünn. Wie heißt du, mein Kind?«
»Helena, Herrin«, antwortete sie zaghaft.
»Nun komm erst mal in die Küche, dann bekommst du etwas zu essen. Wie alt bist du?«
»Zwölf, Herrin.«
Die Aussicht auf etwas zu essen ließ ihren Magen so laut knurren, dass die Winzerleute es deutlich hören konnten.
»Na, deine letzte Mahlzeit scheint ja eine Weile her zu sein«, lachte Agnes leise.
»Sie wollte es so. Hat die Gelegenheit verstreichen lassen, zu Hause noch einen Brei zu essen. Helena konnte nicht schnell genug von ihrem nichtsnutzigen Vater fortkommen«, dröhnte Cuntz.
Helena biss sich auf die Lippen und schluckte eine patzige Antwort hinunter. Ihr Vater war kein Nichtsnutz. Mutters Tod hatte ihn aus der Bahn geworfen. Das war alles. Ob Siegfried wohl ohne seine ältere Schwester zurechtkam? Bevor sie weiter darüber nachdenken konnte, bugsierte Agnes sie ins Haus. Die Frau führte Helena durch die Eingangshalle, in deren Ecke ein Kaminfeuer prasselte. Hier empfing Cuntz Gäste und Händler. Zwei Türen, eine rechts, eine links, führten in die angrenzenden Räume. Cuntz, der ihnen gefolgt war, verschwand ohne ein weiteres Wort durch die rechte Tür, wo über eine Treppe ins Obergeschoss die Schreibstube und die Schlafräume der Familie Wengerter zu erreichen waren. Agnes schritt voran, öffnete die linke Tür, hinter der sich die Küche verbarg.
An der rechten Küchenwand befand sich die Luke eines Kachelofens, der die nebenan liegende Wohnstube mit Wärme versorgte. Ein eiserner Kessel hing an einer Kette über dem Herdfeuer in der Ecke, der über eine Zugvorrichtung nach oben gezogen oder nach unten gelassen werden konnte. Daneben ragte der Kaminschlot empor, um den Rauch aus der Küche zu entlassen. Die Mitte der Küche nahm ein riesiger Holztisch ein, die Wand links gegenüber dem Ofen war größtenteils bis unter die Decke mit Holzgestellen bestückt, auf denen Töpfe, Krüge und Gefäße mit Schmalz, getrockneten Hülsenfrüchten und Salz Platz gefunden hatten. Daneben gab es ein zweiteiliges Fenster, das den Blick auf den Hof freigab. Die Tür gegenüber dem Kücheneingang führte in die Wohnstube.
Der Geruch des Eintopfs aus Erbsen, Gerste und Speck, der im Kessel vor sich hin brodelte, stieg Helena in die Nase, und der nagende Hunger verursachte ihr eine leichte Übelkeit.
Eine ältere Magd saß auf einem kleinen Schemel in der Nähe der Herdstelle und rupfte ein Huhn. Vier weitere lagen schon ihres Federkleids beraubt neben ihr auf dem Boden.
»Magda, das ist Helena, sie wird dir und den anderen Mägden ab jetzt zur Hand gehen. Aber gib ihr erst mal noch einen Teller Eintopf und ein Stück Brot«, bat Agnes. »Benimm dich anständig, Mädchen. Widerworte werden nicht geduldet. Du tust, was man dir aufträgt«, wandte sie sich an Helena. »Verstanden?«
»Ja, Herrin.«
»Gut. Hier auf dem Weinberg gibt es viel zu tun, wir arbeiten vom Morgengrauen bis nach Anbruch der Dunkelheit. Dafür bekommst du einen trockenen, warmen Schlafplatz und jeden Tag drei Mahlzeiten.«
Drei Mahlzeiten. Helena schickte ein stummes Dankgebet gen Himmel, dass Gott sie hierhergeführt hatte. Oder wohl eher das Pech ihres Vaters beim Würfelspiel.
»Und Magda«, fügte Agnes hinzu, »sieh nach, ob du ein paar anständige Kleider und ein paar Stiefel für sie findest. Das Kind trägt ja nur noch Lumpen am Leib.«
Die alte Magd brummte zustimmend, und Agnes verließ ohne ein weiteres Wort die Küche.
»Nimm dir einen Teller, Löffel sind in der Kiste auf dem zweiten Brett, wenn du keinen eigenen hast.« Magda wies auf das Holzgerüst an der Wand.
Helena tat wie ihr geheißen und hielt der Magd den hölzernen Suppenteller hin, in den diese eine ordentliche Portion Eintopf aus dem Kessel schöpfte.
»Setz dich, ich gebe dir noch ein Stück Brot.«
Herzhaft langte Helena zu, verbrannte sich den Mund an dem heißen Eintopf und blies beim nächsten Löffel vorsichtig über das dampfende Essen. Sie musste sich zwingen, nicht zu schlingen, so ein leckeres Mahl hatte sie schon lange nicht mehr gehabt. Speck hatte es zu Hause seit Monaten nicht gegeben.
Magda brach ein Stück Brot von einem Laib ab, reichte es dem Mädchen und stellte ihr einen Becher und einen Krug mit dünnem Bier hin. Dann setzte sie sich wieder auf ihren Schemel und rupfte das Huhn.
»Wo kommst du her, und wie alt bist du?«, wollte die alte Magda ohne aufzusehen wissen.
»Aus Neckargemünd«, antwortete Helena mit vollem Mund. »Kurz vor Weihnachten bin ich zwölf geworden. Ist Agnes die Frau unseres Herrn?«
»Nein, seine Schwester«, erwiderte die Magd. »Seine Frau ist vor einigen Jahren gestorben.«
Schweigend leerte Helena ihren Teller, wischte ihn mit dem letzten Stückchen Brot sauber.
»Bist du satt?«, fragte Magda und kehrte die Federn zusammen.
Helena nickte. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie zuletzt so satt gewesen war. Durstig schenkte sie den Becher voll und trank ihn mit großen Schlucken leer.
»Hilf mir mit dem Kessel, er muss vom Feuer, sonst brennt der Eintopf an.«
Magda zog den Kessel an der Kette ein Stück nach oben, und Helena nahm einen langen Eisenhaken, mit welchem sie den Kessel von der Feuerstelle bewegte. Langsam ließ Magda die Kette durch ihre Finger gleiten, bis der Kessel auf dem Boden aufsetzte.
»Gut gemacht. Weißt du, wie man ein Huhn ausnimmt?«
Helena war froh, dass ihre Mutter ihr das einst beigebracht hatte, als die Zeiten noch besser gewesen waren. Damals hatte es öfter Huhn gegeben. Doch dann war dieser heiße Sommer einem verregneten gefolgt, alles war auf den Feldern verdorrt, die ihr Vater mitbestellt hatte. Zwei schlechte Erntejahre hintereinander, und seither war es mit der Familie zusehends bergab gegangen. Kaum jemand brauchte einen Tagelöhner. Auch die Handwerker schufteten von früh bis spät und stellten nur selten jemanden ein, um Geld zu sparen, denn Brot war teuer geworden.
›Morgen wird es regnen, dann kommen wieder bessere Zeiten‹, war Wigberts täglicher Spruch gewesen. Doch geregnet hatte es nicht. Von der Kirche hatten sie Almosen erhalten, wofür sich Margret geschämt hatte. Aber ohne die milden Gaben, die auch nicht gerade üppig gewesen waren, wären sie nicht ausgekommen.
»Ja, das kann ich«, erwiderte Helena stolz.
»Gut, dann nimm die Hühner aus. Lebern, Herzen und Mägen legst du beiseite, ebenso die Hälse. Die braten wir später an. Wenn du fertig bist, schneidest du Zwiebeln und Mohrrüben. Die findest du in den Säcken in der Ecke dahinten.«
Helena arbeitete schnell und geschickt, wie Magda zufrieden feststellte, und wenig später brutzelten die Hühner auf einem langen Bratenspieß über dem Feuer. In einer tiefen Eisenpfanne schmorten die Innereien mit dem Gemüse. Magda gab noch ein paar getrocknete Kräuter, die in kleinen Sträußchen von der Decke hingen, hinzu. Ebenso eine Prise Salz und Pfefferkörner, ein gar kostbarer Schatz.
Inzwischen war es draußen dunkel geworden. Magda entzündete mehrere Fackeln, die in den Wandhalterungen steckten. Zwei weitere Mägde fanden sich in der Küche ein, die ältere hieß Hildegard und die jüngere Ännlin. Helena schätzte sie auf achtzehn Jahre. Magda stellte Helena vor, um dann gleich ihre Anweisungen zu geben.
»Hildegard und ich bedienen die Herrschaften, Ännlin und du, Helena, ihr sorgt dafür, dass die Schüsseln gefüllt sind und nichts anbrennt.« Sie klatschte in die Hände, um ihren Anforderungen Nachdruck zu verleihen. Flugs begann Helena, zwei große Schalen mit den geschmorten Innereien zu füllen, während Ännlin Brot in Stücke brach und in einen Weidenkorb legte. Die älteren Mägde verschwanden durch die hintere Tür, jede zwei Krüge mit Bier und Wein in den Händen. Nach kurzer Zeit erschienen sie wieder, nahmen den Brotkorb und die dampfenden Schüsseln und ließen die Mädchen allein.
Verstohlen musterte Helena die junge Ännlin. Die dunkelbraunen Haare hatte sie zu zwei dicken Zöpfen geflochten, ihre üppige Gestalt verbarg sie unter einem braunen Kittel, ihre Füße steckten in knöchelhohen, warmen Stiefeln. Helena bemerkte eine kleine Wölbung, die sich unter dem Kittel der Magd abzeichnete. Das Mädchen war eindeutig schwanger. Ihr Gesicht zeigte einen hochnäsigen Ausdruck, als sie mit geübten Bewegungen die Bratspieße über dem Feuer drehte. Kein Wort wechselte sie mit Helena, und diese traute sich nicht, etwas zu sagen.
Magda und Hildegard kehrten zurück.
»Ännlin, sei so gut und hol Wein aus dem Keller. Mein Rücken schmerzt heute wieder mehr. Und nimm Helena mit«, ächzte Hildegard, während Magda das Drehen der Spieße übernahm. Die gebratenen Hühner rochen so lecker, dass Helena schon wieder Hunger verspürte. Aber davon würde wohl kaum etwas für die Mägde abfallen.
Wortlos drückte Ännlin Helena drei Steinkrüge in die Hand, nahm eine Fackel aus der Wandhalterung und verließ eiligen Schrittes die Küche, sodass Helena Mühe hatte hinterherzukommen. Das Mädchen lief über den Hof zu einem Nebengebäude, ließ die schwere Holztür aufschwingen und betrat die Diele.
Allerhand Werkzeuge waren hier verstaut: Pickel, Häpen, Karsten und Schaufeln. Bütten für die Trauben, wenn die Weinlese begann, standen säuberlich aneinandergereiht an der einen Wand. Den Großteil des Raumes nahmen aber zwei Keltern ein. Die gewaltigen Baumpressen mit ihren schweren Steinen an den Kelterbäumen forderten die Arbeitskräfte gleich mehrerer Knechte.
Im Fußboden war ein schwerer Eisenring eingelassen, den Ännlin packte und die Luke zum darunterliegenden Keller öffnete. Grob behauene Steinstufen führten hinunter, und Helena musste achtgeben, wie sie ihre Füße im flackernden Schein der Fackel setzte, um nicht zu stürzen. Am Ende der Treppe lag ein langer Gang, in dem rechts und links große Weinfässer lagerten.
»Da, das zweite Fass links. Füll die Krüge«, befahl Ännlin unwirsch.
Helena stellte die Gefäße auf den Boden, das dritte hielt sie mit der rechten Hand unter das Spundloch. Mit der Linken versuchte sie den Spund herauszuziehen, doch er saß zu fest.
»Bist du zu irgendwas nutze?«, bellte Ännlin, steckte die Fackel in eine Wandhalterung und stieß Helena beiseite, die beinahe den Krug fallen ließ. Ännlin riss ihr das Steinzeug aus der Hand, hielt es unter das Spundloch und zog mit einer leichten Drehung den Spund heraus. Tief dunkelroter Wein ergoss sich in den Krug. Als er fast gefüllt war, verschloss Ännlin das Loch und befüllte den zweiten.
»Los, versuch’s noch mal.«
Helena hatte beobachtet, wie die junge Magd den Spund gedreht hatte, und so gelang es auch ihr, den Wein in den letzten Krug fließen zu lassen.
»Gut, du bist also doch nicht so dumm, wie du aussiehst«, räumte Ännlin schroff ein.
Helena fasste sich ein Herz. »Warum bist du so gemein zu mir? Du kennst mich doch gar nicht.«
»Lass uns gehen, die Herrschaften warten«, war alles, was sie zur Antwort bekam.
Eilig liefen sie über den Hof, bemüht, nichts zu verschütten, und brachten den Wein in die Küche, wo Magda und Hildegard ihnen wortlos die Krüge abnahmen und verschwanden.
»Die Hühner sind fertig. Du hältst die Spieße, und ich schiebe die Hühner herunter«, wies Ännlin Helena an. »Nimm den großen Lappen, der vor dem Ofen liegt, du verbrennst dir sonst die Hände«, fügte sie hinzu, dieses Mal klang ihre Stimme nicht ganz so barsch.
Als die älteren Mägde wieder in die Küche kamen, hatten Helena und Ännlin die Hühner auf zwei Platten verteilt und weiteres Brot gebrochen.
»Halte die Spieße über das Feuer, damit sie wieder sauber werden«, erklärte Ännlin. »Wenn die Herrschaften fertig sind und hier alles aufgeräumt ist, können wir essen. Und jetzt hilf mir, den Kessel über das Feuer zu hängen.«
Helena nickte stumm und ging ihr zur Hand. Wenn Ännlin wüsste, dass Helena schon etwas von dem Eintopf bekommen hatte, würde sie ihr bestimmt keinen zweiten Teller füllen.
Nach dem späten Mahl, zu dem sich auch die Knechte gesellten, überfiel Helena eine bleierne Müdigkeit. Magda bemerkte, dass das Mädchen kaum noch am Tisch die Augen offen halten konnte.
»Komm, ich zeige dir, wo wir schlafen.«
Mit schweren Gliedern stemmte sich Helena hoch und folgte Magda aus der Küche über den Hof zum Gesindehaus, wo sich die voneinander getrennten Schlafräume der Knechte und Mägde befanden. Es gab einfache saubere Strohlager mit Schaffellen auf dem Boden und in einer Ecke eine Waschschüssel. Die Notdurft wurde draußen hinter dem Gesindehaus verrichtet.
»Du schläfst dort hinten.« Magda deutete mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf die letzte Schlafstatt. »Morgen früh bekommst du etwas zum Anziehen und ein paar Stiefel. Ich hoffe, sie passen. Deine Vorgängerin hatte etwa deine Größe.«
»Was ist mit ihr?«
»Sie ist vor einem Monat gestorben. Hat den ganzen Herbst durch gehustet, und immer wieder kam das Fieber zurück. Gott hab sie selig, die alte Gundel.«
Helena sank auf ihr Strohlager, zog sich ein Schaffell über die Schultern und fiel in einen tiefen Schlaf, kaum dass sie ihr Haupt gebettet hatte. Sie bekam nicht mehr mit, wie sich nur wenig später auch die Mägde und Knechte zur Ruhe begaben.
Es war noch dunkel, als Hildegard sie wachrüttelte.
»Steh auf, Mädchen, es gibt viel zu tun.«
Helena rieb sich den Schlaf aus den Augen, musste sich erst zurechtfinden, wo sie war. Dann rappelte sie sich hoch und ging in die Ecke zu der Waschschüssel. Das eiskalte Wasser, das sie sich ins Gesicht spritzte, machte sie wach. Außer Hildegard und ihr war keine der übrigen Mägde mehr da.
»Los, beeil dich«, drängte Hildegard. »Hier sind ein paar Sachen zum Anziehen.«
Dankbar zog Helena den warmen, weiten Kittel über ihr Kleid, schlüpfte in die Stiefel, die ein wenig zu groß waren, aber wenigstens nicht löchrig.
Zum Frühstück gab es eine Schale Milch, einen Kanten Brot und einen Teller Brei. Schnell schlangen die Leute ihr Essen hinunter und gingen dann daran, ihr Tagwerk zu verrichten. Brotbacken, das Vieh versorgen, Messer schleifen, Kleider waschen und flicken. Die Zeit bis Mittag flog nur so dahin, und Helena war froh über die kleine Pause und ein karges Mahl, zu dem Dünnbier getrunken wurde.
»Bald ist Mariä Lichtmess«, erzählte Hildegard, »deshalb werden wir jetzt jede Menge Kerzen machen, um sie in der Kirche weihen lassen zu können. Der Herr hat einen Hammel schlachten lassen, aus dem Talg werden die Kerzen gemacht. Du wirst mir dabei helfen, Helena.«
Bis zum Abend hatten sie eine stattliche Anzahl Kerzen gefertigt. Helena verabscheute den Geruch des ranzigen Fetts, der an ihr zu haften schien wie Pech, und sie fragte sich, wie sie den Gestank jemals wieder loswerden würde.
»Heute wirst du gemeinsam mit Ännlin den Herrschaften das Abendbrot auftragen. Verschütte nichts und rede nur, wenn du angesprochen wirst«, trug Magda ihr auf.
Zum ersten Mal betrat Helena die Wohnstube der Familie Wengerter. Ein riesengroßer Tisch, rechts und links je eine lange Holzbank, am Kopfende ein Stuhl, auf dem Cuntz Platz genommen hatte. Rechts von ihm saß seine Schwester Agnes, neben ihr die sechs Kinder ihrer verstorbenen Schwägerin, fünf Jungen und ein Mädchen. Der Winzer würde wohl eine ordentliche Mitgift für seine Tochter bezahlen müssen. Kathrein hatte hervorstehende Zähne, die stark an ein Kaninchen erinnerten, war stämmig und hatte langweiliges mausbraunes dünnes Haar. Ein weiteres Paar saß mit seinen drei Kindern auf der Bank gegenüber. Das musste Gottfried, Cuntz’ Bruder, mit seiner Familie sein, von dem Magda ihr erzählt hatte.
Der Kachelofen, der von der Küche aus befeuert wurde, erfüllte die Wohnstube mit angenehmer Wärme. An den Wänden fanden sich schmiedeeiserne Halter für die Kerzen, die die Stube in ein schummriges Licht tauchten. An der Seite, die zum Hof zeigte, gab es mehrere Fenster mit Butzenscheiben. Darunter stand eine gepolsterte schwere Truhe, an der Wand daneben eine große Anrichte, auf der Teller und Becher aus Zinn standen, die Ännlin und Helena nun auf dem Tisch verteilten.
Cuntz besprach mit Gottfried die anstehenden Arbeiten auf dem Weinberg, während Agnes und ihre Schwägerin Elsa die Kinder zur Ordnung mahnten. Helena stellte den Teller vor Cuntz hin und spürte sie im selben Augenblick dessen Hand an ihrem Oberschenkel. Hastig wich sie zur Seite. Als sie wenig später mit Ännlin die dampfenden Schüsseln mit Fleisch hereinbrachte, ließ sie die Magd den Teller des Hausherrn füllen.
»Helena, bring uns Wein«, rief Cuntz.
Er hat bemerkt, dass ich ihm ausgewichen bin, dachte Helena. Mit zitternder Hand schenkte sie Wein in die Becher und brachte diese zum Tisch.
Prompt hielt Cuntz sie am Handgelenk fest, als sie den Becher vor ihn hinstellte.
»Ein hübsches Mädchen ist sie, nicht wahr, Gottfried? Sieh nur ihre Haarfarbe, das ist etwas ganz Besonderes.«
»Wie gemacht für die Freuden der Männer, vor allem wenn sie untenrum auch so aussieht«, grunzte Gottfried zustimmend und stieß ein keckerndes Lachen aus, was ihm einen bösen Blick seiner Frau einbrachte.
Agnes schien sich am Verhalten ihres Bruders nicht zu stören. Cuntz ließ Helena los und gab ihr noch einen Klaps auf den Hintern. Eilig folgte sie Ännlin zurück in die Küche. Cuntz jagte ihr Angst ein.
»Das hast du dir ja fein ausgedacht«, zischte Ännlin sie an.
»Ich weiß nicht, was du meinst«, antwortete Helena verwirrt.
»Tu nicht so, ich hab’s gleich gewusst, als du hier aufgetaucht bist. Machst dem Herrn schöne Augen. Aber ich sage dir, er teilt mit mir das Lager. Du wirst dich nicht dazwischendrängen.«
»Ich habe nicht die Absicht, mich dazwischenzudrängen, also lass mich in Frieden«, entgegnete Helena wütend, die begriffen hatte, warum die junge Magd sich ihr gegenüber so garstig zeigte, und drehte Ännlin den Rücken zu. Vermutlich bekam Ännlin Vergünstigungen für ihre Liebesdienste. Die warmen Stiefel sahen ziemlich neu aus.
An Mariä Lichtmess wurden die Kerzen zur Weihe in die Kirche von Neckargemünd gebracht. Helena blieb alleine in der Küche zurück, um große Hammelstücke über dem Feuer zu drehen, einen Bohneneintopf zu kochen und süßes Brot mit Mandeln und Äpfeln zu backen. Die Äpfel lagerten in Säcken im Nebengebäude, wo sich auch der Zugang zum Weinkeller befand. Helena nahm sich einen hölzernen Eimer für die Äpfel und lief über den Hof. Sie war gerade dabei, die Früchte aus einem Sack in den Eimer zu geben, als plötzlich ein Schatten durch die geöffnete Tür fiel. Helena sah auf. Cuntz stand da und betrachtete sie wie ein Händler ein junges Pferd. Eine Gänsehaut kroch über ihren Rücken, und ein eiserner Ring schien sich um ihre Brust zu legen.
Helena nahm den halb vollen Eimer, holte tief Luft und sagte mit fester Stimme: »Ich muss in die Küche, sonst brennt der Eintopf an.«
In dem Moment, als sie an ihm vorbeigehen wollte, hielt er sie fest, riss ihr den Eimer aus der Hand, die Äpfel kullerten über den gestampften Lehmboden. Ein leiser Aufschrei entfuhr ihr.
»Sei still!«, herrschte Cuntz sie an und griff schmerzhaft nach ihrer knospenden Brust. »Noch ein bisschen wenig, für meinen Geschmack, aber das wird schon noch«, raunte er ihr heiser und mit fauligem Atem zu, während er mit der anderen Hand an seiner Hose nestelte.
Angewidert drehte sie den Kopf zur Seite. »Herr, bitte nicht«, flehte Helena.
»Es wird dir gefallen, meine Hübsche.« Cuntz stieß sie plötzlich so heftig von sich, dass sie zu Boden fiel und mit dem Hinterkopf aufschlug. Für wenige Augenblicke war sie benommen. Mit einem Satz war er über ihr, presste mit den Knien ihre Arme auf den Boden und riss sich die Bruche vom Leib. Im nächsten Augenblick hatte er Helenas Kittel hochgeschoben, drückte ihr mit der linken Hand die Kehle zu und griff ihr mit seiner Rechten grob zwischen die Beine. Helena bekam fast keine Luft mehr, strampelte und wehrte sich verzweifelt gegen ihren übermächtigen Gegner.
Cuntz schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht, sodass ihr Kopf zur Seite flog, aber wenigstens hatte er ihre Kehle freigegeben. Würgend schöpfte sie Atem. Wie ein Aal wand sie sich unter ihm, bemüht, ihren Körper auf die Seite zu drehen, um Cuntz zu entkommen. Ihr beharrlicher Widerstand schien ihn jedoch nur noch mehr anzustacheln. So hatte sich Cuntz anscheinend die Sache vorgestellt. Lange genug hatte er auf eine solche Gelegenheit gewartet.
Dieses Mal schlug er härter zu. Helena verlor beinahe die Besinnung, goldene Punkte tanzten vor ihren Augen. Cuntz zwängte ihre Beine mit seinen Knien auseinander, und im nächsten Augenblick zerriss ein unbeschreiblicher Schmerz ihren Unterleib, als er in sie eindrang. Immer heftiger wurden seine Stöße, keuchend mühte er sich, an etwas anderes zu denken, als an das, was er mit Helena noch vorhatte, bevor sein Körper ihm einen vorzeitigen Strich durch die Rechnung machte. Das wäre zu schade.
Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis Cuntz endlich von ihr abließ. In aller Ruhe zog er sich an, klopfte den Staub von seinen Kleidern und setzte ein hämisches Grinsen auf.
»Vergiss die Äpfel nicht.«
Dann war er verschwunden. Leise begann Helena zu weinen. Vor Schmerzen, vor Demütigung, vor Verzweiflung. Stöhnend kam sie auf die Beine, zog ihr Kleid herunter und wischte sich schniefend die Tränen aus dem Gesicht.
Wie kann Ännlin daran nur Gefallen finden?, fragte sie sich erschüttert.
Als sie die verstreut herumliegenden Äpfel aufsammelte, spürte sie warmes Blut an sich herunterlaufen. Vorsichtig spähte sie durch die Tür, niemand war zu sehen. In der Nähe des Gebäudes war der Brunnen. Jeder Schritt dorthin bereitete ihr höllische Schmerzen. Sie stellte den Eimer mit den Äpfeln ab, ließ den Wassereimer an der Kette in den Schacht hinunter, wartete, bis er sich gefüllt hatte und zog ihn wieder nach oben. Sie raffte Kittel und Kleid zusammen und begann, sich mit dem eiskalten Wasser das Blut zwischen den Beinen abzuwaschen. Zuletzt kühlte sie ihre Wange. Der Schmerz ebbte langsam ab und senkte sich auf ein erträgliches Maß.
Zurück in der Küche war sie froh, alleine zu sein. Es roch leicht angebrannt. Schnell zog sie mit dem Haken den eisernen Topf zur Seite, verdünnte den Bohneneintopf mit zwei großen Krügen Wasser und rührte kräftig um. Die Hammelstücke schmorten über dem fast erloschenen Feuer, und Helena legte eilig Holz nach. Dann schnitt sie die Äpfel in grobe Scheiben, gab sie zu dem vorbereiteten süßen Teig, formte zwei große Laibe und schob sie in den Ofen. Während sie diese Arbeiten verrichtete, versuchte sie, das schreckliche Geschehen zu verdrängen. Doch die Angst, irgendwann erneut alleine auf Cuntz zu treffen, fraß sich wie ein Wurm in ihr Gehirn.
Sollte sie sich nachts davonstehlen? Aber wo sollte sie hin? Nach Hause? Nein, ihr Vater würde sie bestimmt zurückschicken. Wenn sie hierblieb, dann hätte sie wenigstens genug zu essen. Sie musste nur versuchen, Cuntz, so gut es ging, aus dem Weg zu gehen.
Als die Mägde und Knechte eintrudelten, ließ Helena sich nichts anmerken und hielt den Kopf gesenkt. Nur als Magda ihr auftrug, die Herrschaften mit ihr gemeinsam zu bedienen, wurde sie blass. Die alte Magd sah sie mit wissendem Blick an und nahm Helena beiseite.
»Du willst nicht in die Wohnstube, stimmt’s?«
Helena schluckte und nickte stumm.
Magda berührte sachte ihre Schulter, Bedauern lag in ihrer Stimme.
»Mädchen, ich weiß, warum du nicht dorthin willst«, raunte sie ihr leise zu. »Doch du kannst ihm nicht immer aus dem Weg gehen. Er wird es bemerken. Also, sei tapfer und komm mit. Je eher du es hinter dich bringst, desto besser.«
Helena biss die Zähne zusammen und half der alten Magd, die Herrschaften zu bedienen. Mit gesenktem Blick, um jeden Augenkontakt mit Cuntz zu vermeiden, stellte sie stumm die Teller auf den Tisch. Magda, die gute Seele, übernahm es, Cuntz’ Teller und Becher zu füllen.
Nach Mariä Lichtmess wurde das Deckmaterial, das zum Schutz der Weinreben vor dem Frost aufgebracht worden war, entfernt. Helena bekam Cuntz nur zu Gesicht, wenn sie das Abendbrot aufzutragen hatte, denn einer der Knechte lag mit Fieber nieder, und der Hausherr musste selbst im Weinberg mit Hand anlegen.
Die tägliche Arbeit lenkte Helena ab, nur nachts holten die Geschehnisse sie ein, Albträume plagten sie. Oft wachte sie schweißgebadet und mit rasendem Herzen auf, um erleichtert festzustellen, dass neben ihr nur Magda lag und leise schnarchte.
Der März näherte sich mit Riesenschritten, und die Arbeiten im Wingert wurden täglich mehr. Es wurde Zeit, die Weinstöcke zu beschneiden. Die Schösslinge des Vorjahres wurden entfernt und die Rebstöcke zurückgeschnitten. Helena und Ännlin folgten den Knechten, um die abgeschnittenen Wurzelschösslinge und das alte Rebholz aufzusammeln und zum Wohnhaus zu bringen. Auch Kathrein, Cuntz’ Tochter, musste mithelfen. Sie war ein mürrisches Kind und ließ sich Zeit mit dem Aufsammeln. In großen Bütten, die sie auf dem Rücken trugen, schleppten die Mädchen Ladung für Ladung vom Weinberg zu einem bereitstehenden Fuhrwerk. Wenn nichts mehr auf den Karren passte, brachte einer der Knechte die Fuhre mit der erlesenen Fracht zum Gut. Ännlin, die durch ihre Schwangerschaft immer schwerfälliger wurde, musste öfter stehen bleiben, um sich eine kurze Atempause zu gönnen.
»Kathrein, mach schneller, sonst werden wir nie fertig, ich kann bald nicht mehr«, meckerte Ännlin und griff sich mit der Hand in den Rücken, um ihn zu stützen.
»Du hast mir gar nichts zu sagen«, fauchte Kathrein zurück.
»Hör mal, Ännlin bekommt ein Kind, sie arbeitet schon schwer genug«, sprang Helena der Magd zur Seite. Seit Helena klargestellt hatte, nicht die Absicht zu haben, Ännlins Stelle in Cuntz’ Bett einzunehmen, kamen die Mädchen besser miteinander zurecht. »Siehst du nicht, dass es ihr nicht gut geht?«
»Und du erst recht nicht«, zischte Kathrein. »Wenn es euch nicht passt, sag ich meinem Vater, dass ihr mich die meiste Arbeit tun lasst. Dann wird er euch die Peitsche spüren lassen.«
Ännlin und Helena sahen sich an und verstanden sich auch ohne Worte. Kathrein war nicht nur faul, sondern auch gehässig. Es war besser, keinen weiteren Streit mit ihr vom Zaun zu brechen.
Die harte Arbeit und die drei täglichen Mahlzeiten ließen Helena kräftiger werden. Anfangs war sie todmüde und erschöpft nach dem Abendbrot am Küchentisch eingeschlafen und nicht mehr aufzuwecken gewesen. Josef, einer der Knechte, hatte sie manches Mal ins Nebengebäude getragen, ohne dass Helena davon irgendetwas mitbekommen hatte. Müde war sie zwar am Ende des langen Tages immer noch, aber sie spürte, wie sich ihr Körper an die schwere Arbeit gewöhnte und sich veränderte.
Nach dem Rebenschnitt folgte das Sticken. Jeder Weinstock wurde mit einem Pfahl versehen, den die Knechte mit der Häpe, einem sichelförmigen Haumesser, einschlugen. Die Aufgabe der Mädchen war es, die zu einem Kreis gebogenen Tragreben mit Strohbändern an den Pfahl zu binden.
Nach einem harten Arbeitstag im April befanden sich die Knechte und Mägde auf dem Heimweg vom Wingert. Es war schon dämmrig, und sie hatten noch ein gutes Stück Weg vor sich, als Josef bemerkte, dass er seine Häpe nicht bei sich trug.
»Helena«, bat der alte Knecht, »sei so gut und geh zurück zur letzten Reihe, die wir gestickt haben. Dort muss ich meine Häpe liegen gelassen haben. Meine alten Knochen schaffen das heute nicht mehr.«
Helena, die Josef ins Herz geschlossen hatte, kehrte um und ging den Weg zurück in den Weinberg. Wie Josef vermutet hatte, lag das Haumesser am Ende der letzten Rebstockreihe. Helena hob es auf, steckte es seitlich an ihren einfachen Gürtel und beeilte sich, nach Hause zu kommen, denn inzwischen war es fast dunkel geworden.
Pferdegetrappel drang an ihre Ohren, und Helena hielt sich an der Seite des Weges, um nicht unter die Hufe zu geraten. Als der Reiter sie beinahe erreicht hatte, erschrak sich das Pferd und scheute.
»Hoooh, mein Guter, was hast du denn?«
Die Stimme des Reiters verursachte Helena einen Schweißausbruch. Angst überfiel sie, denn sie gehörte niemand anderem als Cuntz Wengerter. Schnell drückte sie sich zwischen zwei Büsche, hoffte, er würde sie nicht bemerken. Doch es war bereits zu spät. Das Pferd hatte sich wieder beruhigt, und sein Reiter die Ursache des Scheuens entdeckt.
»Sieh mal einer an, wen haben wir denn da? Was machst du hier draußen ganz alleine?«, fragte Cuntz mit falscher Freundlichkeit.
»Ich habe Josefs Häpe aus dem Wingert geholt, Herr«, antwortete Helena und merkte, wie ihre Stimme zitterte.
»Soso, das ist aber nett von dir. Bestimmt bist du auch zu mir jetzt ein wenig nett.«
Mit einem Satz sprang er vom Pferd, packte Helena an den Haaren, riss das Kleid über ihrer Brust entzwei und zwang sie auf die Knie. Mit fliegenden Fingern öffnete er seine Hose, zerrte an der Kordel seiner Bruche und presste ihren Kopf zwischen seine Beine. Der unbeschreibliche Gestank, der von Cuntz’ Gemächt ausging, verursachte Helena Brechreiz. Immer fester drängte der Winzer sich gegen ihr Gesicht, nahm ihr beinahe die Luft zum Atmen. Doch sein Griff um ihre Haare wurde lockerer, bald hielt er ihren Kopf nur noch mit den Händen fest, während er sich abmühte. Fieberhaft tastete sie nach der Häpe, bekam sie schließlich zu fassen und riss sie aus dem Gürtel. Mit aller Kraft schlug sie das Haumesser in Cuntz’ linken Oberschenkel. Blut spritzte, und Cuntz ließ mit einem gutturalen Aufschrei von ihr ab. Das Pferd sprang erschrocken zur Seite und galoppierte davon. Blitzschnell war Helena auf den Beinen und rannte um ihr Leben blindlings in den Wald. Seine wütenden Schreie verfolgten sie, trieben sie weiter. Sie stolperte über Wurzeln, stürzte und raffte sich wieder hoch. Einmal hielt sie kurz inne, lauschte, ob der Winzer ihr folgte. Doch außer dem Klopfen ihres Herzens und ihrer heftigen Atemzüge konnte sie nichts hören. Dann hetzte sie weiter, spürte kaum die Zweige, die ihr ins Gesicht schlugen. Das dichter werdende Unterholz zwang sie, immer öfter auszuweichen, und so wusste sie bald nicht mehr, in welche Richtung sie lief.
Irgendwann konnte sie nicht mehr und brach erschöpft und keuchend im Dickicht des Waldes zusammen. Es war stockfinster, und die Kälte der Nacht ließ sie schaudern. Angstvoll horchte sie in die Dunkelheit hinein, betete, Cuntz möge ihr nicht doch gefolgt sein oder Knechte ausgesandt haben, sie zu suchen. Ein Rascheln war zu hören. Stocksteif saß sie auf dem Waldboden, traute sich nicht zu atmen. Nein, das Rascheln hörte sich nicht nach menschlichen Schritten an, stellte sie erleichtert fest. Bestimmt hatte ein Tier das Geräusch verursacht. Nach einer Weile war sie sicher, außer ihr hielt sich kein menschliches Wesen hier auf.
Mühsam rappelte sie sich hoch. Wo sollte sie nun hin? Zu ihrem Vater konnte sie nicht, dort würde Cuntz als Erstes nach ihr suchen. Zudem hatte sie vollkommen die Orientierung verloren. Ihre Augen hatten sich allmählich an die Dunkelheit gewöhnt, trotzdem konnte sie nur mühsam etwas erkennen. Vorsichtig setzte Helena einen Fuß vor den anderen. Nach einer gefühlten Ewigkeit fand sie eine große Eiche, deren untere Äste gut erreichbar waren. Sie kletterte hinauf und setzte sich in eine Astgabel. Zu Tode erschöpft lehnte sie den Kopf an den mächtigen Stamm. Sie durfte nicht einschlafen, sonst würde sie herunterfallen. Ihr Gürtel war nicht lang genug, um sich damit an den Stamm zu binden. Trotzdem sie erbärmlich fror, fielen ihr immer wieder die Augen zu, und sie schreckte hoch, nur um kurz darauf wieder in einen Dämmerschlaf zu fallen.
Cuntz Wengerter raste vor Wut. Dieses kleine rothaarige Biest hatte ihn mit der Häpe ziemlich erwischt. Als sie in den Wald geflohen war, hatte er versucht, ihr nachzusetzen, was sich als sinnloses Unterfangen herausgestellt hatte. Unter starken Schmerzen und blutend, machte er sich hinkend auf den Weg nach Hause. Wenig später kamen ihm Agnes und die Knechte entgegen. Als das Pferd reiterlos auf den Hof galoppiert war, hatten sie Fackeln entzündet und sich auf die Suche nach Cuntz gemacht.
»Allmächtiger, was ist mit Euch passiert?«, rief einer der Knechte erschrocken, als er seinen Herrn erblickte.
»Dieser dämliche Gaul hat gescheut, als ein Wildschwein unseren Weg gekreuzt hat, und mich abgeworfen. Beim Sturz bin ich in mein Messer gefallen«, log Cuntz, der nicht die Absicht hegte, die Wahrheit zu sagen.
Der Knecht stützte den Winzer, der sich schwer auf ihn lehnte, und wartete, bis ein weiterer sich näherte.
»Hilf mir, greif dem Herrn unter den anderen Arm, damit wir ihn nach Hause schaffen können.«
Agnes schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als sie das Blut sah, das Cuntz’ Hose an einer Stelle dunkel gefärbt hatte. »Beeilt euch, schnell, er muss verbunden werden!«
Es war nicht mehr weit bis zum Weingut, und schließlich hatten sie Cuntz in der Eingangshalle auf ein paar von den Mägden eilig herbeigebrachten Decken niedergelegt. Agnes zerschnitt die Hose, die so oder so nicht mehr sauber geworden wäre, und begann, das Blut aus der Wunde zu waschen. Das Messer hatte einen tiefen, klaffenden Riss hinterlassen, aber wenigstens trat nur noch wenig Blut daraus hervor.
»Hans, hol den Bader«, befahl Agnes dem Knecht, der neben ihr stand.
»Ich brauche keinen Bader«, stöhnte Cuntz, »bringt mir einen Wundarzt, der mich wieder zusammenflickt.«
»Wo soll ich denn jetzt einen Wundarzt auftreiben?«, fragte Hans vorsichtig.
»In Heidelberg, dort findest du sicher einen«, riet Gottfried, der gerade hereinkam. »Los, spann den Wagen an!«
»Aber bis Heidelberg brauche ich jetzt in der Dunkelheit bald zwei Stunden«, wagte Hans zu widersprechen. »Vor Morgengrauen werde ich kaum zurück sein.«
»Was erlaubst du dir?«, fuhr Agnes auf. »Kein Wort mehr, und jetzt geh!«
Tatsächlich graute der Morgen, als Hans mit einem groß gewachsenen Mann, hager und gewandet in einen schwarzen Umhang, zurückkehrte. In der rechten Hand trug der Arzt eine lederne Tasche.
»Ihr seid also ein Wundarzt?« Misstrauen glomm in Agnes’ Augen.
Der Mann lächelte. »Nein. Ich habe Medizin studiert und gehöre nicht zur Zunft der Bader und Wundärzte. Ich bin ein Medicus.«
Agnes starrte ihn an. Ein Gelehrter. Aber verstand er auch das Handwerk eines Wundarztes, oder hatte er nur Bücher gelesen? Stumm sandte sie ein Stoßgebet zum Himmel, der Allmächtige möge ihr einen guten Mann ins Haus geschickt haben.
»Hat er viel Blut verloren?«, fragte der Medicus und ließ sich neben Cuntz nieder, der mit geschlossenen Augen dalag und leise stöhnte.
Solange Agnes auf den Medicus gewartet hatte, hatte sie Magda und Ännlin, die völlig außer sich war, angewiesen, ihrem Herrn ein ordentliches Lager in der Eingangshalle zu bereiten, denn er konnte unmöglich die Treppen zu den Schlafräumen hinaufsteigen. Agnes hatte die hochschwangere junge Magd geohrfeigt, weil sie zunächst nur weinend und zeternd herumgestanden hatte, ohne einen Finger zu rühren.
»Vermutlich. Seine Kleidung war blutdurchtränkt, aber die Blutung hatte fast aufgehört, als wir ihn hierherschleppten«, gab Agnes zur Antwort.
»Helft mir, ihn auf den Bauch zu drehen«, brummte er.
Der Medicus wusch die Wunde mit verdünntem Wein, tränkte einen Schwamm mit Mohnsaft und forderte Agnes auf, den Schwamm vor Cuntz’ Mund und Nase zu halten. Dann begann er, die Wunde zu nähen. Die Häpe hatte nicht nur die Hautschichten durchtrennt, sondern einen darunter liegenden Muskel nahezu gänzlich durchschnitten. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis er sein Werk beendet hatte. Doch schließlich verknotete er den letzten Faden und wischte sich die Schweißperlen von der Stirn. Cuntz hatte dank des Mohnsafts kaum etwas von der Prozedur mitbekommen.
»Ihr könnt den Schwamm von seinem Gesicht nehmen«, wies er Agnes an. »Er muss sich schonen, sonst platzt die Naht auf. Und reibt täglich Johanniskrautöl auf die Naht und darum herum. Er wird Schmerzen haben, wenn er zu sich kommt, dann gebt ihm Weidenrinde. Sie ist auch gut gegen Fieber.«
Umständlich kramte er in seiner ledernen Tasche herum, förderte schließlich Johanniskrautöl und zerkleinerte Weidenrinde zutage.
»Hier, einen halben Löffel davon setzt Ihr mit einem Becher kaltem Wasser auf. Erhitzt das Ganze langsam, bis es kurz aufkocht. Dann könnt Ihr den Sud durch ein Sieb gießen. Er kann drei oder vier Becher täglich davon trinken.«
»Habt Dank, und nun nennt mir die Summe, die ich Euch schuldig bin.«
»Für meine Dienste bekomme ich fünf Gulden.«
»Fünf Gulden! Das ist eine Menge Geld! Seid Ihr von Sinnen?«, begehrte Agnes auf.
»Ihr hättet auch einen Bader holen können, das wäre billiger gekommen«, antwortete der Medicus trocken. »Ich habe in Paris studiert, Anatomie und Chirurgie, nach den Lehren des berühmten Guy de Chauliac. Danach habe ich drei Jahre in Bologna verbracht. Ihr seht also, im Vergleich zu einem Bader verfüge ich über erheblich mehr Kenntnis des menschlichen Körpers, als es ein Bader je vermag. Zudem habe ich mit zwei verschiedenen Fäden genäht und unterschiedliche Nähte gesetzt, was ein Bader niemals könnte. Und nun bezahlt mir meine Arbeit und lasst mich zurück nach Heidelberg bringen.«
Agnes, die zwar nicht wusste, was genau die Worte ›Anatomie‹ und ›Chirurgie‹ bedeuteten, war trotzdem tief beeindruckt. Ein weit gereister Mann. Paris. Bologna.
»Ihr sollt Euren Lohn bekommen, werter Medicus«, erwiderte sie unterwürfig.
Sie wandte sich ab und verschwand, um kurz darauf mit einem Beutel voller Münzen zurückzukehren.
»Hier, zählt nach.«
Sie reichte dem Medicus den Beutel, der ihn nur abschätzend in der Hand wog und dann in seiner Tasche verschwinden ließ. »Ich vertraue Euch. Achtet darauf, dass er sich nicht zu früh zu viel bewegt. Wenn die Nähte reißen, wird er auf ewig ein nahezu steifes Bein zurückbehalten«, empfahl er mit eindringlicher Stimme.
Agnes nickte und ließ Josef holen, der den Medicus zurück nach Heidelberg kutschieren sollte.
Die ganze Fahrt über dachte Josef darüber nach, wo die junge Helena abgeblieben war. In all der Aufregung schien nur ihm aufgefallen zu sein, dass das Mädchen verschwunden war. Der alte Knecht war sicher, sein Herr hatte nicht die Wahrheit erzählt. Dessen vermeintlicher Sturz vom Pferd und das Verschwinden des Mädchens hingen zusammen. Darauf würde er seinen Tageslohn verwetten. Doch er würde sich hüten, seine Gedanken laut auszusprechen.
Endlich dämmerte der Morgen. Steif von der ungewohnten Haltung in der Astgabel und von der Kälte, kletterte Helena ungelenk von der Eiche hinunter. Sie musste los, bevor Cuntz mit den Knechten die Suche nach ihr begann. Wenn er sie zu fassen bekäme, würde er sie zu Tode peitschen lassen. Quälender Hunger und Durst trieben sie vorwärts, doch sie entdeckte nichts Essbares, nicht einmal einen Bach oder Tümpel, an dem sie ihren Durst hätte stillen können. Stunde um Stunde hastete sie weiter, blieb an Dornenranken hängen, die ihr den Kittel zerrissen. In ihren langen Haaren verfingen sich kleine Zweige. Erschöpft ließ sie sich am Stamm eines Ahornbaums nieder, um sich eine kurze Atempause zu gönnen. Bevor es Abend wurde, musste sie einen sicheren Schlafplatz gefunden haben. Mit schweren Gliedern stemmte sie sich hoch und schlug sich weitere Stunden durch den dichten Wald.
Am Nachmittag des nächsten Tages erreichte sie schließlich den Waldrand. Vorsichtig spähte sie hinter einer dicken Buche hervor. Ein weites Tal lag vor ihr. Vereinzelte Gebäude waren zu sehen, die von einer Mauer umgeben waren. Eine große steinerne Kirche ragte zwischen den Gebäuden empor. Den Hauptteil der dreischiffigen Basilika bildete das Langhaus, nördlich des Gebäudes befand sich die Schaffnei, wo der Schaffner den Zehnten für den Kurfürsten einzog. Helena erkannte, dass es sich um ein Kloster handelte. Ob man ihr dort Zuflucht gewährte? Sie hatte keine andere Wahl, verließ den Schutz des Waldes und stapfte den Hang hinunter. Wenigstens war die Sonne zum Vorschein gekommen und sandte ihre wärmenden Strahlen aus.
Sie war nicht mehr weit vom Kloster entfernt, als sie mit dem rechten Fuß in ein Loch trat und so unglücklich stürzte, dass die Häpe, die sie in ihrem Gürtel stecken hatte, ihr in den Oberschenkel fuhr. Der Schmerz ließ ihr beinahe die Sinne schwinden. Helena spürte, wie warmes Blut an ihrem Bein hinabrann. Mit schmerzverzerrtem Gesicht schob sie Kittel und Kleid nach oben. Das Haumesser hatte ganze Arbeit geleistet und steckte mit der gebogenen Spitze in ihrem Bein.
Helena holte tief Luft, packte die Häpe mit beiden Händen und zog sie heraus, was sie vor Pein aufschreien ließ. Ein Schnitt war nun zu sehen, aus dem beständig Blut sickerte. Stöhnend riss sie einen Streifen Stoff aus ihrem Kleid, band ihn fest über die Wunde. Mit zusammengebissenen Zähnen rappelte sie sich hoch, doch sie konnte kaum auftreten. Offenbar hatte sie sich auch den Knöchel verstaucht. So würde sie es nie bis zum Kloster schaffen. Wenigstens war nun die Blutung zum Stillstand gekommen. Schluchzend, mehr vor Verzweiflung als vor Schmerz, sank sie ins Gras, rollte sich zusammen und schloss die Augen.
Wie lange sie so gelegen hatte, vermochte Helena nicht zu sagen, als plötzlich Stimmen an ihre Ohren drangen. Sie mühte sich den Kopf zu heben, doch die anstrengende Flucht durch den Wald, Hunger und Durst hatten sie zu sehr geschwächt, sodass der Versuch misslang.
»Da liegt jemand«, hörte sie eine aufgeregte Stimme rufen.
Augenblicke später sahen zwei Nonnen auf Helena herunter. Eine von ihnen ließ sich neben ihr nieder und bemerkte das Blut an Helenas Kleidung.
»Schwester Innocentia, hilf mir«, forderte sie ihre Begleiterin auf.
»Ich bin Schwester Katharina. Kannst du aufstehen?«, wandte sie sich dann an Helena. Die Nonne hatte ein gütiges Gesicht, voller kleiner Fältchen, die noch mehr zu werden schienen, wenn sie lächelte.
»Ich weiß nicht, mein Bein …«, stöhnte Helena schwach. Tränen der Erleichterung stiegen in ihre Augen, aber tapfer unterdrückte sie ein Schluchzen.
Die beiden Nonnen griffen ihr unter die Arme und halfen ihr auf. Gestützt von den Zisterzienserinnen humpelte sie zum Kloster, wo man sie auf ein einfaches Bett legte.
»Lass mich dein Bein sehen«, forderte Schwester Katharina das Mädchen auf.
Helena raffte ihr Kleid und ließ die Nonne einen Blick darauf werfen.
»Du hast Glück gehabt, der Schnitt ist nicht allzu tief. Schwester Innocentia, bring mir Johanniskraut, damit ich die Wunde versorgen kann, Beinwellsud und dicke Leinenstreifen, um den geschwollenen Knöchel zu wickeln.«
Besorgt sah Schwester Katharina auf das blasse Mädchen hinunter. Ein heißer Auszug aus Hagebutten, Frauenmantel und Brennnesseln würde ihm sicher guttun. Als ihre Mitschwester mit dem Johanniskrautöl zurückkam, behandelte Schwester Katharina Helenas Verletzung, legte einen Verband an und bat ihre Ordensschwester, den Trank aufzugießen.
»Ihr seid sehr gütig.« Helena rang sich trotz der Schmerzen ein dankbares Lächeln ab, und die Nonne strich ihr sanft über das Haar.
Während Helena in vorsichtigen kleinen Schlucken das heiße Gebräu zu sich nahm, berichtete Schwester Katharina der Äbtissin über den unverhofften Gast. Maria Ignatia, Äbtissin des Klosters Lobenfeld, trat in ihrem schwarzen Habit an Helenas Lagerstatt.
»Wer bist du, mein Kind?«
»Mein Name ist Helena, ehrwürdige Mutter.«
Das Johanniskraut hatte bereits seine Wirkung entfaltet und machte die Schmerzen erträglich.
»Wo kommst du her, und was ist mit dir geschehen?«
»Ich bin gestolpert und in ein Haumesser gefallen.« Helena verschwieg ihre Herkunft, weil sie fürchtete, die Nonnen würden sie zurückschicken. Am besten, sie sagte gar nichts mehr.
»Was führte dich allein in diese Gegend? Und wozu trägt ein Mädchen ein Haumesser? Kommst du von einem Wingert?«
Helena blieb stumm.
Mit hochgezogenen Brauen sah die Äbtissin ihre Mitschwestern an. Beide schürzten die Lippen, schüttelten nur unmerklich den Kopf. Äbtissin Maria Ignatia traf eine Entscheidung.
»Du kannst hierbleiben, bis es dir besser geht, dann werden dich Schwester Innocentia und Schwester Katharina zurückbringen. Es sollte nicht allzu schwer werden, herauszufinden, wohin du gehörst. Ein Mädchen mit deiner Haarfarbe ist selten. Allerdings wäre es mir lieber, du sagst es uns selbst«, fügte sie mit einem feinen Lächeln hinzu.
Helena schüttelte den Kopf. »Bitte, schickt mich nicht fort«, flehte sie leise.
Bevor die Äbtissin etwas sagen konnte, mischte sich Schwester Katharina ein, die das Mädchen schon vom ersten Augenblick an ins Herz geschlossen hatte. Sie war zwar die Älteste des Klosters, doch ihre Augen blickten immer noch wach und klar. Ihr Vater hatte sie schon als Mädchen ins Kloster gesteckt, und der Wunsch, einmal eigene Kinder zu haben, war dadurch nie in Erfüllung gegangen.
»Ehrwürdige Mutter, gewährt Ihr mir einen Augenblick?«
Die Äbtissin nickte gnädig und trat ein paar Schritte zur Seite.
»Ich glaube, man hat ihr Gewalt angetan. Ihre Kleider sind zerrissen«, flüsterte Schwester Katharina leise, »und sie verschweigt bestimmt aus diesem Grunde, von wo und vor allem vor wem sie geflohen ist. Ich bitte Euch, lasst das Mädchen hierbleiben. Wir könnten eine neue Laienschwester gebrauchen.«
Die Worte ließen die Äbtissin schmunzeln. »Schwester Katharina, du wünschst dir eine Laienschwester, damit du im Klostergarten zwei weitere Hände hast, die mitanpacken können, nicht wahr?«
Die Nonne senkte beschämt den Blick. »Ihr habt mich durchschaut, ehrwürdige Mutter. Vergebt mir meinen Eigennutz.«
»Wenn Helena vor ihrem Lehnsherren geflohen ist, wird er sie suchen«, überlegte Äbtissin Maria Ignatia. »Ich weiß nicht, ob das Mädchen hierher passt, es hat etwas Trotziges an sich.« Sie seufzte leise. »Sie darf das Kloster zunächst nicht verlassen.«
Schwester Katharina sah auf. »Soll das etwa heißen …?«
»Ja, sie kann bleiben, ich nehme sie auf. Zwei Jahre soll sie hier mit uns leben und arbeiten, den Habit der Laienschwester tragen und den Vorsatz hegen, Gott zu dienen. Nach diesen zwei Jahren soll sie das feierliche Gelübde ablegen. Höre ich nur eine einzige Klage über die Arbeit, die wir ihr geben, verweise ich sie noch am selben Tag des Klosters.«
Schwester Katharina sank auf die Knie, küsste den Ring an der der Hand der Äbtissin. »Ich danke Euch, ehrwürdige Mutter.«
Helena konnte kaum fassen, dass sie bleiben durfte. Aber die Bedingung, die daran geknüpft war, ließ sie nachdenklich werden. Ein Leben im Kloster? Niemals heiraten, niemals eigene Kinder haben. Sie dachte an ihre Geschwister, die sie vielleicht nie wiedersehen würde, wenn sie das Kloster nicht verlassen durfte. Zumindest vorerst. Lange überlegen musste Helena allerdings nicht. Wenn sie das Angebot ausschlug, was dann? Wo sollte sie hin? Nach Hause konnte und wollte sie nicht. Hier, hinter den Klostermauern, war sie zumindest sicher. Unbewusst griff sie nach dem Lederbändchen an ihrem Hals, tastete nach dem Püppchen, das sie nun schon so lange trug.
»Was ist das?«, wollte Schwester Katharina wissen, die ihr beim Anziehen des Habits half.
»Ein Geschenk, das ich hüte wie einen Schatz. Bitte, nehmt es mir nicht weg«, bettelte sie.
Katharina runzelte die Stirn.
»Ich weiß nicht, es gehört sich nicht, Schmuck zu tragen, auch nicht für eine Laienschwester, und sei er noch so schlicht.«
Ängstlich umklammerte Helena das Püppchen, Tränen traten ihr in die Augen. »Die Prinzessin hat mir die Puppe geschenkt«, flüsterte sie.
Für einen Moment zweifelte Schwester Katharina an ihren Worten, doch sie erkannte keine Lüge in Helenas Augen.
»Du sprichst von Prinzessin Mechthild, die Tochter unseres Kurfürsten?«, fragte sie immer noch etwas ungläubig.
Helena nickte und erzählte von dem Geschehen, das sich vor drei Jahren zugetragen hatte. Schließlich rang sich die Nonne dazu durch, ihr die Kette zu lassen. Unter dem Habit würde sie nicht zu sehen sein. Doch sie holte trotzdem die Erlaubnis der Äbtissin ein.
»Wir besitzen keine weltlichen Dinge«, beschied Äbtissin Maria Ignatia ihr streng, als ob diese das nicht wüsste. Wobei das nicht ganz richtig war. Witwen, die sich ins Kloster zurückzogen, durften einige wenige persönliche Dinge behalten. Aber Helena war keine Witwe.
»Ehrwürdige Mutter, bitte gewährt ihr diese Ausnahme. Das arme Kind hat viel durchgemacht. Vielleicht kommt einmal der Tag, an dem sie nicht daran festhalten muss, aber im Augenblick …«
Die Hartnäckigkeit Katharinas ließ die Äbtissin erweichen. Ihre Mitschwester hatte offenbar in kürzester Zeit einen regelrechten Narren an dem Mädchen gefressen.
So begann Helenas Zeit im Kloster Lobenfeld. An den schwarzen Habit gewöhnte sie sich schnell, einzig und allein der weiße Schleier, der sie als Laienschwester kennzeichnete und den sie tragen musste, ließ sie jeden Tag hadern, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hatte. Warum hatte Gott ihr eine solch außergewöhnliche Haarfarbe geschenkt, wenn sie ihre Haare unter dem Schleier verbergen sollte? Zudem musste sie sich überwinden, mitten in der Nacht zur ersten Hore aufzustehen. Doch nach und nach gewöhnte sie sich auch daran. Achtmal am Tag sangen die Ordensschwestern Psalmen, und es wurde gebetet. Singen lag Helena nicht, denn ihr selbst fiel auf, dass sie die Töne nicht traf. Oftmals sang sie ganz leise oder bewegte nur die Lippen, lauschte lieber den Stimmen der anderen. Die Mahlzeiten wurden schweigend eingenommen, auch dies empfand Helena als belastend. Verstieß jemand gegen diese Regel, wurde er meist mit Essensentzug bestraft. Nur ein einziges Mal hatte Helena diese Regel gebrochen und dann nie wieder.
Was sie wirklich liebte, war die Arbeit im Klostergarten, wo Gemüse und Kräuter angepflanzt wurden. Schwester Katharina war ein unerschöpflicher Quell des Wissens, was die Arzneipflanzen, die im Garten gehegt und gepflegt wurden, anbelangte. Helena lernte schnell, und Schwester Katharina bereitete es ungemeine Freude, das Mädchen an ihren Kenntnissen teilhaben zu lassen.
»Schwester Katharina«, sagte Helena eines Tages, »ich möchte gerne Latein lernen. Nicht nur die Namen der Arzneipflanzen. Könnt Ihr mich das lehren?«
Sie als Laienschwester betete das Vaterunser und den Rosenkranz auf Deutsch. Die Chorschwestern sangen auf Latein, und auch die Tischgebete wurden auf Latein gesprochen.
Verblüfft sah Katharina das Mädchen an. »Ich denke, das kann ich schon«, erwiderte sie bedächtig, »ich werde aber zuerst mit unserer ehrwürdigen Äbtissin darüber sprechen.«
Äbtissin Maria Ignatia entsprach Helenas Wunsch, nur sollte sie darüber hinaus ihre täglichen Arbeiten nicht vernachlässigen. So lehrten die Schwestern sie nicht nur die Worte, sondern brachten ihr auch Lesen und Schreiben bei. Die Buchstaben konnte sie schon, da ihr Freund von der Pfarrschule ihr diese bereits gezeigt hatte. Je mehr Helena lernte, desto größer wurde ihr Wissensdurst. Eine völlig neue Welt erschloss sich ihr, als ihr das Lesen immer leichter fiel. Weltliche Bücher gab es im Kloster nicht, aber in der Klosterchronik zu lesen und zu erfahren, was viele Jahre vor ihrer Geburt vor Ort geschehen war, empfand Helena als ungemein packend.
»Möchtest du dich im Illustrieren versuchen?«, lächelte Schwester Innocentia, als sie sich im Skriptorium dem Tisch näherte, an dem Helena saß und wie selbstvergessen auf einem kleinen Stück Papier eine Bordüre malte.
Helena sah auf, verdeckte beschämt ihr Werk mit der gewölbten Hand, um die Tinte nicht zu verwischen. »Ich bitte um Vergebung, aber ich habe die Seite, die Ihr mir zum Kopieren aufgegeben habt, schon fertig. Und ich wollte nur versuchen, ob auch ich so schön malen und verzieren kann wie Schwester Agatha.«
»Lass sehen, was du gemalt hast«, forderte Innocentia.
Helena hob die Hand, damit die Schwester einen Blick auf das Papier werfen konnte.
»Das ist wunderbar«, flüsterte die Nonne ergriffen. »Du besitzt eine Gabe, Helena.«
Auf dem kleinen Stück Papier waren verschlungene Blätterranken zu sehen, zwischen denen winzige Rosenblüten hervorlugten. Kleine Schmetterlinge flatterten um die filigranen Blüten, auf einem herzförmigen Blatt entdeckte Schwester Innocentia eine Schnecke.
»Aber so gut wie Schwester Agatha werde ich nie malen können«, seufzte Helena.
Die Nonne war zwar ganz anderer Meinung, behielt diese aber für sich. »Das Malen bereitet dir Freude, nicht wahr?«
Helena nickte stumm.
»Was meinst du, soll ich mit unserer ehrwürdigen Äbtissin sprechen, ob du mehr Zeit im Skriptorium verbringen darfst, um mehr Übung zu bekommen?«
Die Versuchung war groß, aber Helena liebte auch die Arbeit im Kräutergarten. Zudem fühlte sie sich Schwester Katharina verpflichtet, die sich damals dafür eingesetzt hatte, dass Helena im Kloster bleiben durfte.
»Nein«, antwortete Helena schließlich, »es gibt noch so viel im Garten zu tun, bevor der Winter kommt, und ich möchte Schwester Katharina nicht im Stich lassen. Aber ich danke Euch für Eure gute Absicht.«
Ein schelmisches Funkeln schlich sich in Schwester Innocentias Augen. »Sehr rücksichtsvoll von dir. Und im Winter wirst du auf jeden Fall mehr Zeit finden, denn dann gibt es im Garten kaum etwas zu tun.« Sie nahm das bemalte Papier an sich und verschwand mit einem verschwörerischen Lächeln auf den Lippen.
Am nächsten Tag bestellte Äbtissin Maria Ignatia die Laienschwester nach der Sext zu sich.
»Mir wurde zugetragen, Gott hat dir ein Talent mitgegeben. Und in der Tat, das hast du.«
Sie klopfte vorsichtig mit dem rechten Zeigefinger auf ein Stück Papier, das vor ihr auf dem Tisch lag. Helena erkannte ihre Zeichnungen.
»Schwester Innocentia«, stellte sie mit leiser Stimme fest und schlug die Augen nieder.
»Ja, ganz recht. Ich wünsche, dass du mehr Zeit im Skriptorium verbringst, um deine Kunstfertigkeit zu verbessern.«
»Aber …«, traute sich Helena zu sagen, wurde jedoch sofort unterbrochen.
»Widersprich mir nicht! Ich weiß, was du sagen möchtest. Schwester Innocentia hat mich darüber unterrichtet, dass du Schwester Katharina nicht im Stich lassen willst. Das ehrt dich, und nichts anderes habe ich von dir erwartet. Mehr Zeit im Skriptorium bedeutet nicht, du sollst gar nicht mehr im Garten arbeiten. Ich besitze seit einiger Zeit die Kopie einer Handschrift, die von der Benediktinerin Hildegard von Bingen stammt. ›Causae et Curae‹ soll auch von uns kopiert werden, und ich wünsche deine Mithilfe bei den Illustrationen.«
Helena wusste nicht, was sie sagen sollte. Was für eine Aufgabe! Und wie viel sie dabei lernen konnte! Alles über die Entstehung und Behandlung von Krankheiten, was Hildegard von Bingen zusammengetragen hatte. Schwester Katharina hatte Helena von der klugen Heilerin, die vor langer Zeit gelebt hatte, erzählt. Freudentränen traten in Helenas Augen, und sie spürte einen Kloß im Hals. Unvermittelt sank sie auf die Knie, berührte mit den Lippen den Saum des Gewandes der Äbtissin.
»Ich danke Euch, ehrwürdige Mutter«, brachte sie mit erstickter Stimme hervor.
»Steh auf, mein Kind«, sagte Äbtissin Maria Ignatia sanft, »Gott hat dich zu uns gesandt, weil er wollte, dass deine Gabe nicht vergeudet wird.«
So half Helena nicht nur im Kräutergarten, sondern malte und zeichnete Pflanzen und deren für die Medizin verwendete Teile. Helena erlernte Dinge, von denen sie nie zu träumen gewagt hätte. Als Kind aus armen Verhältnissen lesen und schreiben und Latein lernen zu dürfen, war ein wahres Gottesgeschenk. Stumm dankte sie jeden Abend auf Knien ihrem Schöpfer, den Schwestern und der Äbtissin, bevor sie ihren Kopf auf das einfache Lager sinken ließ.
Noch Wochen später, nachdem der Medicus den Winzer zusammengeflickt hatte, packte Cuntz die Wut, wenn er an Helena dachte. Sein Bein würde nie wieder so beweglich sein, und der Schmerz war sein ständiger Begleiter. Er verfluchte den Medicus, den er einen Quacksalber schimpfte, obwohl es seine eigene Schuld war, wenn er nun den Rest seines Lebens hinkte. Entgegen den Anordnungen hatte er sich viel zu früh und viel zu viel bewegt. Die Wunde war zwar gut verheilt, aber durch die ständige Unruhe hatte der Muskel nicht ordentlich zusammenwachsen können, und darüber hinaus zierte seinen Oberschenkel nun eine hässliche Narbe.
Sein erster Ritt führte ihn nach Neckargemünd, wo er Wigbert aufsuchte. Am Tag nach seiner Verwundung war jedem das Verschwinden der jungen Magd aufgefallen, und Cuntz’ Erklärung lautete, sie hätte sich einfach aus dem Staub gemacht. Aber dies würde er keinesfalls hinnehmen und sich selbst darum kümmern, sie zurückzuholen, sobald er wieder in der Lage dazu war. Schließlich sollte sie die Schulden ihres Vaters bei ihm abarbeiten.
Er fand Wigbert auf einem Feld, das er gemeinsam mit seinem Sohn Siegfried beackerte. Zuvor war Cuntz bei der armseligen Kate gewesen und hatte dort niemanden angetroffen. Eine Nachbarin hatte ihm geraten, es auf den Feldern vor den Stadttoren zu versuchen. Cuntz war es herzlich egal, als er sah, wie der Tagelöhner mühsam die zweite Heumahd einbrachte und ritt rücksichtlos ein paar Garben um.
»Herr, haltet ein«, brüllte Wigbert entsetzt, als er den Reiter über das Feld galoppieren sah.
Sein Augenlicht war schwach, daher konnte er den Reiter nicht gleich erkennen. Erst als dieser sein Pferd im letzten Moment zügelte und vor ihm zum Stehen brachte, wusste der Bauer Bescheid. Die Flanken des Pferdes bebten von dem scharfen Ritt, die Nüstern waren bis aufs Äußerste gebläht, der Körper schweißbedeckt und vom Maul troff weißer Schaum.
»Wo ist sie?«, herrschte Cuntz den Tagelöhner an und stieg vom Pferd. Ein stechender Schmerz durchfuhr sein linkes Bein.
»Wo ist wer? Ich fürchte, ich kann dir nicht ganz folgen«, antwortete Wigbert und bekam weiche Knie, als er den Zorn in Cuntz’ Augen sah.
»Stell dich nicht dümmer, als du bist. Helena, dieses kleine Biest.«
»Aber wieso, du hast sie doch mitgenom…« Wigbert dämmerte, was geschehen sein musste. Seine Tochter hatte offenbar die Beine in die Hand genommen und das Weite gesucht. Und natürlich schlussfolgerte Cuntz, Helena wäre nach Hause gerannt.
»Sie ist nicht hier, Cuntz.«
Cuntz rammte ihm die Faust ins Gesicht. Wigberts Lippe platzte auf, und er taumelte zurück. »Das sehe ich selbst, du Nichtsnutz. Wo ist sie?«
Siegfried war herbeigeeilt, als er sah, wie Cuntz seinen Vater schlug. »Was ist hier los, Vater?« Tapfer stellte sich der Junge vor ihn.
Wigbert wischte sich mit dem Handrücken das Blut vom Mund. »Deine Schwester ist wohl abgehauen.«
»Aber, Herr«, wandte sich Siegfried mit dünner Stimme an Cuntz, »sie ist nicht nach Hause gekommen. Seit sie mit Euch fort ist, haben wir sie nicht wiedergesehen.«
Cuntz ging nicht darauf ein und würdigte den Jungen keines Blickes. »Deine Schulden, Wigbert, sind noch längst nicht beglichen. Ich werde dafür sorgen, dass ich zu meinem Recht komme.« Mit Mühe erklomm Cuntz sein Pferd, wendete und galoppierte davon. Irgendwo musste sich diese kleine rothaarige Hure doch verstecken, und er würde sie finden, ganz gleich, wie lange es dauerte. Derweil konnte er Anstrengungen unternehmen, Wigbert das Leben schwer zu machen.