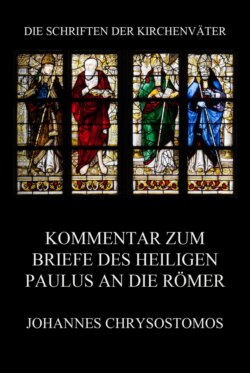Читать книгу Kommentar zum Briefe des Heiligen Paulus an die Römer - Johannes Chrysostomos - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ZWEITE HOMILIE. * Kap. I, V. 1—7. *
Оглавление1.
Kap. I, V. 1—7.
V. 1: „Paulus, ein Diener Jesu Christi, berufener Apostel, auserwählt für das Evangelium Gottes“, V. 2: „welches er zuvor durch seine Propheten in den heiligen Schriften versprochen hatte.“
Moses hat den fünf von ihm geschriebenen Büchern nirgends seinen Namen beigesetzt, desgleichen nicht die Geschichtschreiber nach ihm; aber auch Matthäus nicht, noch Johannes noch Markus noch Lukas. Dagegen setzt der hl. Paulus allen seinen Briefen seinen Namen voran. Warum? Weil die andern an Anwesende schrieben; darum war es unnötig, sich selbst als anwesend erscheinen zu lassen, Paulus aber schickte seine Schreiben in die Ferne und in Briefform; darum war die Beisetzung seines Namens notwendig. Wenn er dies nur im Briefe an die Hebräer nicht tat, so geschah es mit Vorbedacht. Er war nämlich den Juden verhaßt; damit sie nun nicht, wenn sie seinen Namen hörten, von vorneherein für seine Rede unzugänglich wurden, verschwieg er ihnen denselben und verschaffte sich so bei ihnen Gehör. Was die Propheten und Salomon betrifft, die ihre Namen beisetzten, so überlasse ich es euch, zu untersuchen, warum es die einen taten, die andern nicht. Ihr müßt ja nicht alles von mir erfahren, sondern sollt auch selbst euren Geist anstrengen, damit ihr nicht zu denkfaul werdet.
„Paulus, ein Diener Jesu Christi.“
— Warum änderte wohl Gott den Namen des Apostels und nannte ihn, den Saulus, Paulus? — Damit er nicht deswegen als geringer angesehen werde unter den Aposteln, sondern dieselbe Auszeichnung besitze wie das Haupt der Jünger und so ihrem Kreise um so enger einverleibt werde. Christi „Diener“ nennt er sich, und das nicht ohne Grund. Es gibt verschiedene Arten, (Gott gegenüber) Diener zu sein. Die eine schreibt sich von der Erschaffung her; in diesem Sinne heißt es: „Alles dienet dir“ 21, ebenso: „Mein Diener Nabuchodonosor“ 22; denn das Werk, das jemand geschaffen hat, ist zu seinem Dienste da. Eine andere Art, Diener zu sein, kommt vom Glauben her; davon heißt es: „Dank sei aber Gott, daß ihr Knechte der Sünde gewesen, aber von Herzen gehorsam geworden seid jenem Lehrinhalte, in dem ihr unterwiesen wurdet“ 23. Eine dritte Art gründet sich auf eine besondere Lebensführung. In diesem Sinne heißt es: „Moses, mein Diener, ist gestorben“ 24. Wenn auch alle Juden Gottes Diener waren, so leuchtete doch Moses ganz besonders hervor durch seine Lebensführung. Da nun Paulus nach allen diesen Beziehungen ein Diener (Gottes) war, darum setzt er diesen Namen als seine höchste Würde voran, indem er spricht: „Ein Diener Jesu Christi“. Diese zwei Namen reiht er so aneinander, daß darin ein Aufsteigen von unten nach oben liegt. Denn der Name Jesus kam durch einen Engel vom Himmel herab, als er aus der Jungfrau geboren ward; Christus aber heißt er von der Salbung, die ebenfalls seinen (angenommenen) Leib betrifft. — Mit was für Öl, fragt man, ist er dann gesalbt worden? — Nicht mit wirklichem Öl, sondern mit dem Geiste. Solche pflegt die Hl. Schrift „Gesalbte“ zu nennen. Das wichtigste bei der Salbung ist ja der Geist; das Öl gehört dazu nur nebenbei. Und an welcher Stelle der Schrift werden solche, die nicht mit Öl gesalbt sind, doch „Gesalbte“ genannt? Da, wo es heißt: „Tastet nicht an meine Gesalbten und tuet kein Leid meinen Propheten!“ 25. Damals gab es gar nicht die Zeremonie der Ölsalbung.
„Berufener Apostel.“
— Ständig nennt sich Paulus „berufen“. Er bringt damit seine Dankbarkeit zum Ausdruck: er habe nicht das Heil gesucht und (durch eigenen Fleiß) gefunden, sondern er sei von Gott berufen worden und habe nur dem Ruf Folge geleistet. In demselben Sinne nennt er auch die Christen „berufene Heilige“. Freilich waren diese nur zum Glauben berufen; ihm dagegen war noch etwas ganz anderes anvertraut worden, das Apostelamt nämlich, ein unschätzbar hohes Gut, größer als alle Gnadengaben und sie alle umfassend. Was braucht man mehr davon zu sagen, als daß es das Amt ist, welches Christus selbst auf Erden ausübte und das er bei seinem Scheiden ihnen übergab? Darum ruft Paulus, die Würde der Apostel preisend: „Wir sind also Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt“ 26, — d, h. wir stehen an Christi Stelle.
„Auserwählt für das Evangelium Gottes.“
— Wie in einem Haushalte für die verschiedenen Verrichtungen je eine Person bestimmt ist, so sind auch in der Kirche die verschiedenen Ämter an einzelne Personen verteilt. Es scheint mir übrigens, daß der Apostel nicht bloß andeuten will, er sei wie durch das Los berufen worden, sondern er sei von oben dazu vorausbestimmt gewesen. So sagt auch Jeremias, Gott habe zu ihm gesagt; „Eh’ du hervorgingest aus dem Mutterschoß, heiligte ich dich und verordnete dich zum Propheten für die Völker“ 27. Denn da er an eine stolze, prunkvolle Stadt schrieb, lag ihm daran, nach jeder Richtung zu zeigen, daß seine Berufung Gottes Werk sei; Gott habe ihn berufen, Gott habe ihn auserwählt. Das tut er, um seinem Briefe Glaubwürdigkeit und gute Aufnahme zu sichern.
„Für das Evangelium Gottes“
Also nicht Matthäus allein ist ein Evangelist oder Markus, wie auch Paulus nicht allein ein Apostel ist, sondern auch die andern; aber er heißt in besonderer Weise Apostel, wie jene „Evangelisten“. „Evangelium“ frohe Botschaft — nennt er es, nicht bloß mit Rücksicht auf die bereits empfangenen Güter, sondern auch mit Rücksicht auf die, welche es für die Zukunft im Jenseits in Aussicht stellt. Wieso kann er aber sagen, daß Gott durch ihn verkündigt werde? „Auserwählt für das Evangelium Gottes.“ — Nun, Gott, war ja auch vor dem Evangelium den Menschen bekannt, aber eigentlich doch nur den Juden, und auch denen allen nicht so, wie es sein sollte. Sie kannten ihn nämlich nicht in seiner Eigenschaft als Vater und fabelten im Alten Bunde viel von ihm, was seiner gar nicht würdig war. Darum sagte Christus: „Die wahren Anbeter werden erst kommen“, und: „Der Vater will solche haben, die ihn anbeten“ 28. Später dagegen offenbarte er sich mit dem Sohne der ganzen Welt. Das war es, was Christus vorausverkündete, wenn er sprach: „Damit sie Dich erkennen, den einzig wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus“ 29. „Evangelium“ — Frohbotschaft — Gottes nennt er es, um dem Hörer gleich von Anfang an Mut zu machen. Er kam ja nicht mit einer traurigen Kunde, wie die Propheten mit Vorwürfen und Anklagen und Mahnungen, sondern mit einer frohen Botschaft, und zwar einer frohen Botschaft Gottes, einer Botschaft von unermeßlichen Schätzen ewig dauernder, unveränderlicher Güter. — „Welches er zuvor durch seine Propheten in den heiligen Schriften verheißen hatte.“ Es heißt ja: „Der Herr wird geben das Wort den Freudenbotschaftern mit großer Kraft“ 30. Und wiederum: „Wie schön sind die Füße derer, die Friedensbotschaft bringen“ 31.
2.
Siehst du, wie Name und Art des Evangeliums bereits im Alten Testamente enthalten sind? Nicht bloß mit Worten, will der Apostel (mit Bezug auf die angeführten Stellen) sagen, verkünden wir das Evangelium, sondern auch durch Taten. Es ist ja auch nichts Menschliches, sondern etwas Göttliches, Unsagbares, ganz und gar Übernatürliches. Weil man ihm aber den Vorwurf machte, es sei eine Neuerung, so zeigt der Apostel, daß es älter sei, als die Griechen uns in den Propheten im voraus beschrieben. Wenn es nicht gleich von Anfang zutage trat, so lag es an denen, die es nicht zulassen wollten. „Abraham, euer Vater“, heißt es, „hat gefrohlockt, daß er meinen Tag sehen werde; er sah ihn und freute sich“ 32. Wieso heißt es dann aber, daß „viele Propheten und Gerechte danach verlangten, zu sehen, was ihr sehet, und sahen es nicht“? 33 So, will das heißen, sahen sie es nicht, wie ihr es sehet und höret, in körperlicher Gestalt mitsamt den sichtbaren Zeichen. — Beachte hier, wie lange vorher alles das vorausverkündigt war! Denn wenn Gott etwas Großes in Szene setzen will, so tut er es lange im voraus kund und ebnet ihm die Wege, daß es Gehör findet, wenn es geschieht.
„In den heiligen Schriften.“
— Die Propheten drückten nämlich das, was sie sagten, nicht bloß in Worten aus, sondern sie schrieben es auch nieder; ja, sie schrieben es nicht bloß nieder, sondern sie drückten es auch in figürlichen Handlungen aus; so Abraham, als er Isaak zur Opferung führte, Moses, als er die Schlange erhöhte, als er seine Hände ausstreckte gegen Amalek, als er das Osterlamm opferte.
V. 3: „Von seinem Sohne, der dem Fleische nach aus dem Geschlechte Davids geboren ward“
Was soll das heißen, Paulus? Vorher hast du unsern Geist einen Höhenflug nehmen lassen, hast unsagbar Großes unserer Phantasie vorgezaubert, hast uns vom Evangelium gesprochen, und zwar vom Evangelium Gottes, hast uns den Reigen der Propheten vorgeführt und uns gezeigt, wie sie alle vor vielen Jahren Zukünftiges geweissagt haben; und nun führst du uns wieder zurück zu David? Von welchem Menschen, sag’ an, sprichst du da, dem du Jesses Sohn zum Vater gibst? Wie stimmt das zur Erhabenheit des vorher Gesagten? — Wohl stimmt es dazu; denn nicht von einem bloßen Menschen, will er sagen, ist die Rede; darum habe ich beigesetzt: „Dem Fleische nach“, um damit anzudeuten, daß er auch eine Abstammung dem Geiste nach habe. Und warum ging er von jener aus, nicht von dieser, der höheren? Weil auch Matthäus, Lukas und Markus von jener ausgingen. Denn wer zum Himmel emporführen will, muß von unten nach oben führen. In derselben Ordnung ging es auch bei der Heilstatsache zu. Zuvörderst sahen die Apostel den Erlöser als Menschen auf der Erde, und von da aus lernten sie ihn erkennen als Gott. Denselben Lehrgang hält auch sein Schüler ein. Er spricht zuerst von Abstammung des Erlösers dem Fleische nach, nicht als ob sie die erste wäre, sondern um den Zuhörer von dieser zu jener zu führen.
V. 4: „Der bestimmt war zum Sohne Gottes in Kraft und im Geiste der Heiligung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten“
Aus der sonderbaren Wortfügung ist es unklar, was der Apostel sagen will; darum muß sie aufgelöst werden. Was will er sagen? Wir verkünden ihn als Sprößling aus dem Geschlechte Davids, sagt er; und das ist klar. Woher wissen wir aber, daß dieser, der Menschgewordene, Gottes Sohn ist? Zunächst von den Propheten. Darum spricht er: „Was er zuvor durch seine Propheten in den heiligen Schriften versprochen hatte.“ Das ist keineswegs ein geringfügiger Beweisgrund. Zweitens von der Art seiner Abstammung, die er selbst angibt, wenn er spricht: „Aus dem Geschlechte Davids dem Fleische nach.“ Damit entsprach er dem Gesetze der Natur. Drittens von den Wundern, die er wirkte und durch die er einen Beweis seiner großen Kraft gab. Das will jenes „in Kraft“ sagen. Viertens von dem Geiste, den er denen gab, die an ihn glaubten und durch den er alle heilig machte; darum heißt es: „im Geiste der Heiligung“. Nur in Gottes Macht lag es, so große Geschenke zu geben. Fünftens von der Auferstehung des Herrn. Er war nämlich der erste und der einzige, der sich selbst erweckte. Auf dieses Zeichen wies er darum selbst hin als auf das geeignetste, die Unverschämtheit der Gegner zum Schweigen zu bringen: „Löset, brechet diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn wieder aufbauen“ 34, und: „Wenn ihr mich werdet erhöht haben von der Erde, dann werdet ihr erkennen, daß ich es bin“ 35, und wiederum: „Dieses Geschlecht verlangt ein Zeichen, und es wird ihm kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jonas“ 36. Was will jenes „bestimmt“ sagen? Offenkundig gemacht, kenntlich gemacht, von andern unterschieden, von der allgemeinen Meinung und dem allgemeinen Urteil einerkannt auf Grund der Propheten, der wunderbaren Geburt dem Fleische nach, der aus den Wunderzeichen hervorleuchtenden Kraft, der durch den Geist verliehenen Heiligung, der Auferstehung endlich, durch die er die Gewaltherrschaft des Todes brach.
V. 5: „Durch den wir empfangen haben Gnade und Apostelamt zum Gehorsam des Glaubens“
Beachte den dankbaren Sinn des Dieners! Nichts will er als sein, sondern alles als vom Herrn kommend betrachtet wissen. Auch der Geist ist sein Geschenk. Darum sprach er: „Ich habe euch noch vieles zu sägen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener Geist der Wahrheit kommen wird, so wird er euch in alle Wahrheit einführen“ 37. Und wiederum: „Sondert mir ab den Paulus und Barnabas“ 38. Und im Korintherbriefe heißt es: „dem einen wird durch den Geist verliehen das Wort der Weisheit, einem andern das Wort der Wissenschaft“ 39, und: „Er teilt alles aus, wie er will.“ In der Predigt an die Milesier: „In welcher euch der Hl. Geist gesetzt hat zu Hirten und Bischöfen“ 40. Siehst du, wie er das, was dem Hl. Geiste zukommt, als Sache des Sohnes bezeichnet, und was dem Sohne zukommt, als Sache des Hl. Geistes?
„Gnade und Apostelamt“ . — Das heißt: nicht wir haben es bewirkt, daß wir Apostel geworden sind; denn nicht durch unsere Mühe und Arbeit haben wir diese Würde erlangt, sondern wir haben Gnade empfangen, und von oben ist uns als Geschenk dieses Amt übertragen worden.
3.
„Zum Gehorsam des Glaubens“ — Also nicht die Apostel haben es erwirkt, sondern die ihnen zuvorkommende Gnade. Ihnen oblag es, umherzuziehen und zu predigen; zu überzeugen aber, das stand bei Gott, der in ihnen wirkte, wie Lukas sagt: „Er öffnete ihr Herz“ 41, und wieder: „Denen gegeben ist, zu hören das Wort Gottes.“ „Zum Gehorsam.“ Der Apostel sagt nicht: „Zur Forschung“, oder: „Zur Beweisführung“, sondern: „Zum Gehorsam.“ Wir sind nämlich nicht gesandt, will er sagen, Vernunftbeweise zu führen, sondern wiederzugeben, was wir empfangen haben. Denn wenn der Herr etwas sagt, dürfen die Hörer an seinem Wort nicht die Silben stechen und es viel hin- und herdrehen, sondern sie müssen es einfach annehmen. So waren auch die Apostel nur dazu gesandt, zu sagen, was sie gehört hatten, nicht aber von ihrem Eigenen etwas hinzuzufügen; und uns bleibt nichts anderes übrig, als zu glauben. — An was zu glauben? „An seinen Namen.“ Wir sollen nicht nach seinem Wesen forschen, sondern an seinen Namen glauben. Denn der war es, welcher auch Wunder wirkte. „Im Namen Jesu“, heißt es, „steh’ auf und wandle“ 42. Dazu gehört Glaube; durch Vernünfteln läßt es sich nicht erfassen.
V. 6: „Unter allen Völkern, unter welchen auch ihr seid als Berufene Jesu Christi“
Was heißt das? Hatte denn Paulus allen Völkern gepredigt? Daß er von Jerusalem nach Illyrien gereist und von da zurück bis an die Grenzen der Erde gelangt ist, geht aus dem Briefe an die Römer hervor. Aber wenn er auch nicht zu allen gekommen ist, so ist das, was er sagt, doch nicht Lüge. Er spricht nämlich nicht von sich allein, sondern auch von den zwölf Aposteln und allen, die mit ihnen das Wort verkündigten. Übrigens, wenn man dieses Wort auch nur auf Paulus allein beziehen wollte, so könnte man ihm nicht widersprechen, wenn man nämlich seinen Eifer betrachtet, und wie er bis zu seinem Tode nicht aufhörte, überall zu predigen. Betrachte, wie er das ihm gemachte Geschenk (das Apostelamt) hochhält und wie er es als ein großes und viel erhabeneres als das des Alten Bundes nachweist! Das alttestamentliche Predigtamt bezog sich nur auf ein Volk; seines dagegen umfaßt Land und Meer. — Betrachte auch dabei, wie Paulus jeder Schmeichelei abhold ist! Er spricht zu den Römern, die (damals) den Gipfelpunkt der ganzen Menschheit einnahmen; und doch gesteht er ihnen nicht mehr zu als den andern Völkern. Mögen sie auch sonst den andern über sein und sie beherrschen, im Geistlichen haben sie, meint er, keinen Vorzug; sondern wie wir allen Völkern predigen, will er sagen, so auch euch, und zählt sie so unter einem mit den Thrakern und Skythen auf. Hätte er nämlich nicht das ausdrücken wollen, so wäre es überflüssig gewesen zu sagen: „Unter welchen auch ihr seid“. Das tut er, um ihren Hochmut und ihre Einbildung zu dämpfen. Er lehrt sie, daß sie den andern gleich seien; deswegen fügt er hinzu: „Unter welchen auch ihr seid Berufene Jesu Christi“, d.h. zu denen auch ihr gehört. Er sagt nicht, die andern gehören zu euch, sondern ihr gehört zu den andern. Denn wenn in Jesus Christus nicht Sklave und nicht Freier ist, um so mehr nicht König und nicht Privatmann; denn auch ihr seid berufen worden und nicht von selbst gekommen.
V. 7 „An alle Geliebte Gottes, die in Rom sind, berufene Heilige, Gnade euch und Friede von Gott, unserm Vater und dem Herrn Jesus Christus.“
Beachte, wie oft der Apostel das Wort „berufen“ anwendet! „Berufener Apostel“, spricht er; „unter welchen auch ihr seid Berufene“; „an alle Berufenen, die in Rom sind.“ Diese Wiederholung ist nicht umsonst: er will damit auf die Wohltat der Berufung aufmerksam machen. Weil es wahrscheinlich war, daß es unter den Gläubigen sowohl solche in leitenden Stellungen und den besten Klassen Angehörige wie auch Arme und Privatleute gab, sieht er von der Ungleichheit der Lebensstellungen ab und gibt allen nur einen einzigen Titel. Wenn nun in notwendigeren und geistlichen Dingen Sklaven und Freien alles gemeinsam ist, wie: die Liebe zu Gott, die Berufung des Evangelium, die Annahme an Kindesstatt, Gnade, Friede, Heiligung und alles übrige, wie wäre es nicht äußerste Torheit, unter denen, die Gott verbunden und in größeren Dingen gleichwertig gemacht hat, einen Unterschied gelten zu lassen auf Grund ihres irdischen Berufes? Darum treibt dieser heilige Mann gleich von Anfang an diese gefährliche Krankheit aus und leitet hin zur Mutter alles Guten, zur Demut. Dadurch wurde den Sklaven ihre Stellung erleichtert. Sie lernten nämlich einsehen, daß ihnen aus ihrem Sklavenstand kein Schaden erwachse, da sie ja doch die wahre Freiheit genössen. Auch die Herren erhielten eine gute Lehre, die nämlich, daß ihnen die Freiheit nichts nütze sei, wenn sie nicht in bezug auf den Glauben vorangingen. Damit man aber sehe, daß Paulus damit nicht Verwirrung anrichten wolle, indem er etwa alles durcheinander mische, sondern daß er den wahrsten Standesunterschied kenne, schrieb er nicht einfach: An alle, die zu Rom sind, sondern mit der Unterscheidung: „den Geliebten Gottes“. Darin besteht der wahrste Standesunterschied, und daraus wird zugleich ersichtlich, woher die Heiligung kommt.
4.
Woher also kommt die Heiligung? Von der Liebe. Nachdem er gesagt hat: „an die Geliebten“, setzt er hinzu: „die berufenen Heiligen“, und deckt so auf, wo die Quelle alles Guten für uns liegt. „Heilige“ nennt er alle Gläubigen, — „Gnade euch und Frieden“. O tausendfach segensvoller Gruß! Dieses Wort hatte auch Christus die Apostel beim Betreten der Häuser als erstes sprechen geheißen. Darum hebt auch Paulus überall damit an: „Gnade und Friede.“ Der Krieg, den Christus bis ans Ende geführt hat, war kein kleiner, sondern er war vielgestaltig, allseitig und langwierig; er wurde geführt nicht durch unsere Anstrengungen, sondern durch seine Gnade. Da nun die Gnade ein Geschenk der Liebe, der Friede aber ein Geschenk der Gnade ist, will der Apostel, indem er in seiner Begrüßung Gnade und Friede nebeneinander stellt, beide fest aneinander gekettet wissen, so daß niemals wieder ein neuer Krieg ausbreche, und er bittet den Geber von beiden, daß er sie fest verbunden fortdauern lasse, indem er spricht: „Gnade euch und Friede von Gott, unserm Vater und dem Herrn Jesus Christus.“ — Beachte, wie hier das „von“ dem Vater und Sohne gemeinschaftlich ist, was das gleiche bedeutet wie „aus ihm“. Er sagt nicht: Gnade und Friede von Gott dem Vater durch unsern Herrn Jesus Christus, sondern: von Gott dem Vater und unserm Herrn Jesus Christus. O, was doch die Liebe Gottes vermag! Aus Feinden und Verworfenen werden wir auf einmal Heilige und Kinder. Wenn er das Wort „Vater“ ausspricht, deutet er damit das Beziehungswort „Kinder“ an. Wenn er aber von Kindern spricht, deckt er einen Schatz von Gütern auf.
Laßt uns immerdar einen Wandel führen, würdig solchen Geschenkes, indem wir den Frieden und die Heiligung bewahren! Die andern Würden sind ja vergänglich und entschwinden mit dem gegenwärtigen Leben; auch sind sie käuflich um Geld. Der Sache nach sollte man sie gar nicht Würden nennen, sondern sie sind es nur dem Namen nach. Ihr Wesen besteht ja nur darin, daß man aufgebauschte Gewänder trägt und von einem Troß von Dienern umschmeichelt wird. Dagegen wird uns dieses von Gott verliehene Geschenk der Heiligung und Kindschaft nicht einmal durch den Tod entrissen, sondern es verklärt (unser Leben) hienieden und geht mit uns hinüber ins künftige Leben. Wer nämlich die (Gottes-) Kindschaft bewahrt und über seine Heiligung sorgfältig wacht, der lebt um vieles verklärter und seliger als der, welcher eine Herrscherkrone trägt und in Purpur gekleidet ist. Er genießt in diesem gegenwärtigen Leben viel inneren Frieden und wird aufrecht gehalten durch frohe Hoffnung, er ist nicht (inneren) Stürmen und Aufregungen ausgesetzt, sondern ist allzeit in seinem Innern vergnügt. Denn Seelenfrieden und Seelenfreude schafft weder ein großes Reich noch viel Geld noch Machtdünkel noch Körperkraft noch Tafelfreuden noch Kleiderpracht noch irgend etwas Irdisches, sondern einzig und allein innere Rechtschaffenheit und ein gutes Gewissen. Wer sich das rein erhält, der mag in Lumpen gekleidet sein und mit dem Hunger kämpfen, er ist doch wohlgemuter als die, welche im Lebensgenüsse schwelgen, wie andererseits jemand mit einem bösen Gewissen, mag er umgeben sein mit allem möglichen Reichtum, doch der unglücklichste von allen ist. So war auch Paulus, obzwar er Hunger und Blöße litt und täglich Geißelstreichen ausgesetzt war, doch fröhlichen Sinnes und genoß mehr Lebensfreude als die Könige seiner Zeit. Achab dagegen, obzwar er König war und in allerlei Genüssen schwelgte, stöhnte voll Angst, nachdem er jene Sünde begangen hatte, und sein Gesicht war eingefallen vor der Sünde wie nach derselben. — Wollen wir also Freude genießen, so laßt uns vor allem die Schlechtigkeit fliehen und der Tugend nachstreben! Anders läßt sich dies nicht erreichen, auch wenn wir den Königsthron bestiegen. Darum spricht Paulus: „Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden“ 43. Diese Frucht also laßt uns pflegen, damit wir hier wahre Lebensfreude genießen und das zukünftige Reich erwerben durch die Gnade und Liebe unseres Herrn Jesus Christus, mit welchem Ehre sei dem Vater zugleich mit dem Hl. Geiste nun und allezeit bis in alle Ewigkeit. Amen.