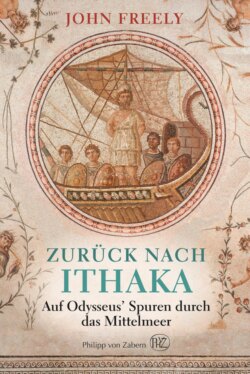Читать книгу Zurück nach Ithaka - John Freely - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|9|1 Die homerische Welt
ОглавлениеDie griechische Literatur beginnt mit den beiden epischen Gedichten Homers, der Ilias und der Odyssee, deren ungeheure literarische Wirkung bis heute anhält, fast 3000 Jahre nach ihrer Entstehung. Schauplatz der Ilias ist die Ebene von Troia, einer großen befestigten Stadt auf der asiatischen Seite der Dardanellen (des Hellespont) nahe deren Ausgang zur Ägäis. Zusammen mit dem Marmarameer (der Propontis) und dem Bosporus bilden die Dardanellen seit jeher die wichtige Meeresstraße zwischen der Ägäis und dem Schwarzen Meer (dem Pontos Euxeinos), die im Nordwesten der heutigen Türkei Europa von Asien trennt. Seit der Antike nennt man die europäische Seite dieser Straße Thrakien. Im türkischen Sprachgebrauch kennt man das gegenüberliegende Ufer als Anatolien, während es früher normalerweise als Kleinasien bezeichnet wurde. Das Wort Anatolia heißt auf Griechisch „Osten“, wörtlich „Land des Sonnenaufgangs“. Möglicherweise hatte der Name „Asien“ sowohl in der indoeuropäischen als auch in der semitischen Sprachfamilie ursprünglich dieselbe Bedeutung; „Europa“ hieß dann vielleicht „Sonnenuntergang“ oder „Land der Dunkelheit“. Diese Trennung hätte den ersten griechischen Seefahrern, die von der Ägäis aus den Hellespont durchquerten und Asien im Osten, Europa westlich von sich hatten, eingeleuchtet, denn die Wasser dieses Seewegs trennten |10|dann das „Land des Sonnenaufgangs“ deutlich vom „Land der Dunkelheit“.
Die Ereignisse, die in der Ilias erzählt werden, sind erst im Zusammenhang mit der Vorgeschichte verständlich: Paris, auch Alexandros genannt, ein Sohn des Königs Priamos von Troia, ist zu Gast bei dem griechischen Landesfürsten Menelaos in Sparta. Dort verführt er Helena, die Frau des Menelaos, die mit ihm nach Troia geht. Menelaos bittet seinen Bruder Agamemnon um Hilfe, den König von Mykene in der Argolis, und dieser ruft Kriegsherren aus der ganzen griechischen Welt auf, zusammen mit ihm einen Feldzug gegen Troia zu unternehmen. Ihre gemeinsame Flotte sammelt sich in Aulis in Böotien, dann fahren sie zum Hellespont. Zwar greifen die Griechen Troia an, können es aber nicht im Sturm nehmen und schreiten zur Belagerung der Stadt; daneben plündern sie mehrere Orte in der Troas, der riesigen Halbinsel südlich vom Hellespont.
Die Ilias selbst beginnt im letzten Jahr der Belagerung, die insgesamt zehn Jahre dauerte, und beschreibt einen Zeitraum von 52 Tagen, der vor der Eroberung und Plünderung Troias durch die Griechen endet. Die Geschichte der eigentlichen Einnahme der Stadt und ihrer Folgen wird teilweise in einigen Abschnitten der Odyssee erzählt, teilweise in den (heute verlorenen) späteren Gedichten des sogenannten Kyklos, einer nach Homer entstandenen Serie von Epen – die ersten davon schildern, was vor dem Beginn der Ilias geschah.
Die Griechen, die nach Homer lebten, betrachteten den Troianischen Krieg als eins der frühen Kapitel in der Geschichte der Hellenen – wie sie sich selbst fortan bezeichneten; entsprechend nannten sie ihre Heimat Hellas. (Das Wort „Griechen“ kommt vom lateinischen Graeci und bezeichnet ursprünglich nur einen Stamm in der Landschaft Epirus.) Thukydides war der Ansicht, |11|dass die Griechen im Troianischen Krieg zum ersten Mal als ein ethnisches Ganzes handelten. In Buch 1 seiner Geschichte des Peloponnesischen Krieges schreibt er:
Denn vor dem Troianischen Krieg scheint Hellas nichts Gemeinsames unternommen zu haben. Mir kommt es sogar so vor, als hätte es damals noch gar nicht als Ganzes diesen Namen geführt (…) es dauerte noch lange, bis er alle anderen Namen verdrängen konnte. Der beste Beweis dafür ist Homer. Er hat ja schon viel später als der Troianische Krieg gelebt, und doch nennt er nirgendwo alle (Hellenen) zusammen bei diesem Namen und überhaupt niemanden außer den Gefährten des Achilleus aus der Phthiotis, denn die waren ja die ersten Hellenen. „Danaer“ nennt er sie in seinen Epen und dann wieder „Argiver“ und „Achaier“. Und auch die Barbaren (= alle anderen Völker) hat er nicht so genannt, und zwar weil damals die Hellenen, wie mir scheint, noch nicht unter einem Namen als Gegenbegriff zum Wort „Barbar“ zusammengefasst waren.1
Als Volk erscheinen die Griechen im heutigen Griechenland erstmals in der Mitte der Bronzezeit, ca. 2000–1600 v. Chr. Anscheinend kamen sie auf dem Landweg von Norden und verwendeten schon eine Vorform der späteren griechischen Sprache; mit sich brachten sie ihre Götter, darunter vermutlich Zeus und die anderen olympischen Gottheiten, die wir aus historischer Zeit kennen. Schriftliche Aufzeichnungen haben sie nicht hinterlassen und sind nur durch archäologische Zeugnisse bekannt.
Die mykenische Zeit (ca. 1550–1100 v. Chr.) hat ihren Namen von der bronzezeitlichen Festungsstadt Mykene in der Landschaft Argolis. Mykenische Keramik, die der in Troia ausgegrabenen ähnelt, ist auch an 24 anderen Stellen der anatolischen |12|Ägäisküste oder ihres unmittelbaren Hinterlandes gefunden worden. Mykenische Küstenorte existierten in Milet und Iasos, dazu auf den nahen Inseln Chios, Samos, Kos und Rhodos. Hinweise sprechen dafür, dass die Griechen Handel in den Tälern des Hermos und Mäander trieben, der beiden wichtigsten Flüsse, die von der anatolischen Hochebene herabkommend in die Ägäis münden. Außerdem hat man mykenische Keramik in Klazomenai, Ephesos und Sardeis gefunden, und nahe Bodrum, dem griechischen Halikarnassos, wurde ein mykenisches Gräberfeld freigelegt.
Die mykenische Epoche entspricht der Heroenzeit des griechischen Mythos.2 Zu ihr gehören die Legenden von Herakles, Ödipus, Perseus und Theseus, dazu die Geschichte von Minos und dem Labyrinth auf Kreta, von den ersten Königen Athens, den Feldzügen der Sieben gegen Theben, Jason und den Argonauten sowie vom Troianischen Krieg. Als Herodot von der Geburt des Gottes Pan spricht, sagt er, sie „geschah vor weniger Jahren als der Troianische Krieg, 800 Jahre vor meiner Zeit“,3 umgerechnet ca. 1250 v. Chr. Außerdem schreibt Herodot, Homer und Hesiod „scheinen mir wohl 400 Jahre vor meiner Zeit gelebt zu haben“,4 also ca. 850 v. Chr. Auch über die Argonauten und den Troianischen Krieg äußert er sich: die Belagerung Troias habe „in der dritten Generation nach dem Tode des Minos“5 begonnen, der Troianische Krieg „ein Menschenalter“6 nach der Fahrt der Argonauten. Wie Homer berichtet, waren mehrere griechische Heroen, die vor Troia kämpften, die Söhne von Männern, die mit Jason gefahren waren, darunter dessen Sohn Euneos, der Fürst von Lemnos.
Laut der späteren griechischen Überlieferung war der gemeinsame Stammvater der Griechen Hellen, der Vater von Doros, Aiolos und des Xuthos, dessen Söhne wiederum Ion und Achaios waren. Daraus ergibt sich eine gemeinsame Abstammung der Dorer, Ionier, Äoler und Achäer, der wichtigsten griechischen Stämme |13|der späten Bronzezeit. In der Ilias bezieht sich Homer auf Hellas und die Hellenen nur indirekt, indem er die Männer in Agamemnons Heer in ihrer Gesamtheit abwechselnd als Danaer, Argiver oder Achäer bezeichnet, manchmal auch als „Söhne der Achaier“.
Homer zufolge regierte über Mykene zur Zeit des Troianischen Krieges Agamemnon, „bei Weitem der größte aller Achaier“. 7 Buch 2 der Ilias endet mit zwei langen Listen, dem Schiffskatalog und dem Katalog der Troer; die erste zählt die Kriegsschiffe in der Armada Agamemnons auf, dessen eigenes Kontingent das größte der griechischen Flotte war. Die Schiffe kamen aus der ganzen griechischen Welt; die weiteste Reise hatten die beiden Kontingente von den Ionischen Inseln hinter sich, die aus der Adria zwischen Griechenland und der Südspitze Italiens herbeigerudert waren. Eins von ihnen führte Odysseus. Eine große Flotte schickte auch Kreta, ein mächtiges Königreich der Bronzezeit mit der Hauptstadt Knossos. Einer der zwei Kommandeure des kretischen Aufgebots war Idomeneus, ein Enkel des Zeussohnes Minos, der dem Mythos nach die minoische Dynastie gegründet hatte.
Der älteste unter den griechischen Helden vor Troia war Nestor, König von Pylos im Südwesten der Peloponnes. Ihn begleitete sein Sohn Antilochos, ein enger Freund des Achilleus; von ihm heißt es in Buch 4, er habe „als Erster einen mutigen Mann der Troas unter den Vorkämpfern erschlagen“.8 Später fiel er selbst in der Schlacht.
Im Anschluss an den Schiffskatalog folgt bei Homer der viel kürzere Katalog der Troer – derjenigen, die bei der Verteidigung Troias mitkämpften. Diese Liste umfasst Gruppen aus fünf Regionen, angefangen mit der Troas, aus der Kontingente von Troern, Dardanern, Zeleiern und Pelasgern kamen. Die Troer führte Hektor, der Sohn des Königs Priamos von Troia. Die Dardaner stammten |14|ebenfalls aus der Troas, aus dem Gebiet gleich östlich des Troerlandes, und hatten ihren Namen von Dardanos, dem Urahnen der Könige von Troia. Ihr Anführer war Aineias, als Aeneas der mythische Stammvater der Gründer Roms, Sohn der Göttin Aphrodite und des Anchises, eines Vetters des Priamos.
Die zweite Gruppe bestand aus drei Völkern in Thrakien jenseits des Hellesponts, nämlich Thraker, Kikonen und Päonen. Die dritte umfasste zwei Stämme an der Schwarzmeerküste Kleinasiens: Paphlagonier und Halizonen. Die vierte Gruppe bildeten zwei Kontingente aus dem Nordwesten Kleinasiens, die Myser und Phryger. Letztere waren ein Volk, das aus Südosteuropa eingewandert war und die Hethiter verdrängt hatte, ihrerseits ein indoeuropäisches Volk, die von ihrer Hauptstadt Hattuša aus in der späten Bronzezeit Anatolien beherrschten. Zur fünften Gruppe zählten drei Ethnien aus dem Südwesten Kleinasiens: Mäonen, Karer und Lykier.
Mysien, Karien und Lykien sind allesamt mit Gebieten in Westanatolien identifiziert worden, die auf hethitischen Schreibtäfelchen genannt sind. Wie es scheint, sprachen die Völker dieser Gebiete – und vielleicht auch die Troer – eine als Luwisch bekannte indoeuropäische Sprache, die dem Hethitischen eng verwandt ist.
In hethitischen Texten ist mehrmals vom Land Assuwa die Rede, das wahrscheinlich jene Region in Westkleinasien war, die die Griechen als Lydien kannten. Allgemein ist man sich einig, dass das griechische Wort Asia vom hethitischen Assuwa abgeleitet ist.9 Die früheste Erwähnung Asiens im Griechischen steht in Buch 2 der Ilias, wo der Dichter von „der asischen Wiese beiderseits der Wasser des Kaystros“10 spricht und damit jenen Fluss meint, der durch die Ruinen der alten ionischen Stadt Ephesos in die Ägäis fließt.
Zudem erwähnen hethitische Texte zwei Ortsnamen – Taruisa |15|und Wilusa – hinter denen Troia und Ilios vermutet werden, jene beiden Namen, die Homer gleichbedeutend für die Hauptstadt der Troer verwendet. Ein Text schildert die Einzelheiten eines Vertrags zwischen dem Hethiterkönig Muwatalli (ca. 1300 v. Chr.) und Alaksandu, dem Herrscher von Wilusa, bei dem es sich um Alexandros (Paris), den Fürsten von Ilios (Troia), handeln könnte. Außerdem wird ein Volk namens Dardanja genannt, vielleicht ein Bezug auf die Dardaner.
In hethitischen Quellen erscheinen mehrmals Verweise auf Arzawa, einen aggressiven Staat, vielleicht Troia, der den Nordwesten Anatoliens kontrolliert zu haben scheint. Zudem ist von den Ahhijawa die Rede, einem mächtigen Seefahrervolk, das man mit den Achäern oder mykenischen Griechen identifiziert hat. Die Ahhijawa-Fürsten korrespondierten mit den Hethiterkönigen von einer Küstenstadt namens Millawanda aus, wahrscheinlich Milet.
Zuerst besiedelt wurde Milet ungefähr 1600 v. Chr. durch Seefahrer aus dem minoischen Kreta, das in der Ägäis, wie Thukydides es ausdrückt, eine Thalassokratie errichtet hatte, eine „Seeherrschaft“. Das Minoerreich endete ca. 1450 v. Chr., als die Mykener die Kontrolle über Kreta übernahmen.
In der mittelminoischen Zeit (ca. 2000–1700 v. Chr.) führte man die Aufzeichnungen in den kretischen Palästen in einer als Linear A bekannten Bilderschrift, die noch nicht entziffert ist. In mykenischer Zeit dann waren die Palastarchive auf Kreta in einer Silbenschrift namens Linear B abgefasst, einer Frühform des Griechischen, die sich auch in mykenischen Siedlungen in Griechenland selbst gefunden hat.
Gegen Anfang seiner Geschichte des Peloponnesischen Krieges bemerkt Thukydides, „dass das heute als Hellas bezeichnete Land nicht seit jeher dauerhaft besiedelt gewesen ist, sondern dass es früher Wanderbewegungen gab und jeder der Stämme jeweils |16|leicht sein Gebiet aufgab, denn sie standen ständig unter Druck anderer, die mächtiger waren“.11 Erst viele Jahre nach dem Troianischen Krieg „endete die Periode der Wanderungen“,12 gefolgt vom „Zeitalter der Kolonisation“, als „Ionien und die meisten Inseln von den Athenern besiedelt wurden“.
Die große Wanderung, die die Hellenen über die Ägäis nach Ionien und in die anderen Gebiete der Ägäisküste Kleinasiens führte, vollzog sich während der sogenannten Dunklen Jahrhunderte (Dark Ages) der griechischen Welt, einem Zeitraum von mehreren Jahrhunderten, der dem katastrophalen Ende der Bronzezeit folgte. Diese Katastrophe scheint sich innerhalb von weniger als 50 Jahren am Ende des 13. und zu Beginn des 12. Jahrhunderts v. Chr. abgespielt zu haben, als fast jede bedeutende Stadt und jeder Palast im östlichen Mittelmeerraum zerstört wurde; viele von ihnen wurden anschließend nie wieder bewohnt. Unter den zerstörten Städten waren Mykene, Tiryns, Pylos und sieben andere mykenische Festungen auf dem heutigen griechischen Festland, die Minoerstädte Knossos und Kydonia auf Kreta, vier Städte auf Zypern, 13 Städte in Anatolien, darunter Troia und die hethitische Hauptstadt Hattuša, neun Städte Syriens und neun in der südlichen Levante. Man hat eine Reihe von Ursachen für dieses Unglück vorgeschlagen, darunter Erdbeben, Dürren oder andere Umweltkatastrophen, ausgedehnte Revolutionen, massive Wanderungen wie die Invasion der mysteriösen „Seevölker“, die in ägyptischen Inschriften genannt sind, neue Methoden der Kriegführung oder einen „Systemkollaps“, der auf einen oder mehreren der genannten Faktoren zurückging, oder auch die Einführung der Eisenverarbeitung, die das „Eisenzeit“ genannte Zeitalter nach der Bronzezeit einläutete. Was auch immer die Ursache war, eine der Auswirkungen war ein drastischer Bevölkerungsrückgang in der griechischen Welt; viele Orte, vor allem auf den ägäischen Inseln, |17|wurden völlig verlassen, die überlebenden Gemeinschaften waren verstreut und voneinander isoliert.
Der antiken Überlieferung zufolge war die griechische Auswanderung nach Anatolien ein Resultat der Invasion der Dorer, eines Stammes aus Makedonien, auch wenn die heutige Wissenschaft dies zurückweist. Auf jeden Fall waren die Dorer ein Teil der Wanderungen, zusammen mit den Äolern und Ioniern, eine Massenbewegung, die wahrscheinlich um 1040 v. Chr. begann. Die Ionier ließen sich im mittleren Abschnitt der Ägäisküste Anatoliens und auf den vorgelagerten Inseln nieder, die Äoler im Norden (mit einigen Überschneidungen) und die Dorer im Süden. Mit nur einer Ausnahme lagen die äolischen Siedlungen zwischen dem Hellespont und dem Hermos, dazu auf den Inseln Lesbos und Tenedos. Die von den Ioniern gegründeten Städte befanden sich zwischen den Tälern der Flüsse Hermos und Mäander, außerdem auf Chios und Samos. Dorische Kolonien gab es auf Kos, auf Rhodos und in Karien, der Südwestecke Anatoliens, wo die Ägäis ins Mittelmeer übergeht.13
In der griechischen Geschichte ist das 8. Jahrhundert v. Chr. bekannt als Zeitalter der Kolonisation, denn damals begannen die Griechen rund um das Mittelmeer und das Schwarze Meer Kolonien zu gründen, ebenso in der Wasserstraße, die beide Meere verbindet. Kolonien im heutigen Sinne waren dies nicht, sondern eigenständige Stadtstaaten, die unabhängig von der Gründerstadt waren. Gegründet wurden außerdem emporia, Handelsplätze, die keinen Koloniestatus besaßen.
Chalkis und Eretria auf der Insel Euböa, die zusammen 40 Schiffe zu Agamemnons Heer bei der Belagerung Troias entsandt hatten, gründeten acht der 22 griechischen Kolonien auf Sizilien und in Süditalien, weshalb das Land als „Großgriechenland“ (lateinisch Magna Graecia) bekannt wurde. Die früheste dieser |18|griechischen Niederlassungen war das euböische Emporion Pithekussai (das heutige Ischia), das ca. 770–760 v. Chr. auf einer Insel vor dem Nordwestabschnitt des Golfs von Neapel eingerichtet wurde. Rund ein Jahrzehnt zuvor hatten die euböischen Städte eine führende Rolle bei der Gründung des Emporions Potamoi Karon gespielt, eines heute al-Mina genannten Fundortes an der Mündung des Orontes in Nordsyrien, in der modernen türkischen Provinz Hatay, außerdem bei der Schaffung zweier nahe gelegener Emporia in Poseidion und Paltos.
Korinth arbeitete mit Chalkis bei der Gründung zweier Kolonien auf Sizilien und fünf weiterer in Nordwestgriechenland und den vorgelagerten Inseln im Ionischen Meer (der südlichen Adria) zusammen, darunter Kerkyra (Korfu) und Leukas (Lefkada). In Kerkyra hat man das homerische Scheria sehen wollen, die Heimat der Phäaken, die Odysseus auf dem vorletzten Abschnitt seiner langen Heimreise nach Ithaka fürstlich bewirteten. Leukas wäre dann eine der Inseln, die Meges beherrschte, dessen Kontingent aus 40 Schiffen im Schiffskatalog gleich vor dem des Odysseus genannt ist.
Die ionische Stadt Phokaia in Kleinasien gründete Kolonien an den Küsten Südost-Italiens, Korsikas und des heutigen Frankreich – darunter Massalia, das heutige Marseille –, ebenso am Hellespont, dem Marmarameer und dem Schwarzen Meer.
Am tatkräftigsten war die ionische Stadt Milet, gegründet an der Stelle einer früheren mykenischen Kolonie, die ein Kontingent entsandt hatte, um bei der Verteidigung Troias auf Seiten der Troer zu kämpfen. Milet allein gründete mindestens 40 Kolonien, die meisten davon am Hellespont, dem Marmarameer und dem Schwarzen Meer, außerdem den befestigten Hafen Milesion Teichos, Teil des großen griechischen Emporions Naukratis im Nildelta.
|19|Durch diese Kolonien gerieten die Griechen in Konflikt mit den Phönikern, die sowohl in der Ilias als auch in der Odyssee erwähnt sind. Die führenden phönikischen Stadtstaaten waren Tyros und Sidon in Syrien, die ihrerseits Karthago und viele andere Kolonien im Mittelmeerraum gründeten. Über ihre Emporia in Nordsyrien standen die euböischen Städte in Kontakt mit den Phönikern; hier erwarben sie Waren und Ideen aus Phönizien und anderen Teilen des Ostens und leiteten sie weiter an andere europäische Emporia, vor allem Pithekussai, die im Gegenzug Wein und Öl schickten.
Der wichtigste kulturelle Neuerwerb der griechischen Händler war die phönikische Alphabetschrift, die Herodot als phoinikeia bezeichnet. Die Phöniker hatten ältere Silbenschriften in ein vereinfachtes Standardalphabet umgeformt, das mit 22 Zeichen arbeitete. Nun übernahmen die Griechen das phönikische System und schufen ein Alphabet, aus dem sich das klassisch-griechische mit 24 Buchstaben entwickelte, darunter sechs Vokale. Anfangs gab es mehrere Versionen dieses neuen Alphabets, von denen sich insbesondere die westliche (chalkidische) und die östliche (ionische) unterschieden. Die chalkidische Schreibweise gab den Anstoß zum altitalischen und dadurch zum lateinischen Alphabet, während sich aus dem ionischen Alphabet das heutige griechische entwickelte. Die Athener übernahmen die ionische Schreibweise 403 v. Chr. als neuen Standard, und bald darauf verschwanden die anderen Varianten. So wurden die Griechen wieder zur Schriftkultur, gut vier Jahrhunderte nach dem Zusammenbruch der mykenischen Zivilisation und dem Verschwinden von Linear B während der Dark Ages.
Die früheste datierte Inschrift mit dem neuen Alphabet stammt von ca. 740–7Z0 v. Chr. Man fand sie 1953 auf Ischia auf dem Fragment eines Trinkgefäßes aus Keramik, das als Nestorbecher |20|bekannt wurde. Drei Zeilen im chalkidischen Alphabet bilden einen jambischen Vers, gefolgt von zwei Hexametern: „Des Nestor Becher, aus dem sich gut trinken lässt. // Wer aus diesem Becher trinkt, den wird sogleich // Verlangen ergreifen nach der schön bekränzten Aphrodite.“14
Nestors Becher ist in Buch 11 der Ilias beschrieben, und so führte die Entdeckung der Inschrift die meisten Forscher dazu, die homerischen Epen in die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr. zu datieren. Tatsächlich sind Datierung und Geschichte der Verse, Homers Lebensdaten und seine Identität und nicht zuletzt die Diskussion darüber, wann die mündlichen Dichtungen zum ersten Mal in die heute bekannte Form gebracht wurden, allesamt Teil des Problemkomplexes, der inzwischen als homerische Frage bekannt ist.
Viele Wissenschaftler gehen davon aus,15 dass die Homer zugeschriebenen Gedichte aus dem kollektiven Erbe vieler Sänger der Frühzeit hervorgegangen sind (im Griechischen kennt man sie als aoidai), die sich beim Vortrag ihrer Lieder auf der Lyra begleiteten. Diese Tradition scheint in Ionien im 8. Jahrhundert v. Chr. aufgekommen zu sein, wo die Aöden an den Adelshöfen auftraten und die ruhmreichen Taten der großen Helden der Vergangenheit in Liedern besangen, die ihre Vorgänger zur Zeit der Großen Wanderung vom griechischen Festland mitgebracht hatten. Frühere Aöden, glaubt man, hatten einen festen Platz an mykenischen Höfen, und ihre Nachfolger in Ionien sangen Lieder aus der gleichen epischen Tradition, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurden.
Die meisten Wissenschaftler setzen die Entstehung von Homers Gedichten heute in die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr., obwohl einige sie auf 680–660 v. Chr. datieren. Kurz nach 700 v. Chr. erschienen erste Szenen aus den homerischen Epen auf |21|griechischen Vasenbildern; viele von ihnen zeigen Episoden des Odysseus, was die Datierung beider Epen auf die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr. untermauert. Während einige Forscher nach wie vor annehmen, dass es eine einzige Person namens Homer gab, die um 740 v. Chr. die Ilias und um 720 v. Chr. die Odyssee dichtete, geht die Mehrheit der Forscher heute davon aus, dass beide Gedichte von zwei unterschiedlichen Personen im Abstand einer Generation stammen, die eine umfangreiche mündliche Tradition zum ersten Mal in Schriftform brachten. Nach wie vor wird aber auch die Ansicht vertreten, in einem oder beiden Fällen gebe es keinen eigentlichen Dichter, sondern nur eine Endredaktion komplexer mündlicher (oder sogar schriftlicher) Vorstufen.
Fast einstimmig datierten die antiken Autoren die ersten Standardtexte der Ilias und der Odyssee auf etwa 550 v. Chr., als die Peisistratiden, der Athener Tyrann Peisistratos und seine Söhne, sie angeblich niederschreiben und zum Fest der großen Panathenäen vortragen ließen. Diese Ansicht wird von mehreren heutigen Gelehrten verworfen, namentlich von Gregory Nagy, der stattdessen ein evolutionäres Modell mit mindestens fünf einzelnen Phasen der Homer-Überlieferung aufgestellt hat, die von mykenischer Zeit bis ca. 150 v. Chr. reichen, als Aristarchos von Samothrake, Leiter der Bibliothek von Alexandria, kritische Ausgaben der Ilias und der Odyssee erstellte und jedes Gedicht in 24 Bücher aufteilte, die er mit den 24 Buchstaben des griechischen Alphabets bezeichnete (in heutigen Ausgaben anderer Sprachen sind sie durch Zahlen ersetzt).16
Die Entstehung der homerischen Epen führte einen Wandel im traditionellen Beruf des Sängers herbei, der statt aoidos nunmehr rhapsodos genannt wurde. Der Aöde war eine Art Barde, der seinen Text beim Singen improvisierte, der Rhapsode dagegen |22|rezitierte einen feststehenden Text, und sein Beruf wurde durch Zusammenschlüsse oder „Gilden“ geschützt.
Die Rhapsoden auf der Insel Chios nannten sich Homeridai oder „Söhne Homers“ und behaupteten, von diesem Dichter abzustammen. Zuerst erwähnt sind die Homeriden in Pindars Nemeischen Oden, entstanden um 485 v. Chr.: „Mit dem Anfang, wo auch die Homeriden // ihre zusammengenähten Epen beginnen, die Aoiden, mit einem vorausgeschickten Lob auf Zeus …“17
Das Scholion (ein antiker Kommentar) zur 2.Nemeischen Ode erklärt, was Pindar mit „zusammengenäht“ meint:
… manche aber sagen, dass – da die Dichtung Homers noch nicht zu einem Ganzen zusammengebracht war, sondern vielmehr verstreut und in Teile zerstückelt war – wenn sie (die Rhapsoden) vortrugen, sie etwas taten, das dem Aufreihen oder dem Aneinandernähen ähnelt, indem sie es als etwas Ganzes vorführten.
Da sowohl die Ilias als auch die Odyssee im vorletzten Jahr der jeweils zehnjährigen Geschichte beginnen, muss es ein oder mehrere ältere Epen gegeben haben, welche die ganze Geschichte erzählten. Homer und seine Zuhörer kannten die Einzelheiten der ganzen Geschichte des Troianischen Krieges, doch wurden die Ilias und die Odyssee so beliebt, dass ältere Versionen des Stoffs in Vergessenheit gerieten und verloren gingen. Diese verlorenen Epen bildeten den schon erwähnten Kyklos (daher unser „Zyklus“), der sich mit dem Troianischen Krieg und den zugehörigen Ereignissen befasste. Der Kyklos bestand aus sechs Epen neben der Ilias und der Odyssee. Zwischen ihnen gab es fast keine Überschneidung, denn sie waren so um Ilias und Odyssee herumgeschrieben, dass sie in ihrer Gesamtheit die vollständige Geschichte des Krieges erzählten. Man hat vorgeschlagen, die Endversion des Kyklos sei |23|in frühhellenistischer Zeit entstanden, indem unabhängige Gedichte mit den beiden homerischen Epen kombiniert wurden und dadurch die ganze Geschichte abgedeckt war. Die Kyklos-Gedichte selbst sind verloren, und was wir von ihnen wissen, stammt hauptsächlich aus einer Inhaltsangabe des Proklos, bei dem es sich vielleicht um den neuplatonischen Philosophen des 5. Jahrhunderts n. Chr. handelt.
Zum Kyklos gehören, chronologisch aufgezählt, nach dieser Auffassung folgende Epen: die Kyprien (elf Bücher), die den Hintergrund des Troianischen Krieges und die Belagerung von Troia bis zum Einsetzen der Ilias beschrieben; die 24 Bücher der Ilias selbst, Nagys Theorie zufolge mit Bearbeitung des Anfangs und des Endes, die sie mit den Epen davor und danach verknüpften; die Aithiopis, fünf Bücher, eine Fortsetzung der Kriegsgeschichte bis zum Tod des Achilleus und dem Streit um seine Waffen zwischen Odysseus und Aias dem Telamonier; die Kleine Ilias, vier Bücher, vom Streit zwischen Odysseus und Aias bis zur List mit dem hölzernen Pferd; die Iliupersis, zwei Bücher, vom Troianischen Pferd bis zur Plünderung der Stadt; die Nostoi („Heimkehrgeschichten“), fünf Bücher, über die Heimreise des Agamemnon und anderer griechischer Helden, aber nicht des Odysseus; die Odyssee, 24 Bücher, über die Heimkehr des Odysseus; schließlich die Telegonie in zwei Büchern über das Leben des Odysseus nach dem Ende der Odyssee bis zu seinem Tod.
Daneben gibt es eine Sammlung nachhomerischer Gedichte, die als Homerische Hymnen bekannt sind; das älteste von ihnen stammt aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. Insgesamt existieren 33 Hymnen, von denen vier lang sind (zwischen 294 und 580 Zeilen) und 21 kurz (zwischen drei und 59 Zeilen). Jeweils drei Hymnen feiern Dionysos und Aphrodite, zwei Demeter, Artemis, Apollon, Athene, Hermes, Hestia und die Dioskuren (Kastor und Polydeukes, |24|lateinisch Pollux, Zwillingssöhne des Zeus, Brüder der Helena), und je ein Hymnos gilt Ares, Hera, der Göttermutter, dem löwenherzigen Herakles, Asklepios, Pan, Hephaistos, Poseidon, dem Sohn des Kronos, dem Höchsten (also Zeus), den Musen und Apollon, Gaia (der Erde), der Allmutter, Helios und Selene.
Die zwei Apollonhymnen richten sich an den delischen und den pythischen Apollon, benannt nach den Kultstätten auf der heiligen Kykladeninsel Delos und in Delphi.18 Der Hymnos an den delischen Apollon berichtet über die Geburt des Gottes auf Delos, das ursprünglich Ortygia hieß. Apollon und seine Zwillingsschwester Artemis waren Kinder der Leto, einer Geliebten des Zeus.
Die eifersüchtige Hera hatte Leto verbannt und überall verboten, ihr eine Zuflucht zu gewähren, an der sie ihre Kinder gebären konnte. Leto durchwanderte die ganze griechische Welt, fand aber keinen Platz, der sie aufnahm, bis schließlich die kahle Kykladen-Insel Ortygia bereit war, sie aufzunehmen. Zuerst wurde Artemis geboren, die Leto dann bei der Entbindung des Apollon half. Nach seiner Geburt änderte sich der Name der Insel zu Delos, „die Scheinende“, denn einer der Beinamen Apollons war Phoibos, „der Leuchtende“.
Zu Beginn des zweiten Abschnitts wendet sich der Dichter an Apollon.
Wie also soll ich dich besingen, der du doch vollkommen schön an Liedern bist? (…) Soll ich singen, wie dich am Anfang Leto zur Freude für die Sterblichen gebar, gelehnt an den Berg Kynthos auf der felsigen Insel Delos, der meerumgürteten? Auf beiden Seiten rollte eine dunkle Woge ins Land, von schrill pfeifenden Winden getrieben; von dort bist du ausgegangen und herrschst über alle Menschen.19
|25|Zum Fest des delischen Apollon reisten die Ionier aus Athen und von den Kykladen an, von den „umgebenden Inseln“ rings um das heilige Zentrum Delos, aber auch die Bewohner der griechischen Kolonien an der Ägäisküste Kleinasiens und von den dortigen Inseln Samos und Chios. Der vorletzte Abschnitt des Hymnos beschreibt in lyrischen Worten, wie die Ionier das Fest begehen:
Du aber, Herrscher mit silbernem Bogen, ferntreffender Apollon, einst schrittest du über den zerklüfteten Kynthos, nun bewegst du dich wohl zwischen den Inseln und Menschen umher. Zahlreich sind deine Tempel und dicht bewaldeten Haine, alle Gipfel sind dir teuer und die steilen Abhänge der hohen Gebirge und die ins Meer strömenden Flüsse; an Delos aber, Phoibos, erfreut dein Herz sich am meisten, denn dort kommen ja die Ionier, die ihr langes Gewand am Boden nachschleppen, zusammen samt ihren Kindern und ihren sittsamen Gemahlinnen. Dich erfreuen sie mit Boxkämpfen, Tanz und Gesang und gedenken dein, wenn sie den Wettkampf ausrichten. Man könnte meinen, ewig unsterblich und alterslos wären sie, trifft man sie dort, wo die Ionier dicht gedrängt sind – denn da sähe man die anmutige Schönheit aller und hätte im Herzen seine Wonne, wenn man auf die Männer blickte und die Frauen mit schöner Taille, ihre schnellen Schiffe und ihren reichen Besitz. Dazu gibt es dort noch ein großes Wunder, dessen Ruhm nie vergehen wird: die Mädchen von Delos, die Dienerinnen des Ferntreffenden; erst singen sie dort einen Hymnos auf Apollon, auch auf Leto und Artemis, die an Pfeilen ihr Entzücken hat, dann stimmen sie einen Hymnos im Gedenken an die Männer und Frauen von einst an und erfreuen die einzelnen Stämme der Menschen damit. Aller Menschen Sprechweisen und Geplapper verstehen sie nachzuahmen: Jeder würde meinen, er erhöbe selbst die Stimme, so schön fügt sich ihr Gesang.20
|26|Den Hymnos an den delischen Apollon hat ein antiker Pindarkommentator dem Kynaithos von Chios zugeschrieben, einem späten und für fiktiv gehaltenen Homeriden, der die Verse 522 v. Chr. zum Vortrag bei einem außergewöhnlichen Doppelfest gedichtet habe, das der Tyrann Polykrates von Samos zu Ehren sowohl des delischen als auch des pythischen Apollon veranstaltet habe. Im letzten Abschnitt des Hymnos bezieht sich der Dichter auf Homer, als er sich an die Jungfrauen wendet, die im Chor singen:
Nun aber – wohlan, seid mir gnädig, Apollon samt Artemis, und ihr Mädchen alle, lebt wohl! Denkt auch in Zukunft an mich, wenn vielleicht einer der Erdenmenschen hierher kommt, ein leidgeprüfter Fremder, und fragt: „Ihr Mädchen, wer, glaubt ihr, ist unter den Sängern der Mann mit der süßesten Stimme, der hier weilt, und welchen genießt ihr am meisten?“ Dann antwortet ihr alle zusammen, mir zuliebe: „Ein blinder Mann – er ist auf dem felsigen Chios daheim; all seine Gesänge sind für alle Zeit die besten.“ Ich meinerseits will euren Ruhm mit mir tragen, wohin ich auch auf Erden in die gut erbauten Städte der Menschen komme, und wirklich, sie werden sich überzeugen lassen, ist es doch wahrhaftig wahr. Nie aber will ich davon ablassen, den ferntreffenden Apollon zu besingen, den silberbogigen, den Leto mit den schönen Haaren geboren hat.21
Diese Anspielung, wonach der Dichter als Blinder auf Chios lebte, ist Teil der Homerlegende, deren älteste Version wahrscheinlich in die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. zurückreicht, als Ilias und Odyssee in Schriftform erstmals in der ganzen griechischen Welt überaus beliebt wurden. Es gibt kein einziges zeitgenössisches Dokument zum Leben Homers, also beruht jede Biographie des |27|Dichters auf reiner Spekulation. Sieben griechischsprachige Homerviten sind erhalten, dazu ein merkwürdiges Werk namens Der Wettstreit zwischen Homer und Hesiod. Sie alle stammen aus der römischen Kaiserzeit, doch man hat nachgewiesen, dass Teile dieser Texte bis ins 7. Jahrhundert v. Chr. zurückgehen.
Die Untersuchung dieser Quellen legt nahe, dass Homer wahrscheinlich ebenso in den äolischen und ionischen Kolonien der Ägäisküste lebte und wirkte wie der Insel Chios. Unter den vielen Orten, die den Anspruch erheben, Homers Geburtsort zu sein, ist der wahrscheinlichste Smyrna, wo er ca. 770 v. Chr. am Fluss Meles geboren sein könnte, der heute noch an den kürzlich ausgegrabenen Überresten der antiken Stadt vorbei in den Golf von Izmir fließt.
Wenn griechische Historiker seit den Zeiten von Herodot und Thukydides über den Troianischen Krieg und andere Ereignisse der Heroenzeit schrieben, machten sie keinen Unterschied zwischen dieser legendären Vergangenheit und bekannten historischen Ereignissen. Thukydides wusste zwar, dass Homers Epen lange nach dem Troianischen Krieg entstanden waren, zweifelte aber nicht an der Historizität Homers und Agamemnons oder an dessen Feldzug gegen Troia.
Spätere griechische Autoren nennen Jahreszahlen für den Fall von Troia, die sich zwischen 1334 und 1150 v. Chr. bewegen. Das überwiegend verbindliche Datum 1184 v. Chr. stammt von Eratosthenes von Kyrene, dem Leiter der Bibliothek von Alexandria in der Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr., der eine systematische Chronologie einführte, die auf den Zyklen der Olympischen Spiele beruhte. Der erste Forscher der Moderne, der eine chronologische Trennlinie zwischen Mythos und eigentlicher Geschichte zog, war der englische Historiker George Grote. In seiner mehrbändigen History of Greece, die 1845–1856 erschien, stellte Grote die These |28|auf, dass die Einführung der Olympischen Spiele 776 v. Chr. den Anfang der griechischen Geschichte markiere, denn für die Heroenzeit, die Homer beschreibt, konnte er keinen historischen Zeugen finden, und so wurden Homers epische Gedichte auf den geisterhaften Status von Mythen reduziert.
Kurz darauf jedoch schob die neue archäologische Wissenschaft diese Trennlinie weiter vor, als sie nachwies, dass die von Homer in der Ilias beschriebene Welt tatsächlich existiert hatte,22 und die Heroenzeit hinter dem Schleier des Mythos hervor- und ins Licht der Geschichte zurückholte.