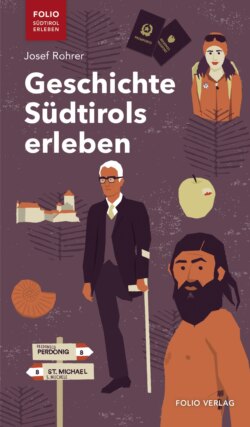Читать книгу Geschichte Südtirols erleben - Josef Rohrer - Страница 17
Leben in der Falllinie
ОглавлениеDie Muthöfe hoch über Meran gehören zu den steilsten Bauernhöfen im Land. Der sarkastische Rat an Bergbauern in Extremlagen, sie sollten ihre Kinder festbinden, damit sie nicht zu Tal kollern, könnte hier erfunden worden sein. Warum bloß ließen sich Menschen an solch einem „Hurenort“ (vulgärtirolerisch für ein besonders widriges Gelände) nieder?
Die Römer und davor die Räter hatten noch keine Platzprobleme. Später aber, in der sogenannten Völkerwanderung, ließen sich immer mehr Siedler nieder. Im heutigen Tirol waren es vor allem bajuwarische und alemannische Stämme, um ca. 800 bewohnten sie bereits viele der leicht zugänglichen Niederungen. Noch gab es dort genügend Wald zu roden. So ließ der bayerische Herzog Tassilo III. bei Innichen im Pustertal ein Rodungskloster anlegen, um die Lehre Christi zu verbreiten und nebenbei Acker- und Weideland zu schaffen. Da der Ackerbau insgesamt gute Fortschritte machte und die Bevölkerung wuchs, stieg der Landbedarf kontinuierlich.
Könige übten die angeblich von Gott verliehene Verfügungsgewalt über Grund und Boden aus. Sie festigten ihre Macht, indem sie Kirche, Adel und sonstige Clans mit Ländereien bedachten. Diese Grundherren ließen Bauern als meist rechtlose Leibeigene für sich schuften. Wie aber brachte man sie dazu, auch steile und abgelegene Wälder urbar zu machen und dort oben nutzbringend Landwirtschaft zu betreiben?
Der Köder war das Konzept der sogenannten Schwaighöfe. Die Bauern nahmen die Mühe der Rodung auf sich, bauten Stall und Stadel und für sich eine Hütte. Als Starthilfe überließ ihnen der Grundherr etwas Vieh und kassierte einen jährlichen Zins in Form von Naturalien, meist Käse. Eine Win-win-Situation, denn die Bauern durften den so geschaffenen Hof als ihr Eigen betrachten und sogar vererben. Im Vergleich mit den Leibeigenen ein Privileg.
Wann und wo im heutigen Südtirol die ersten Schwaighöfe angelegt wurden, wissen wir nicht. Wohl deutlich vor 1285, als ein Dokument die Muthöfe zum ersten Mal als Schwaigen erwähnte. Was wir auch nicht wissen: Wurden den Bauern die Flächen zum Roden zugewiesen oder durften sie sich den Platz selbst aussuchen? Waren es eher die Ausgegrenzten, die sich auf das Wagnis einließen? Und waren die, die besonders weit nach oben zogen, besondere Eigenbrötler? Gesichert ist nur, dass Schwaighöfe mit der Zeit bis zur Waldgrenze auf 2000 Metern zu finden waren – Einsiedeleien, fern der Welt.
Um ca. 1500 verloren die Schwaigen ihr Sonderrolle, als auch den Bauern in tieferen Lagen eine Art von Nutz- und Eigentumsrecht zugestanden wurde. Sie mussten zwar weiterhin den Grundherren einen Teil der Ernte als Pachtzins abliefern oder einen Gegenwert in Geld. Aber nun durften auch sie das Nutzrecht des Hofs vererben. Damit entwickelten die Bauern in Tirol früh ein Standesbewusstsein. Das Revolutionsjahr 1848 beseitigte schließlich die letzten Bindungen an die Grundherren – nicht ohne dass diese für die sogenannte Grundentlastung noch einmal kassierten.
Wer danach fragt, warum die steilsten und höchstgelegenen Bauernhöfe auch danach noch bewohnt und bewirtschaftet wurden, bekommt von der Fachliteratur oder in Dietenheim viele Antworten. Weil dort oben nie so viel übrig blieb, um herunten ein besseres Stück Land zu kaufen; weil es lange keine Industrie mit ihrem großen Bedarf an Arbeitskräften gab, und als diese kam, waren es zunächst italienische Staatskonzerne und die Zeit des Faschismus, die deutschsprachige Südtiroler ausgrenzte; weil Südtirolerinnen und Südtiroler eine besonders starke Bindung zu ihrer Heimat, ihrer „Scholle“, haben – als gäbe es dafür ein besonderes Gen. Die Landflucht, die andere alpine Landschaften prägt, blieb hier jedenfalls aus.
Wer bis vor rund 50 Jahren nicht von „dort oben“ geflüchtet ist, hat heute noch weniger Grund dazu. Inzwischen ist kaum ein Berghof ohne eine asphaltierte Zufahrt, der Schülertransport funktioniert bis weit hinauf, Funkbrücken führen in ein schnelles Internet, der Tourismus bringt so manchen Extra-Euro. Es gibt Höhenzulagen (acht von zehn Höfen liegen über 1000 Meter), Erschwerniszulagen (jeder fünfte Hof hat eine Hangneigung von über 50 Prozent), und auch sonst fließen die Subventionen für Bergbauern reichlich – wie die vielen neuen Ställe, Scheunen, Maschinen und schmucken Wohnhäuser zeigen.
Und herunten im Tal ist auch nicht alles Gold, was man von oben glänzen sieht.