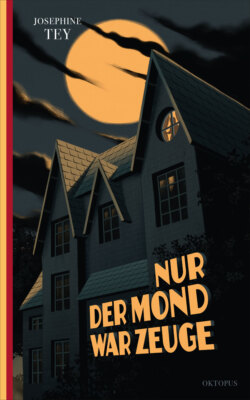Читать книгу Nur der Mond war Zeuge - Josephine Tey - Страница 7
5
ОглавлениеÜber eine Woche war vergangen, als Mr Heseltine seinen schmalen, kleinen grauhaarigen Kopf bei Robert zur Tür hereinsteckte und verkündete, Inspector Hallam sei im Büro und wolle ihn für einen Augenblick sprechen.
Der Raum auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs, wo Mr Heseltine das Zepter über die Schreiber schwang, wurde stets als »das Büro« bezeichnet, obwohl natürlich das Zimmer, in dem Robert saß, und das kleine Hinterzimmer, in dem Nevil Bennet sich aufhielt, trotz Teppich und Mahagoni auch nichts anderes als Büroräume waren. Es gab ein offizielles Wartezimmer auf der Rückseite des Büros, ein kleiner Raum in der gleichen Art wie derjenige des jungen Bennet, aber die Klienten von Blair, Hayward und Bennet hatten ihn noch nie gemocht. Sie kamen in das Büro, um sich anzumelden, und in der Regel blieben sie dort und plauderten, bis Robert Zeit hatte, sie zu empfangen. In dem kleinen Warteraum hatte sich schon seit Langem Miss Tuff eingerichtet und schrieb dort Roberts Briefe, unbehelligt von störenden Besuchern und der Neugier des Botenjungen.
Als Mr Heseltine wieder gegangen war, um den Inspector zu holen, spürte Robert zu seinem Erstaunen eine Nervosität, wie er sie seit seinen Jugendtagen nicht mehr gekannt hatte, als er sich dem Schwarzen Brett mit den Listen der Prüfungsergebnisse näherte. War sein Leben so wohlbehütet, dass das Leiden von Fremden ihn derart aus der Fassung bringen konnten? Oder hatte er in der vergangenen Woche so oft an die Sharpes gedacht, dass sie gar keine Fremden mehr für ihn waren?
Er war, was Hallams Neuigkeiten anging, auf das Schlimmste gefasst; doch was sich aus den vorsichtigen Formulierungen dann entnehmen ließ, war lediglich, dass Scotland Yard ihn hatte wissen lassen, dass man auf der Basis der gegenwärtigen Beweise keine weiteren Schritte zu unternehmen gedenke. Blair fiel das Wort »gegenwärtig« auf, und er wusste, was gemeint war. Die Ermittlungen wurden nicht eingestellt – stellte der Yard überhaupt jemals in einem Fall die Ermittlungen ein? –, man wartete lediglich ab.
Der Gedanke, dass Scotland Yard abwartete, war unter den gegebenen Umständen kein allzu beruhigender.
»Ich nehme an, es fehlt an stichhaltigem Beweismaterial«, sagte er.
»Der Lastwagenfahrer, der sie mitgenommen hat, war nicht zu finden«, bestätigte Hallam.
»Das war nicht anders zu erwarten.«
»Nein«, pflichtete Hallam ihm bei, »kein Fahrer würde seinen Posten riskieren und zugeben, dass er jemanden mitgenommen hat. Schon gar nicht ein Mädchen. Da sind die Bosse streng in den Fuhrunternehmen. Und wenn es sich um ein Mädchen handelt, das in irgendwelche krummen Sachen verwickelt ist, und wenn die Polizei kommt und Erkundigungen einzieht, dann wird kein vernünftiger Mensch sich erinnern können, dass er sie je auch nur gesehen hat.« Er nahm die Zigarette, die Robert ihm anbot. »Diesen Lastwagenfahrer hätten sie gebraucht«, sagte er und fügte hinzu: »Oder sonst jemanden in der Art.«
»Tja«, bestätigte Robert nachdenklich. »Was hatten Sie denn für einen Eindruck von ihr, Hallam?«
»Dem Mädchen? Ich weiß nicht. Nettes Ding. Sah doch ganz anständig aus. Hätte eins von meinen eigenen sein können.«
Dies, ging es Blair durch den Kopf, war ein gutes Beispiel dafür, was ihnen bevorstünde, wenn es jemals zu einem Prozess käme. Jeder Mann mit dem Herzen auf dem rechten Fleck würde seine eigene Tochter in dem Mädchen auf dem Zeugenstand sehen. Nicht, weil sie verwahrlost aussah, sondern im Gegenteil, weil sie das gerade nicht tat. Die ordentliche Schuluniform, das dunkelblonde Haar, das ungeschminkte junge Gesicht mit den sympathischen Grübchen auf den Wangen, die weit auseinanderstehenden treuen Augen – sie war als Opfer der Traum eines jeden Staatsanwalts.
»Sieht aus wie alle Mädchen in ihrem Alter«, sagte Hallam, noch immer mit dem Gedanken beschäftigt. »Nichts, was gegen sie spricht.«
»Sie beurteilen Leute also nicht nach der Farbe ihrer Augen«, sagte Robert vor sich hin, in Gedanken noch bei dem Mädchen.
»Ha! Und ob ich das tue!«, entgegnete Hallam zu seiner Überraschung. »Glauben Sie mir, es gibt eine gewisse Art von Babyblau, da ist für mich ein Mann schon überführt, bevor er überhaupt den Mund aufgemacht hat. Die lügen allesamt wie gedruckt.« Er hielt inne und zog an seiner Zigarette. »Neigen auch zum Mord, wenn ich mir’s jetzt überlege – obwohl mir noch nicht allzu viele Mörder begegnet sind.«
»Sie machen mir Angst«, sagte Robert. »In Zukunft werde ich um alle babyblauen Augen einen großen Bogen machen.«
Hallam grinste. »Solange Sie Ihre Brieftasche geschlossen halten, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Den Babyblauen, denen geht’s nur ums Geld. So einer mordet nur, wenn er sich zu sehr in seine Lügengeschichten verstrickt hat. Das Kennzeichen des wahren Mörders ist nicht die Farbe seiner Augen, sondern deren Stellung.«
»Stellung?«
»Ja, sie stehen verschieden. Die beiden Augen, meine ich. Sie sehen aus, als ob sie zu verschiedenen Gesichtern gehörten.«
»Ich dachte, Sie hätten noch nicht viele Mörder gesehen?«
»Das habe ich auch nicht; aber ich habe sämtliche Berichte darüber gelesen und ihre Fotografien studiert. Ich bin immer wieder überrascht, dass in keiner Abhandlung über Mörder davon die Rede ist, dabei kommen sie so häufig vor. Die ungleichen Augen, meine ich.«
»Das haben Sie sich also ganz alleine ausgedacht.«
»Ja, das Ergebnis meiner eigenen Beobachtungen. Sie müssen einmal darauf achten. Faszinierend. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich schon darauf warte.«
»Bei Leuten auf der Straße, meinen Sie?«
»Nein, ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber bei jedem neuen Mordfall. Ich warte, bis das Foto veröffentlicht wird, und wenn es dann da ist, sage ich: ›Na! Habe ich’s nicht gesagt?‹«
»Und wenn Sie das Foto sehen, und die Augen sind vollkommen symmetrisch?«
»Dann ist es fast immer das, was man einen Unfall-Mord nennen könnte. Die Art von Mord, die jeder begehen könnte, wenn bestimmte Umstände zusammenkommen.«
»Und wenn Sie auf eine Fotografie des Pfarrers von Nieder-Dumbleton stoßen, dem seine Schäfchen ein Geschenk aus Dankbarkeit für 50 Jahre hingebungsvoller Seelsorge überreichen, und Sie bemerken, dass die Augen des Mannes gar nicht schiefer stehen könnten – welchen Schluss ziehen Sie dann daraus?«
»Dass er in glücklicher Ehe lebt, dass seine Kinder ihn ehren, dass er über ein Einkommen verfügt, das seinen Bedürfnissen genügt, dass er sich nicht für Politik interessiert, dass er mit den örtlichen Honoratioren gut auskommt und dass er den Gottesdienst so halten darf, wie er es für richtig hält – kurz, dass er nicht den geringsten Grund hat, irgendjemanden zu ermorden.«
»Na, das scheint mir aber, als ob Sie dann immer recht hätten, ganz egal, wie es kommt!«
»Ach!«, rief Hallam ärgerlich. »Was verschwende ich die Wahrnehmungsgabe eines Polizisten an Ihren Paragraphenverstand. Ich hätte gedacht«, fügte er hinzu, während er sich schon zum Gehen anschickte, »so ein Anwalt wäre froh, wenn er ein paar kostenlose Ratschläge bekommt, wie er einen wildfremden Menschen beurteilen kann.«
»Sie tun nichts weiter«, schalt Robert ihn, »als einen unschuldigen Verstand zu verderben. Von nun an werde ich keinem neuen Klienten mehr ins Gesicht blicken können, ohne dass mein Unbewusstes auf die Farbe und die Stellung seiner Augen achtet.«
»Na, immerhin. Es wurde aber auch Zeit, dass Sie etwas über die Dinge des Lebens erfahren.«
»Danke, dass Sie mir in der Franchise-Sache Bescheid gesagt haben«, sagte Robert, nun wieder ernst.
»Das Telefon in dieser Stadt«, sagte Hallam, »ist ungefähr so verschwiegen wie das Radio.«
»Na, jedenfalls danke ich Ihnen. Das muss ich den Sharpes unverzüglich mitteilen.«
Während Hallam sich wieder auf den Weg machte, griff Robert zum Telefonhörer.
Er konnte, wie Hallam schon angedeutet hatte, am Telefon nicht offen sprechen, aber er würde ihnen sagen, dass er gleich zu ihnen hinauskomme und dass er gute Nachrichten habe. Das würde ihnen erst einmal die Last von der Seele nehmen. Außerdem – er warf einen Blick auf die Uhr – würde Mrs Sharpe gerade ihre Mittagsruhe halten, und er hatte vielleicht eine Chance, dem alten Drachen zu entgehen. Und natürlich bestand Hoffnung auf ein Tête-à-Tête mit Marion Sharpe, auch wenn er diesen Gedanken nicht in sein Bewusstsein dringen ließ.
Doch es ging niemand an den Apparat. Er drängte die gelangweilte und unwillige Telefonistin, es geschlagene fünf Minuten lang zu versuchen, doch es war vergebens. Die Sharpes waren nicht zu Hause.
Während er noch mit der Vermittlung sprach, kam Nevil Bennet hereinspaziert – wie üblich im schreienden Tweedanzug, mit einem hellrosa Hemd und purpurfarbener Krawatte. Robert, der ihn über den Hörer hinweg betrachtete, fragte sich zum hundertsten Mal, was aus Blair, Hayward und Bennet werden sollte, wenn die Firma dereinst aus seinen Händen, dem festen Griff eines Blair, an diesen jungen Spross der Bennets übergehen würde. Dass der Junge Verstand hatte, wusste er, doch mit Verstand kam man nicht weit in Milford. Milford erwartete von einem Mann, dass er die jugendlichen Flausen ablegte, wenn er ins Mannesalter kam. Doch nichts deutete darauf hin, dass Nevil etwas für die Welt außerhalb seines Zirkels übrighatte. Er war nach wie vor, wenn auch unbewusst, damit beschäftigt, diese Welt vor den Kopf zu stoßen – seine Kleidung bewies es.
Nicht dass Robert sich gewünscht hätte, den Jungen im traditionellen feierlichen Schwarz zu sehen. Er selbst trug einen grauen Tweedanzug, und bei seiner ländlichen Klientel würden Stadtkleider nur Misstrauen erregen. »Dieser abscheuliche kleine Mann mit dem Nadelstreifenanzug«, hatte Marion Sharpe in jenem unbeherrschten Augenblick am Telefon den städtisch gekleideten Anwalt genannt. Aber es gab solche und solche Tweeds, und Nevil Bennets Anzüge waren von der letzteren Art, auf eine grässliche Weise von der letzteren Art.
»Robert«, sagte Nevil, als Robert aufgab und den Hörer auflegte, »ich habe die Papiere für die Calthorpe-Überschreibung fertig, und ich dachte mir, wenn du nichts anderes für mich zu tun hast, dann könnte ich vielleicht heute Nachmittag nach Larborough fahren.«
»Reicht es denn nicht, wenn du mit ihr telefonierst?«, fragte Robert. Nevil war – in der lockeren Manier der jungen Leute heutzutage – mit der drittältesten Tochter des Bischofs von Larborough verlobt.
»Oh, es geht nicht um Rosemary. Sie ist für eine Woche in London.«
»Zu einer Protestkundgebung in der Albert Hall, nehme ich an«, brummte Robert, der sich ärgerte, dass er die Sharpes nicht hatte erreichen können, obwohl er doch gute Nachrichten für sie hatte.
»Nein, in der Guildhall«, antwortete Nevil.
»Was ist es diesmal? Vivisektion?«
»Wirklich, Robert, manchmal hast du etwas fürchterlich Viktorianisches«, sagte Nevil in würdevoll geduldigem Ton. »Niemand regt sich heute mehr über die Vivisektion auf, höchstens noch ein paar Verrückte. Es handelt sich um einen Protest gegen die Weigerung dieses Landes, dem Freiheitskämpfer Kotowitsch Asyl zu gewähren.«
»Gegen nämlichen Freiheitskämpfer liegt in seinem eigenen Land ein Haftbefehl vor, soviel ich weiß.«
»Von seinen Feinden, ja.«
»Von der Polizei – wegen zweier Morde.«
»Hinrichtungen.«
»Bist du eigentlich ein Anhänger von John Knox, Nevil?«
»Meine Güte, nein. Was hat der denn damit zu tun?«
»Er glaubte an selbst ernannte Vollstrecker. Hierzulande ist die Idee ein wenig aus der Mode gekommen, soviel ich weiß. Na jedenfalls, wenn ich die Wahl zwischen Rosemarys Meinung zu Kotowitsch und derjenigen der Abteilung Staatsschutz habe, dann glaube ich lieber der letzteren Instanz.«
»Die Abteilung Staatsschutz tut doch nur, was das Außenministerium ihr sagt. Das weiß doch jeder. Aber wenn ich hierbleibe und dir die Tragweite der Affäre Kotowitsch auseinandersetze, dann komme ich zu spät zum Film.«
»Welcher Film?«
»Der französische Film, den ich mir in Larborough ansehen will.«
»Ich nehme an, du weißt, dass die meisten dieser französischen Streifen, die den britischen Intelligenzlern den Atem verschlagen, in ihrem Heimatland als mittelmäßig gelten? Aber genug davon. Meinst du, deine Zeit reicht noch, um am Franchise zu halten und dort einen Zettel durch den Briefschlitz zu stecken?«
»Das werde ich wohl noch schaffen. Ich wollte schon immer wissen, was hinter der Mauer steckt. Wer wohnt jetzt eigentlich dort?«
»Eine alte Frau mit ihrer Tochter.«
»Tochter?«, wiederholte Nevil. Bei dem Wort spitzte er automatisch die Ohren.
»Tochter mittleren Alters.«
»Oh. Gut, ich hole nur meinen Mantel.«
Robert schrieb nur eine kurze Notiz, dass er versucht habe, mit ihnen zu sprechen, dass er für etwa eine Stunde geschäftlich außer Haus sei, sie jedoch anschließend anrufen werde, sobald er könne. Scotland Yard habe – so wie die Dinge stünden – nichts gegen sie in der Hand und habe dies auch zugegeben.
Nevil stürmte herein, ein schauerliches Raglan-Ungetüm über dem Arm, schnappte sich den Brief und verschwand mit den Worten: »Sag Tante Lin Bescheid, dass ich vielleicht später komme. Sie hat mich zum Essen eingeladen.«
Robert setzte seinen eigenen schlichten grauen Hut auf und ging hinüber zum Rose and Crown, um sich dort mit seinem Klienten zu treffen – einem alten Farmer, dem letzten Menschen in England, der unter chronischer Gicht litt. Der alte Mann war noch nicht da, und der sonst so friedliche, so träge und gutmütige Robert verspürte Ungeduld. Sein Leben hatte sich von Grund auf verändert. Bis dahin war es eine gleichmäßige Folge von Ereignissen gewesen, die ihm allesamt interessant erschienen; er war vom einen zum anderen gegangen, ohne Hast und ohne Aufregung. Nun gab es etwas, das im Mittelpunkt des Interesses stand, und alles andere drehte sich darum.
Er ließ sich in einem der mit Chintz bezogenen Sessel des Salons nieder und warf einen Blick auf die eselsohrigen Zeitschriften, die auf dem Beistelltisch daneben lagen. Die einzige aktuelle Nummer war die der Wochenzeitschrift The Watchman, und er griff widerwillig danach, denn wieder einmal ging ihm durch den Sinn, was für ein Gräuel die trockene Oberfläche dieses Papiers seinen Fingerspitzen war und wie sehr ihm der gezahnte Blattrand die Haare zu Berge stehen ließ. Es war die übliche Ansammlung von Dünkel, Dichtung und Dreistigkeit, und unter den Dreistigkeiten war der Ehrenplatz Nevils zukünftigem Schwiegervater gewidmet, der sich in einer dreiviertel Spalte darüber ausließ, was für eine Schande für England es sei, dass man einem Freiheitskämpfer auf der Flucht kein Asyl gewähren wolle.
Der Bischof von Larborough hatte schon vor Langem die christliche Lehre dahingehend ausgeweitet, dass der Unterprivilegierte stets im Recht sei. Er war ungeheuer beliebt bei den Revolutionären des Balkans, bei britischen Streikkomitees und bei sämtlichen alten Knastbrüdern in den örtlichen Vollzugsanstalten. (Die einzige Ausnahme in der letzteren Gruppe war Bandy Brayne, jener unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher, der für den braven Bischof nichts als Verachtung übrighatte und seine Sympathie lieber dem Gefängnisdirektor zukommen ließ – für den war eine Träne nichts als ein Tropfen H2O, und mit findiger, nüchterner Akkuratesse sezierte er auch die herzerweichendsten Geschichten.) Es gab absolut nichts, hieß es bei den Knastbrüdern, was der alte Knabe – und gemeint war der Bischof – einem nicht glauben würde; man konnte ihm den dicksten Bären aufbinden.
Normalerweise fand Robert den Bischof einigermaßen unterhaltsam, doch heute konnte er sich über ihn einfach nur ärgern. Er versuchte es mit zwei Gedichten und verstand keins von beiden; schließlich warf er das Blatt wieder auf den Tisch zurück.
»England macht wieder einmal alles falsch?«, fragte Ben Carley, der an seinem Sessel stehen geblieben war und mit dem Kopf in Richtung The Watchman deutete.
»Hallo, Carley.«
»Hyde Park Corner für die Gutbetuchten«, sagte der kleine Anwalt und blätterte die Zeitschrift verächtlich mit einem gelben Nikotinfinger durch. »Trinken wir etwas?«
»Danke, aber ich warte auf den alten Mr Wynyard. Er geht dieser Tage nicht einen Schritt mehr als unbedingt erforderlich.«
»Da haben Sie recht, der arme alte Knabe. Die Sünden der Altvorderen. Wenn man sich das vorstellt, an Portwein zu leiden, den man niemals getrunken hat! Neulich habe ich Ihren Wagen beim Franchise gesehen.«
»Stimmt«, sagte Robert und wunderte sich ein wenig. Es war gar nicht Ben Carleys Art, so direkt zu sein. Und wenn er Roberts Wagen gesehen hatte, dann hatte er auch die Polizeiwagen gesehen.
»Wenn Sie die Leute dort kennen, dann werden Sie mir eine Frage beantworten können, die mich schon lange beschäftigt. Stimmt das Gerücht, oder stimmt es nicht?«
»Gerücht?«
»Sind es nun wirklich Hexen?«
»Sollen sie denn welche sein?«, fragte Robert leichthin.
»Soviel ich weiß, gibt es viele in der Gegend, die zu dieser Meinung neigen«, sagte Carley; seine strahlenden schwarzen Augen ruhten einen Augenblick lang vielsagend auf Robert, um dann wieder mit ihrem üblichen aufmerksam forschenden Blick durch den Raum zu schweifen.
Robert verstand, dass der kleine Mann ihm stillschweigend eine Information zukommen lassen wollte, von der er annahm, sie müsse ihm nützlich sein.
»Nun ja«, entgegnete Robert, »seit das Kino auch auf dem Lande für Unterhaltung sorgt, ist es ja Gott sei Dank vorbei mit den Hexenjagden.«
»Da wäre ich mir nicht so sicher. Geben Sie diesen Schwachköpfen aus den Midlands einen guten Vorwand, und sie werden sich in Scharen auf die Hexen stürzen. Ein degenerierter Haufen, wenn Sie mich fragen, alles Inzucht. Da kommt Ihr alter Knabe. Na, wir sehen uns noch.«
Eine von Roberts anziehendsten Eigenschaften war das aufrichtige Interesse, das er für die Menschen und ihre Sorgen hatte, und er hörte Mr Wynyards weitschweifiger Geschichte mit einer Freundlichkeit zu, für die der alte Mann dankbar war – und fügte damit, ohne es zu wissen, der Summe einen Hunderter hinzu, die im Testament des alten Farmers unter seinem Namen stand; doch sobald sie mit ihrer Besprechung zu Ende waren, eilte er auch schon schnurstracks zum Hoteltelefon.
Es waren entschieden zu viele Leute in der Nähe, und er beschloss, stattdessen von der Garage drüben in der Sin Lane aus zu telefonieren. Das Büro würde inzwischen verschlossen sein, und außerdem lag es weiter weg. Und wenn er von der Garage aus telefonierte, dachte er, während er bereits unterwegs war, dann hätte er den Wagen gleich zur Hand, falls sie ihn bitten würde – die beiden ihn bitten würden –, zu ihnen hinauszukommen und die Angelegenheit weiter zu besprechen, und das war ja gut denkbar, es war sogar anzunehmen. Ja, natürlich würden sie besprechen wollen, was sie unternehmen könnten, um die Geschichte des Mädchens zu entkräften, ob es nun zu einer Anklage kam oder nicht. Er war so erleichtert über Hallams Neuigkeiten gewesen, dass er noch gar nicht dazu gekommen war zu überlegen, was man –
»’n Abend, Mr Blair«, begrüßte Bill Brough ihn und wuchtete seinen massigen Körper zur engen Bürotür hinaus. »Wollen Sie Ihren Wagen?«
»Nein, zunächst möchte ich Ihr Telefon benutzen, wenn Sie gestatten.«
»Aber sicher. Nur zu.«
Stanley, der unter einem Wagen lag, blickte mit Unschuldsmiene darunter hervor und fragte: »Haben Sie einen Tipp?«
»Nicht die Spur davon, Stan. Habe seit Wochen nicht mehr gewettet.«
»Ich habe zwei Pfund bei einem müden Klepper namens Sicherer Sieger verloren. Das hat man davon, wenn man sein Glück bei den Pferden sucht. Aber wenn Sie mal wieder einen Tipp haben –«
»Das nächste Mal, wenn ich wette, sage ich Ihnen Bescheid. Aber es ist dann wieder ein Pferd, bei dem Sie Ihr Glück versuchen.«
»Solange es kein müder Klepper ist«, sagte Stanley und verschwand wieder unter dem Wagen; und Robert begab sich in das stickige, hell beleuchtete Büro und griff zum Telefonhörer.
Marion war am Apparat, und ihre Stimme klang warm und zufrieden.
»Sie können sich gar nicht vorstellen, was für eine Erleichterung Ihre Nachricht für uns war. Mutter und ich, wir haben beide in Gedanken während der letzten Woche Tüten geklebt. Gibt es das eigentlich noch, Tütenkleben?«
»Ich glaube nicht. Heutzutage ist es etwas Konstruktiveres, soviel ich weiß.«
»Beschäftigungstherapie.«
»Mehr oder weniger.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass Zwangsarbeit an der Nähmaschine meinen Charakter bessern würde.«
»Wahrscheinlich würde man etwas Passenderes für Sie finden. Es widerspricht dem Geist der Zeit, dass ein Strafgefangener irgendetwas gegen seinen Willen tun soll.«
»Das ist das erste Mal, dass Sie bitter klingen.«
»Klang es bitter?«
»Der reine Angostura.«
Nun, immerhin war sie bereits bei den Getränken angekommen; vielleicht würde sie nun vorschlagen, er solle doch vor dem Abendessen auf einen Sherry hinauskommen.
»Einen charmanten Neffen haben Sie übrigens.«
»Neffen?«
»Der, der uns die Nachricht gebracht hat.«
»Das ist nicht mein Neffe«, antwortete Robert kühl. Warum fühlte man sich bloß so alt, wenn man Onkel genannt wurde? »Er ist mein Cousin zweiten Grades. Aber es freut mich, dass Sie ihn mochten.« So ging es nicht weiter; er musste den Stier bei den Hörnern packen. »Ich würde mich gern noch einmal mit Ihnen treffen, um zu besprechen, was wir tun können, um die Sache in Ordnung zu bringen. Für mehr Sicherheit sorgen –« Er wartete.
»Ja natürlich. Vielleicht können wir irgendwann vormittags, wenn wir einkaufen gehen, bei Ihnen im Büro vorbeischauen? Was sollten wir noch unternehmen, Ihrer Meinung nach?«
»Vielleicht eine Art privater Ermittlungen. Ich kann es nicht gut am Telefon besprechen.«
»Nein, natürlich nicht. Wie wäre es, wenn wir am Freitagvormittag vorbeikämen? Das ist der Tag, an dem wir immer einkaufen. Oder haben Sie freitags viel zu tun?«
»Nein, Freitag wäre ausgezeichnet«, sagte Robert und schluckte seine Enttäuschung hinunter. »Gegen Mittag?«
»Ja, das wäre uns recht. Übermorgen um zwölf Uhr in Ihrem Büro. Auf Wiedersehen, und noch einmal vielen Dank für Ihre Unterstützung und Hilfe.«
Sie läutete mit fester und energischer Hand ab, nicht mit dem einleitenden stotternden Klingeln, wie Robert es sonst von Frauen kannte.
»Soll ich ihn für Sie rausholen?«, fragte Bill Brough ihn, als er wieder ins trübe Tageslicht der Garage trat.
»Was? Ach so, den Wagen. Nein, danke, ich brauche ihn heute Abend nicht.«
Er begab sich auf seinen üblichen Abendspaziergang die High Street hinunter und bemühte sich intensiv, nicht gekränkt zu sein. Er war ja beim ersten Mal nur widerstrebend zum Franchise hinausgefahren, und er hatte aus seinem Unwillen keinen Hehl gemacht; da war es ganz natürlich, dass sie dergleichen nicht noch einmal anregen wollte. Dass er ihre Interessen zu den seinen gemacht hatte, war eine rein geschäftliche – unpersönliche – Angelegenheit, die im Büro zu erledigen war. Darüber hinaus würden sie ihn nicht noch einmal bemühen.
Nun ja, sagte er sich und ließ sich im Wohnzimmer in seinen Lieblingssessel fallen, neben dem Kamin, in dem ein Holzfeuer brannte, und schlug die Abendzeitung auf, die am Morgen des Tages in London gedruckt worden war. Wenn sie am Freitag zu ihm ins Büro kamen, würde er schon etwas tun können, um die Sache auf eine persönlichere Basis zu stellen und die Erinnerung an jene erste, unglückselige Weigerung auszulöschen.
Die Stille des alten Hauses beruhigte ihn. Christina war schon seit zwei Tagen in ihrem Zimmer in Gebet und Meditation versunken, und Tante Lin war in der Küche, um das Abendessen zuzubereiten. Er hatte einen übermütigen Brief von seiner einzigen Schwester Lettice bekommen, die mehrere Kriegsjahre lang Lastwagenfahrerin gewesen war, sich dabei in einen riesenlangen, wortkargen Kanadier verliebt hatte und nun in Saskatchewan fünf blonde Rabauken großzog. »Robert, mein Lieber, komm doch bald einmal hier heraus«, schloss der Brief, »bevor die Rabauken groß geworden sind und bevor du völlig verschimmelt bist. Du weißt, was für einen schlechten Einfluss Tante Lin auf dich hat!«
Er konnte sie regelrecht hören, wie sie das sagte. Sie und Tante Lin waren nie einer Meinung gewesen.
Er lächelte, entspannt und in Erinnerungen versunken, doch dann kam Nevil, und seine Ruhe und sein Frieden waren dahin.
»Warum hast du mir denn nicht gesagt, was für eine Frau sie ist!«, wollte Nevil wissen.
»Wer?«
»Na, die Sharpe. Warum hast du mir nichts gesagt?«
»Ich hatte nicht erwartet, dass du ihr begegnen würdest«, antwortete Robert. »Alles, was du tun musstest, war, den Brief durch den Briefschlitz zu werfen.«
»Es gab keinen Briefschlitz an der Haustür, deshalb habe ich geklingelt, und sie waren gerade erst von irgendwoher zurückgekommen. Jedenfalls war sie an der Tür.«
»Ich dachte, sie schläft am Nachmittag.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand jemals schläft. Sie ist ja überhaupt kein menschliches Wesen, sie ist die Essenz aus Feuer und Eisen.«
»Ich weiß, sie ist eine sehr harte alte Frau, aber man darf nicht zu streng mit ihr sein. Sie hat wirklich ein schweres –«
»Alt? Von wem redest du überhaupt?«
»Der alten Mrs Sharpe natürlich.«
»Die alte Mrs Sharpe habe ich gar nicht gesehen. Ich spreche von Marion.«
»Marion Sharpe? Woher weißt du überhaupt, dass sie Marion heißt?«
»Sie hat es mir gesagt. Der Name passt zu ihr, nicht wahr? Sie könnte gar nicht anders heißen als Marion.«
»Ihr scheint euch ja bemerkenswert nahegekommen zu sein für einen Besuch an der Tür.«
»Aber nein, sie hat mich zum Tee eingeladen.«
»Tee! Ich dachte, du hättest es so eilig gehabt, dir einen französischen Film anzusehen?«
»Ich bin niemals in großer Eile, wenn eine Frau wie Marion Sharpe mich zum Tee einlädt. Sind dir ihre Augen aufgefallen? Aber natürlich sind sie das. Du bist ja ihr Anwalt. Diese wunderbare Schattierung von Grau in Haselnussbraun. Und der Schwung der Augenbrauen darüber – wie der Pinselstrich eines begnadeten Malers. Geflügelte Augenbrauen sind das. Ich habe auf der Rückfahrt ein Gedicht darüber verfasst. Willst du es hören?«
»Nein«, wehrte Robert entschieden ab. »Wie war es im Kino?«
»Oh, da bin ich nicht gewesen.«
»Du bist nicht da gewesen!«
»Das habe ich dir doch gesagt, ich war stattdessen bei Marion zum Tee.«
»Soll das heißen, du warst den ganzen Nachmittag über im Franchise?«
»Das muss ich wohl«, bestätigte Nevil versonnen, »aber, bei Gott, ich hätte gedacht, es waren gerade mal sieben Minuten.«
»Und was ist aus deiner Liebe zum französischen Film geworden?«
»Aber Marion ist ein französischer Film. Das muss doch selbst dir auffallen!« Bei diesem »selbst dir« zuckte Robert zusammen. »Warum sich mit dem Abglanz zufriedengeben, wenn man die Gegenwart des Wirklichen genießen kann? Das Wirkliche. Das ist das Besondere an ihr, nicht wahr? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so wirklich ist wie Marion.«
»Nicht einmal Rosemary?« Robert war in einer Verfassung, für die Tante Lin die Bezeichnung »grummelig« hatte.
»Oh, Rosemary ist ein Schatz, und ich werde sie heiraten, aber das hat doch damit nichts zu tun.«
»Tatsächlich?«, sagte Robert in einem nur scheinbar sanftmütigen Ton.
»Aber natürlich. Frauen wie Marion Sharpe heiratet man nicht, genauso wenig, wie man den Wind oder die Wolken heiratet. Genauso wenig, wie man die Jungfrau von Orléans heiratet. Es ist geradezu Gotteslästerung, bei einer Frau wie ihr an Heirat zu denken. Sie war übrigens voll des Lobes für dich.«
»Sehr freundlich von ihr.«
Der Ton war so schroff, dass es auch Nevil nicht verborgen blieb.
»Magst du sie nicht?«, fragte er und hielt inne, um seinen Cousin überrascht und ungläubig zu betrachten.
Nichts war mehr von dem freundlichen, behäbigen, toleranten Robert Blair zu spüren. Im Augenblick war Robert nichts als ein erschöpfter Mann, der auf sein Abendessen wartete und der an der Erinnerung einer Enttäuschung litt, daran, dass man ihn abgewiesen hatte.
»Was mich angeht«, sagte er, »ist Marion Sharpe nichts weiter als eine dürre Frau von 40 Jahren, die mit ihrer ungehobelten alten Mutter in einem hässlichen alten Haus wohnt und dann und wann einen Rechtsbeistand braucht, wie jeder andere auch.«
Doch schon während er das sagte, hätte er es am liebsten zurückgenommen; ihm war, als habe er einen Freund verraten.
»Nein, wahrscheinlich ist sie wirklich nichts für dich«, sagte Nevil verständnisvoll. »Du hast die Frauen ja schon immer lieber ein wenig dumm und blond gemocht, stimmt’s?« Es war nicht boshaft gemeint, vielmehr so, wie man eine eher langweilige Tatsache konstatiert.
»Ich weiß nicht, wie du auf solche Ideen kommst.«
»Sämtliche Frauen, die du beinahe geheiratet hättest, entsprachen diesem Typ.«
»Ich habe niemals jemanden ›beinahe geheiratet‹«, entgegnete Robert gereizt.
»Das denkst du vielleicht. Du weißt ja gar nicht, wie sehr Molly Manders dich schon umgarnt hatte.«
»Molly Manders?«, fragte Tante Lin, die mit rotem Gesicht aus der Küche kam und das Sherrytablett hereinbrachte. »So ein dummes Mädchen. Glaubte, man macht Pfannkuchenteig auf dem Backblech. Und wie sie sich immer in diesem kleinen Taschenspiegel betrachtet hat.«
»Damals hat Tante Lin dich gerettet – nicht wahr, Tante Lin?«
»Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet, Nevil, mein Junge. Stolziere nicht so auf dem Teppich auf und ab, lege lieber noch ein Scheit Holz im Kamin nach. Hat dir dein französischer Film gefallen, mein Junge?«
»Ich war nicht da. Ich war stattdessen im Franchise zum Tee bei den Sharpes.« Er warf einen Blick zu Robert hinüber, denn inzwischen war ihm klar geworden, dass mehr hinter Roberts Reaktion steckte, als es auf den ersten Blick den Anschein hatte.
»Bei diesen seltsamen Leuten? Worüber habt ihr euch denn unterhalten?«
»Berge – Maupassant – Hühner –«
»Hühner, mein Junge?«
»Jawohl; das absolute Böse, das aus dem Gesicht eines Huhns in Großaufnahme spricht.«
Tante Lin blickte zerstreut drein.
Auf der Suche nach festem Boden unter den Füßen wandte sie sich an Robert.
»Meinst du, ich sollte sie auch einmal besuchen, mein Junge, wo ihr sie nun kennt? Oder soll ich die Frau des Pfarrers bitten, bei ihnen vorbeizuschauen?«
»Ich an deiner Stelle würde die Frau des Pfarrers nicht zu etwas so Gravierendem verleiten«, antwortete Robert grimmig.
Einen Augenblick lang wirkte sie unentschlossen, doch die Dinge des Haushalts überlagerten die Frage, die ihr durch den Kopf ging.
»Lasst euch nicht zu viel Zeit mit dem Sherry, sonst verdirbt mir das Essen, das ich im Ofen habe. Morgen wird Christina Gott sei Dank wieder unten sein. Zumindest hoffe ich das; bisher hat ihre Errettung noch nie länger als zwei Tage auf sich warten lassen. Und wenn ich es mir recht überlege – ich glaube, ich werde diese Leute im Franchise doch nicht besuchen, mein Junge, wenn dir nichts daran liegt. Nicht nur, dass sie Fremde sind und sehr seltsame Menschen – ehrlich gesagt, ich habe Angst vor ihnen.«
Das war es, das war ein Beispiel für die Reaktion, die er erwarten konnte, wenn es um die Sharpes ging. Ben Carley hatte sich heute eigens die Mühe gemacht, ihn darauf hinzuweisen, dass er nicht mit unvoreingenommenen Geschworenen rechnen konnte, wenn es im Franchise Schwierigkeiten mit der Polizei geben würde.
Er musste Maßnahmen ergreifen, um die Sharpes zu schützen. Wenn er sich am Freitag mit ihnen traf, würde er vorschlagen, einen Privatdetektiv auf die Sache anzusetzen. Die Polizei war überlastet – seit zehn Jahren und noch länger war sie überlastet –, und es bestand immerhin die Chance, dass ein einzelner Mann, der eine einzelne Spur mit Muße verfolgte, mehr Erfolg hatte, als er den herkömmlichen offiziellen Ermittlungen beschieden war.