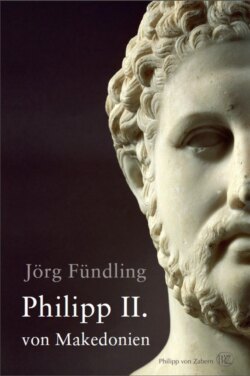Читать книгу Philipp II. von Makedonien - Jörg Fündling - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Drittes Kapitel Die Notbesetzung
ОглавлениеDenn jener Mann herrschte 24 Jahre als König über die Makedonen und machte, gestützt auf winzige Grundlagen, sein eigenes Reich zur größten aller Mächte in Europa; und während er Makedonien übernahm, als es die Sklavin der Illyrer war, machte er es zur Herrin vieler großer Völker und Städte.
Diodor, Historische Bibliothek 16,1,3
Neue Landverluste und vielleicht ein Bürgerkrieg lagen in der Luft. Die Ereignisse des Jahres 399 drohten sich verschlimmert zu wiederholen, und diverse Nachbarn zögerten nicht, das auszunutzen. Bardylis besetzte Obermakedonien. Die Paionen fielen um die Jahreswende 360/59 in das noch kontrollierte Restgebiet ein. Sein prospektiver König, Amyntas IV., war ein Kind.
Unzufriedene hatten eine reiche Auswahl an Alternativen. Pausanias rüstete sich zu einem Vorstoß mit thrakischer Hilfe. In Athen wartete Argaios, vielleicht sein Bruder; ein Flottenverband und dreitausend Hopliten standen bereit, um den Prätendenten heimzugeleiten. Athen mochte die Initiative eines ‚kundigen Thebaners‘ in Pella fürchten oder es schlicht für nützlich halten, chaotische Zustände in seinem Interessengebiet herbeizuführen. Weitere Rivalen stellten Philipps Halbbrüder aus einer zweiten Ehe des Amyntas dar: Archelaos, Arrhidaios und Menelaos. Selbst der siegreiche Bardylis hatte einen konstruierbaren Anspruch auf die Nachfolge. Hier machte sich der Nachteil bemerkbar, nicht mit der Einehe zu operieren – schon eine Hierarchie von Haupt- und Nebenfrauen galt griechischen Beobachtern als destabilisierender Faktor. Aber gerade die Ehebräuche, die das Konglomerat Makedonien momentan zu sprengen drohten, hatten es vorher zusammengehalten.1
Die Argeaden waren nicht berühmt für ihren Familiensinn, wenn es um Herrschaft ging. Philipp und die Verwandten seines Neffen – von Eurydike ist nicht die Rede, vielleicht weil sie nicht mehr lebte – hatten jedoch starke Motive, sich zu arrangieren, statt ein Opfer der entfernteren Verwandtschaft und der Nachbarn zu werden. Die Details der Machtfrage vertagte man auf die Zukunft, falls es eine gab.2
Mitglieder und Vertraute der engeren Königsfamilie zogen mit. Perdikkas’ Witwe(n?) und die Männer aus ihrer Umgebung stimmten zu, als Philipp – vermutlich durch offizielle Ernennung – in die Rolle als Vormund des kleinen Amyntas einrückte, wenn er nicht sogar gleich nach der Königswürde griff. Besonders erklärlich ist beides, falls er bereits Erfahrung als Statthalter und Truppenführer hatte. Einen militärisch unbeleckten De-facto-Herrscher hätten die Aristokraten kaum akzeptiert. Mit Sicherheit war er ein Mann mit aktueller Kenntnis der politischen Landschaft – genau, was das angeschlagene Makedonien brauchte, um Zeit zu gewinnen. Wie durchsetzungsfreudig Philip war, zeigte sich bald, als er in eigenem Namen Münzen aus dem leider allzu knappen Silber prägte; falls die Umgebung des kleinen Amyntas protestierte, konnte er sich mit der kritischen Situation herausreden, die ein starkes Auftreten verlange.3
Philipp fand sich in einem Würgegriff; mit Gewalt konnte er die ungebetenen Besucher nicht loswerden, und im Guten hatte er wenig anzubieten, ohne sein Land oder sich selbst zu ruinieren. Sein Rückhalt in der Heeresversammlung und am Hof reichte für die erste Zeit. Wohl schon jetzt hatte er Helfer, die ihn während seiner ganzen künftigen Karriere begleiten sollten, voran Antipatros oder Antipas, Sohn des Iolaos, und der ältere Parmenion, Sohn des Philotas, mit rund 40 ein erfahrener Militär. Was die neue Herrschaft dringend brauchte, waren Siege und Selbstvertrauen … bis die Voraussetzungen dafür vorlagen, musste sie auf Zeit spielen. Die eigene Schlagkraft musste schneller wachsen, als Kraftproben sie schwächen konnten. Und letzten Endes hatte auch das nicht die Priorität: Philipp wollte schlicht nicht von irgendeinem Pausanias totgeschlagen werden.4
Die Mittel der neuen Politik waren unheroisch. Philipp ging einen Brandherd nach dem anderen an, ohne sich auf einen bestimmten Stil der Krisenbewältigung festzulegen, und zeigte gleich zu Beginn eine besondere Stärke: effiziente Bestechung. Gerichtet war sie auf den Thrakerfürsten hinter Pausanias; dessen Invasion blieb aus, und von Pausanias hörte man seitdem nichts mehr. Woher aber nahm Philipp das Geld? Ein Ausbau des unterentwickelten Landes wurde offenbar angegangen, konnte aber erst nach Jahren die Erträge steigern; Beute hatte die geschlagene Armee nicht gemacht. Womöglich versilberte Philipp königliche Schätze und Landgüter, vielleicht lieh er sich auch bei den Adligen Geld. Athen und seine Verbündeten waren ihm als Kreditmarkt verschlossen, aber natürlich kassierte das marode Königreich bescheidene Steuern und Zölle, so gut es ging – und die Antike kannte keine wirksamen Handelsembargos. Aus denselben unbekannten Quellen kaufte sich der Regent von der Anwesenheit der Paionen los.5
Um andere Gefahren kümmerte sich Philipp auf kostensparende Weise. Archelaos wurde getötet, Menelaos – vielleicht in athenischem Dienst – und Arrhidaios spielten anscheinend keine aktive Rolle. Argaios aber, Athens auserkorener Prätendent, stieß von Methone aus auf Aigai vor. Es gelang ihm, die Königsstadt einzunehmen, dann blieb er stecken und musste umkehren – gefolgt von einem psychologisch gut gezielten Überfall Philipps. Vermutlich hatte Argaios falsch gerechnet: Er führte eine reine Söldnerarmee, da die Athener sich nicht selbst hatten engagieren wollen; in Aigai warteten statt Beute leere Schatztruhen. Indem die Söldner Argaios und seine Begleiter an Philipp auslieferten, bekamen sie Geld ohne Lebensgefahr, Philipp konnte einige Hinrichtungen vollziehen und eine Sorge vergessen.6
Ehe Athen den nächsten Bewerber losschicken konnte, sicherte sich der Regent ab, indem er noch 359 Amphipolis in einem Vertrag abtrat. Die athenischen Unterstützer des Argaios-Coups ließ er frei, ersetzte ihnen die persönlichen Verluste und gab ihnen ein Freundschaftsangebot mit auf den Heimweg. Philipp ging ein extremes Risiko ein, indem er sich von makedonischem Tafelsilber trennte – Adel und Armee konnten diese Serie von Lösegeldzahlungen auf Dauer als Schwäche werten. Die umgängliche, freigebige Art seines Auftretens allein würde ihn dann nicht schützen. Etwas musste geschehen, und zwar bald.7
Die Aufstellung einer neuen Armee war in Arbeit. Über die nächsten Jahre und Jahrzehnte entstand daraus etwas völlig Neues, das die Überlieferung später prompt zum Geistesblitz der Frühzeit und zur Initialzündung der vielen späteren Erfolge erklärt hat. Wann und wie sich der Wandel auch vollzog, er war ein Zusammenspiel von Details. Iphikrates stand Pate, die neue Söldnerkriegführung, Philipps Erfahrung als Herr eines Territoriums, auf dem es weit voneinander entfernte Fronten, aber wenig Geld und Infrastruktur gab und nur selten eine massive Schlacht klassischen Stils.8
Auf den ersten Blick waren es Kleinigkeiten, die Philipp an der Ausrüstung seiner Soldaten änderte. Kombiniert war ihre Tragweite enorm – und es fällt schwer, darin keine maßgeschneiderte Lösung für makedonische Engpässe zu sehen, die umgekehrt künftigen Kriegsgegnern Probleme schuf. Indem die Fußsoldaten der Phalanx statt der üblichen Lanzen von gut zwei Metern etwas viel Längeres in die Hand bekamen – länger auch als die Dreimeterlanzen des Iphikrates –, mussten sie notgedrungen mit einer kleineren, leichteren Form des Hoplitenschildes vorliebnehmen, um die überlange Sarissa halten und, wichtiger noch, aktiv handhaben zu können. Pro Soldat sank damit der Aufwand für die Schildherstellung, eine hochspezialisierte Manufakturarbeit, die Metallbeschläge, Holzbasis und Farbanstrich verband. Die technische Komplikation auf der Offensivseite bestand ‚nur‘ darin, geeignete Hartholzschäfte in der nötigen Länge zu finden. Keine andere Region der hellenischen Welt hätte nach einer Schlacht einige hundert bis tausend Stangen von fünf Metern Länge nachliefern können, selbst wenn sie in der Mitte zerlegbar waren. In Philipps Reich wuchsen genug Kornelkirschen für alle.9
Ein Bataillon (syntagma) der makedonischen Phalanx, 16 Mann tief aufgestellt, in moderner Nachzeichnung. Die Länge der Sarissen ist gut erkennbar; die Schilde sind am linken Arm festgeschnallt.
Verlängerte Lanzen bedeuteten aber zugleich eine vergrößerte Kampfdistanz in der Anfangsphase einer Schlacht. Traf die erste Reihe einer konventionellen Phalanx auf die erste einer makedonischen, dann stießen und stocherten bis zu fünf Sarissen gegen den vordersten Angreifer mit seinem einzelnen Speer. Hinter der zweiten oder dritten Reihe waren die Makedonen umgekehrt außer Reichweite, Fernwaffen ausgenommen. Das wiederum erlaubte eine folgenschwere Kostenersparnis: leichte Rüstungen. So reich an Erz Makedonien war, seine Metallverarbeitung hing noch weit hinter den Poliszentren des Südens zurück; indem man maximal verstärkten Stoff oder Leder an die Stelle einer Metallrüstung setzte, vergrößerte sich die Zahl finanzierbarer Kämpfer schlagartig. Der Trainingsaufwand, bis man eine Sarissa nicht nur halten, sondern auch einsetzen konnte, ohne seinen Nachbarn in die Quere zu kommen oder rasch zu ermüden, war viel höher als bei einer Hoplitenlanze; Söldner und Berufskrieger hatten dadurch Vorteile gegenüber den Bürgerarmeen der Poliswelt.
Das Resultat war eine ‚leichte Schwere Infanterie‘, Mann gegen Mann gerechnet eventuell im Nachteil, in Formation jedoch beweglicher (gerade in hügeligem oder unebenem Gelände, dem Feind jeder Phalanx) und dank der Gewichtsersparnis an Schild und Rüstung auch zu schnelleren Märschen imstande – mit strategischen Folgen für die Mobilität einer Armee. Kam es dann zum Kräftemessen, indem die vordersten Reihen einander vor sich herzuschieben versuchten, war die tiefer aufgestellte Formation im Vorteil.
Eine kopfstarke, darum tiefgestaffelte makedonische Phalanx brachte noch mehr mit, nämlich erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen die veränderte Taktik, die Philipp einführte – die Aufwertung der Kavallerie, die fortan in großen Massen gegen die Flanken der feindlichen Phalanx eingesetzt wurde. Gegen einen Wall aus Spießen hatte, wenn die Infanterie die Nerven behielt, auch eine entschlossene Reiterattacke frontal kaum Chancen. Gegen Speerwerfer und Bogenschützen, eine Gefahr für leicht gepanzerte Hopliten, boten die hochragenden Sarissen der hinteren Reihen, in deren Dickicht sich Geschosse verfingen, zumindest psychologischen Schutz. Bewegliche Kämpfer zu Fuß durften an die Phalanx schlicht nicht herankommen, oder sie konnten die unbeweglichen Spießträger aus der Nähe niedermachen – wie es den makedonischen Nachfolgestaaten in den Kriegen gegen Rom ergehen sollte.
Genau diese Gefahr hatte Philipp im Blick. Seine Antwort war wiederum undogmatisch: Er rüstete eine kleinere Einheit mit kürzeren Speeren aus – die Hypaspisten, die ebenso der Phalanx die Flanken decken wie den Gegner offensiv angehen konnten. Mit der Zeit wurden sie sogar für den Adel attraktiv und entwickelten sich zu einer Art Garderegiment. Die traditionell zahlreiche Kavallerie war nicht vergessen. Mit Lanzen, die so lang wie die des gegnerischen Fußvolks waren, dazu einem Brustpanzer und vor allem einem säbelartig gebogenen Schwert, war sie ideal für Schockangriffe und das Aufbrechen verunsicherter Infanterie.
Ganz uncharakteristisch war schließlich das technische Interesse, das Philipp an den Tag legte. Das Belagern von Städten war bisher eine primitive Angelegenheit; man bezog vor den Mauern Stellung, schnitt die Zufuhr ab und versuchte auf gleiche Höhe mit den Verteidigern zu kommen. Rammböcke, die mehr als Baumstämme waren, oder Belagerungstürme und Schutzvorrichtungen steckten in den Kinderschuhen. Am meisten galt das für eine frisch weiterentwickelte Erfindung, die Artillerie, in der neben die klobigen Katapulte nun Pfeil- und Speerschleudern mit der Federkraft verdrehter Sehnen getreten waren. Wieviel aggressiver und blutiger sich der Kampf um feste Positionen damit führen ließ, scheint Philipp als erster erkannt zu haben. Der Grieche Polyeides war der Spezialist, den der König mit der Entwicklung dieses Potentials betraute.10
Es ist oft und gern nach der „kriegs-“ oder auch „schlachtentscheidenden“ Komponente dieser Neuerungen gefragt worden: Lag sie in der Sarissa, der Kavallerie, dem Belagerungstrain, den Rekrutierungsmethoden? Die Geheimzutat im Rezept existiert wohl gar nicht. Philipp entwickelte ein vielfältiges Repertoire von Werkzeugen zur Kriegführung und Kriegsbeendigung, das spezialisierter, nuancierter und auf die Möglichkeiten des Königreiches wie eigens zugeschnitten war. In einem Fuhrpark von Straßenbaufahrzeugen von der Planierraupe bis zum Fertiger wäre es schwierig, die ‚bauentscheidende‘ Maschine zu identifizieren, ohne die es keine asphaltierte, wetterfeste Fernstraße gäbe. Etwas poetischer verglich Iphikrates das Zusammenspiel von Feldherr und Waffengattungen mit dem von Kopf und Körperteilen.11
Womöglich war die entscheidende Komponente Philipp selbst, der Dirigent dieser Mordinstrumente. Die Anspruchslosigkeit, mit der er auftrat, war ein gewinnender Zug – dringend erforderlich während strapaziöser Kampagnen. Später soll er einem Söldneroffizier aus Tarent das Kommando entzogen haben, weil der Mann sich mit warmem Wasser wusch; bei den Makedonen tue das nicht einmal eine Schwangere während der Geburt. Diese fast eitle Kargheit verfehlte ihre Wirkung nicht; sie erlaubte Zumutungen, die eine Söldnertruppe zurückgewiesen und eine Polisarmee schlicht nicht bewältigt hätte: Märsche von angeblich bis zu 600 Stadien (über 100 km) pro Tag oder Nahrungssuche in voller Bewaffnung. Die Professionalität und Bedürfnislosigkeit der Makedonen wurde mit den Jahren legendär. Noch dazu war Philipp selbst eine Mixtur aus Kondition, Intelligenz und List; beim Ringkampf sollen ihn – wohl an einem heißen Tag – einmal Soldaten umringt und ihren Sold gefordert haben. Der notorisch geldknappe König bat sie, nur schnell bis zum Ende des Kampfes zu warten, sprang unter Gelächter ins Schwimmbecken und erfrischte sich dort in aller Ruhe, bis die Menge die Geduld verlor und abzog. Bei Trinkgelagen soll er sich über seine Idee öfters amüsiert haben.12
Es war noch längst nicht die fertige Armee, mit der Philipp 358 zum ersten Schlag ausholte. Ein kurzer Überfall auf die Paionen, deren König Agis vor kurzem gestorben war, machte den Stamm nominell tributpflichtig. Der nächste Überraschungsangriff mit etwa 10.000 Mann und 500–600 Reitern – vermutlich allem, was das geschrumpfte Reich hergab – galt ausgerechnet Bardylis und den besetzten Teilen Obermakedoniens. Der überrumpelte Sieger über Perdikkas bot eine Machtteilung an; Philipp schlug das gute Geschäft aus, forderte einen kompletten Rückzug der Illyrer und ging aufs Ganze. Neben seiner bedachten Seite zeigte sich hier ein weiterer Charakterzug, der desto wirksamer war, als der Risikospieler in unkalkulierbaren Abständen mit dem Geduldigen wechselte. Philipp, selbst brillant im Einschätzen anderer, entzog sich dadurch selbst der Berechenbarkeit. Der Sieg über Bardylis nahe dem heutigen Monastir – Philipp stand auf dem rechten Flügel der Infanterie – dezimierte die Armee der Gegner und brachte das Land bis zum Lychnitis- (Ohrid-)See wieder unter Kontrolle; noch wichtiger war, wie schnell und überzeugend Philipp die Niederlage seines Bruders gerächt hatte. Einen schwachen Regenten konnte ihn nach diesem spektakulären Auftakt niemand nennen.13
Umgehend trat das Kriegerische wieder in den Hintergrund. Schnell und konsequent gab der Sieger – der Anfang zwanzig war – sich an die Errichtung eines Bündnissystems. Behauptet wird, erst er habe die Tradition begründet, Adelssöhne als Pagen beim König dienen zu lassen; das schuf enge, manchmal erotisch aufgeladene Bindungen an den Herrscher und erlaubte es, Familienrivalitäten in seiner Gegenwart friedlich auszutragen. Umgekehrt galt der Einfluss junger männlicher Partner, der Konkubinen und der sieben namentlich bekannten Ehefrauen auf Philipp – mit einer Ausnahme – als so gering, dass in den Quellen nicht einmal darüber spekuliert wurde.14
Den Frieden mit Bardylis besiegelte die Ehe mit Audata, einer Verwandten des Illyrerfürsten und damit Philipps selbst. Etwa zur gleichen Zeit heiratete Philipp eine Adlige aus den zurückeroberten Gebieten, Phila aus der Elimiotis. In der labilen Lage der Anfangsjahre war diese Verbindung lebenswichtig: ein Mittel, die Lokaldynastie am Unterlauf des Haliakmon bei der Stange zu halten.15
Später blickte man nur auf die dritte Allianz dieser Ära. Noch 358 wurde die Tochter des Neoptolemos aus dem Königshaus der Molosser – welche die Landschaft Epeiros im Westen dominierten – ebenfalls zur Gattin Philipps und hieß fortan Olympias; über ihren ursprünglichen Namen war sich schon die Antike uneins. Angeblich lernten sich beide auf der Insel Samothrake kennen, wo sie in den Mysterienkult der Kabiren eingeweiht wurden. Die Ansichten über sie klingen weit farbenfroher als die überlieferten Einzelheiten. „Alle Frauen dort“, bemerkt Plutarch pikiert, „waren seit uralter Zeit von den orphischen Riten und den Dionysos-Orgien besessen … Olympias, die mehr als alle anderen nach diesen Besessenheiten eiferte und ihre Ekstasen besonders barbarisch austobte, schleppte zahme Riesenschlangen mit in die Kultgemeinden, die … sich oft um die Thyrsosstäbe und Kränze der Frauen wanden, was die Männer erschreckte.“ Sicher gesagt werden kann von der „jähzornigen, düsteren Frau“, dass sie den Hellenen schon wegen ihrer sozialen Rolle unheimlich war. Isokrates hatte die Kritik offizieller Polygamie dem König des zyprischen Salamis, Nikokles, in den Mund gelegt: „Viel schlechten Charakter sehe ich auch an denen, die … keine Freude am Vereinbarten haben, sondern durch ihre eigenen Gelüste den Frauen Kummer machen, von denen sie ihrerseits doch verlangen, sie nie zu bekümmern … Außerdem hinterlassen sie drinnen in den Palästen Aufruhr und Zwietracht, die sie selber treffen.“16
Die unterstellte Dämonie war jedenfalls nicht der Ehegrund. Wie die Argeaden waren auch die molossischen Könige Gerade-noch-Hellenen in Randlage, die sich von Achilleus persönlich ableiteten und der Tradition nach die Macht über ein Barbarenvolk an sich gebracht hatten. Nach dem Sieg über Bardylis reichte Philipps – technisch gesprochen, vielleicht Amyntas’ – Macht wieder so weit nach Südwesten, dass sie molossisches Gebiet erreichte. Die Hilfe der Bergbewohner gegen die lästigen Illyrerstämme nördlich von ihnen war hochwillkommen. Makedonien trat als der stärkere Partner auf, allein das war ein diplomatischer Erfolg; umgekehrt gewannen die Molosser im inner-epirotischen Machtgefüge derart an Rückhalt, dass sie daran denken konnten, den nächsten Schritt hin zu einem stärker integrierten Gebilde wie Makedonien zu tun. An Handel und Verkehr war hier wenig zu holen; die Landwege über die Gebirgsrücken waren so lang wie schlecht, die Häfen der Adria unabhängig oder unter Kontrolle der einen oder anderen Polis im Süden.
Große Expansionspläne gab es für einen Realisten sowieso nicht zu schmieden. Absicherung und das Sammeln von Wohlwollen standen auf Philipps Tagesordnung. Wie verwundbar Makedoniens Grenzen allseits waren, hatte sich sein ganzes Leben lang gezeigt; ein Staat, der nicht mehr mobilisieren konnte als zehntausend Mann für ein, zwei Monate, brauchte eine grundlegende Veränderung seiner Lage. Die Angreifer der Zukunft mussten vor allem dem Kernland, der Küstenebene, fernbleiben; große Eroberungen waren nicht in Sicht, blieb also die Variante, einen Schutzgürtel aus Partnern um die eigenen Grenzen zu legen. Je mehr davon Philipp gewann, desto mehr sank außerdem sein Risiko, von ihnen verraten zu werden. Die Stabilität lieh er sich damit von außen.
Es ist vermutet worden, im Schutz dieser Vorkehrungen habe der Regent einen atemberaubenden Langzeitplan entworfen: Sicherheit sei nur durch Stärke im griechischen Maßstab zu haben, also müsse er Makedonien von Grund auf umbauen – aber wenn ihm das gelänge, könnte er mit den neuen Ressourcen auch gleich ganz Hellas in seinen Zugriff bringen. Für jemanden, dem es an allem fehlte – Geld, Wirtschaftskraft, Truppen, Infrastruktur, Experten, offene Handelswege – war diese Frage sehr weit weg. Allein mit ein paar verbannten Athenern ließ sich die Region nicht in ein zweites Thessalien voller urbaner Verwaltungs- und Handwerkszentren verwandeln. Die regional erhältlichen Hellenen saßen in genau jenen Gebieten, die Makedonien verschlossen waren, oder ‚gehörten‘ Gegnern eines Formats, dem das Königreich nichts entgegenzusetzen hatte: dem Chalkidischen Bund, dem mit seinen Schiffen überall präsenten Athen, selbst der ins Stolpern gekommenen Militärmacht Theben. Gerade jetzt siedelten sich frische Kolonisten aus Thasos in Krenides am Fuß des metallreichen Pangaiongebirges an, direkt vor Philipps Nase.17
In Thessalien ging die politische Krise weiter, für welche die Region sprichwörtlich war. Insgesamt stelle die Landschaft über 3000 Reiter, sei unendlich reich – und sonderbar, regelmäßig besetze eine auswärtige Macht ihre Festungen. Das komme von „Maßlosigkeit und Überheblichkeit“, so Isokrates. Alexandros von Pherai gewann nun die Macht seiner Vorgänger zurück. Pelopidas und seine Nachfolger hatten ihnen zahlreiche Städte abgenommen, selbst aber nie Fuß gefasst, und mit Mantineia war Thebens Spiel vorbei. Athen, schon länger an den Küsten präsent, bekam die Energie des Tyrannen zu spüren; 362 operierte eine brandneue thessalische Flotte in den Kykladen. Diese rasche Erholung Pherais war erstaunlich – und die Aussicht für Philipp, einen expansiven Nachbarn zu haben, unerfreulich.18
Eine umstrittene Nachricht besagt, etwa 358–356 habe Philipp auf aleuadischer Seite in den Machtkämpfen mit Alexandros interveniert. Resultate für diesen Schritt, der ehrgeizig bis halsbrecherisch gewesen wäre, sind nicht bekannt, noch weniger der genaue Zeitpunkt – im selben Jahr wurde Alexandros von Pherai durch die eigene Frau und Schwester Thebe und seine Brüder ermordet. Womöglich handelte es sich nur um sehr bescheidene Hilfe Philipps im Gegenzug für eine weitere Ehe, die zu unbekannter Zeit mit der Aleuadin Philinna geschlossen wurde.19
Wie schnell die Nachbarn bereit waren, ihre Töchter verfügbar zu machen, ist das eigentlich Erstaunliche. Dies weniger aus familiensoziologischer als aus politischer Sicht; vor kurzem war Makedonien nicht mehr viel wert gewesen. Zweifellos konnte Philipp ausgezeichnet verhandeln; vielleicht streute er Befürchtungen, der jeweilige Rivale habe schon Angebote vorgelegt. Erklärlicher würde die schnelle Ausweitung des Systems aus Ehebündnissen – der ‚Harem‘ war eher ein diplomatisches Corps – wenn damit ‚nur‘ an das Vorgehen verflossener Könige angeknüpft wurde. Auch dann bewies es, dass dieser bloße Reichsverweser Prestigezuwachs und materielle Gegenleistungen erwarten ließ. Philipps persönlicher Kredit stieg rasch.20
Letztendlich blieb es aber bei Makedoniens relativer Wehrlosigkeit. Allein eine Verkettung glücklicher Zufälle ließ keine neue Katastrophe eintreten. Athen zum Beispiel stand kurz vor der Heimholung des 421 von ihm abgefallenen Amphipolis. Philipps spärliche Truppen hatten die Stadt 359 vertragsgemäß geräumt; dass sich die Ankunft der athenischen Garnison zu einer weitgreifenden Landnahme ausweiten könnte, musste in Pella ebenso wie in Olynth schlaflose Nächte bereiten – Athen hatte schon öfter Anfälle territorialen Heißhungers gehabt.21
Aber es traf keine Besatzung ein. Allerdings schloss Athen 358 ein Bündnis mit dem Thrakerfürsten Kersobleptes, einem Nachbarn an Philipps Ostgrenze. Gegen makedonische Begehrlichkeiten in Richtung Amphipolis war das eine gefährliche Rückversicherung. Thrakien, schon lange das Operationsgebiet athenischer Truppen und Handelsinteressen, war über Nacht wieder fügsamer geworden. Bis zu seiner Ermordung 359 hatte König Kotys die meisten Thrakerstämme vereinigt und den interessierten Quasi-Kolonialmächten – Athen mit seinen Überseegebieten, Byzantion, dazu verschiedene kleinere Bünde und Poleis – ein Gegenüber auf Augenhöhe geboten. Verdächtig ist, dass Athen die beiden Mörder des Kotys aufnahm und öffentlich ehrte. Einige Jahre später begab sich einer von ihnen, Python, an Philipps Hof. Die Nachfolgefrage wurde ganz im griechischen Interesse – und zweifellos unter starker Einwirkung – durch Zersplitterung gelöst. Im Norden regierte nun Berisades (bald gefolgt von Ketriporis), auf dem Ostufer des Strymon als unmittelbarer Nachbar Makedoniens Amadokos – und weiter im Osten Kersobleptes.22
Alle drei Kotys-Erben wetteiferten um die Gunst Athens, zu dessen Interessen Demosthenes im Jahr 352 eine förmliche Lehrstunde in die Rede gegen Aristokrates schreiben konnte: nur mehrere gleichstarke Thrakerfürsten könnten die Sicherheit der Athener Siedlungen und abhängigen Städte auf der thrakischen Chersones garantieren, die Kotys endlich an die Seemacht zurückerstattet hatte. Gleichwohl liebäugelten athenische Politiker mit einer Exklusivoption auf den aggressiven Kersobleptes, wohl den Haupterben, der bald Krieg gegen die zwei anderen Herrscher anfing.23
Von Philipp war für große Gegner kein Ärger zu erwarten. Nach menschlichem Ermessen war er mit der Konsolidierung des Landes beschäftigt … und seinen Frauen, mochte ein Athener witzeln. Der Achtungserfolg gegen ein paar Barbaren hatte ihm in etwa die Position seiner Vorgänger kurz vor 400 wiedergebracht; eigentliche Feuerproben, gegen andere Illyrerstämme vielleicht, standen noch aus. Athen hatte Verwendung für einen mit sich selbst beschäftigten, gefügigen Holzlieferanten. Denn es zogen Wolken auf: Das ins Stolpern geratene Theben schürte Unzufriedenheit im Seebund, gerade als der Zugriff auf die Mitglieder – nicht zu deren Freude – das Niveau alter Zeiten zu erreichen versprach.
Die Mittelmeerwelt schaute hauptsächlich nach Osten, wo die lange Regierungszeit des zweiten Artaxerxes endete. Irgendwann zwischen November 359 und April 358 bestieg auch hier ein Überraschungskandidat den Thron – Ochos, der jüngere Sohn des Großkönigs, der seine beiden älteren Brüder hatte ermorden lassen. Ob er, ein kriegserfahrener Mann, als Artaxerxes III. die Gebietsverluste seines Reiches revidieren würde, gab der Politik ebenso zu denken wie den Söldnerführern. Makedonien zählte nicht.