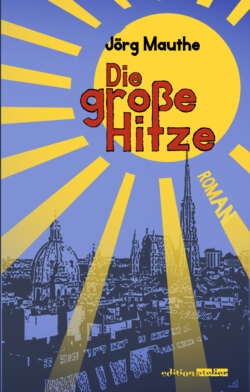Читать книгу Die große Hitze - Jörg Mauthe - Страница 9
EIN ERSTES
ZWISCHENKAPITEL ENTHÄLT MATERIALIEN ZUR
PERSÖNLICHKEITSBILDUNG EINES
ÖSTERREICHISCHEN LEGATIONSRATS
ОглавлениеIn den letzten Jahren der Ersten Republik – also vor 1938 – trafen einander täglich gegen 17.30 Uhr im »Café Ministerium« am Postsparkassenplatz drei hohe Offiziere aus dem nahen Kriegsministerium, um nach Dienstschluß eine Runde Preference zu spielen, ein Kartenspiel zu dritt, das sich besonders gut zur Entspannung eignet, weil es so langweilig ist. Die drei Herren kannten einander seit langer Zeit, zwei von ihnen waren sogar am selben Tage als Leutnants ausgemustert worden. Es verband sie eine innige und vielfach bewährte Freundschaft, an der jeder vor allem den Umstand schätzte, daß sie schweigsam war, weil man einander im Laufe der Zeit alles gesagt hatte, was zu sagen wichtig und notwendig gewesen war. So beschränkte sich denn das täglichen Gespräch auf knappe Fragen nach dem Befinden, die meist mit einem ebenso knappen »No ja« beantwortet wurden. Erst, wenn um Punkt dreiviertel sieben der Kellner an den Tisch trat und vom Generalmajor der Kavallerie S. und vom Feldmarschalleutnant L. die Kosten von je zwei Vierteln G’spritzten samt Trinkgeld in Empfang nahm, kam es zu einem kurzen, jedoch stets gleichbleibenden Dialog, den der General der Infanterie T. mit den Worten: »Warum gehts denn schon?« eröffnete, worauf der Generalmajor sagte: »Wir essen um halb acht, weißt?« und der Feldmarschalleutnant »Schließlich hat die Familie auch ein Recht, weißt?« hinzufügte. »Ehstandskrüppeln«, sagte daraufhin verachtungsvoll der General. Wenn er besonders gut aufgelegt war, setzte er hinzu: »Hätt’ ich mir nie denkt, daß solche Pantoffelhelden aus euch werden täten! Herr Ober – mir noch einen G’spritzten!« – »Du hast es halt g’scheiter gemacht«, sagte melancholisch der Generalmajor. »Servus.« Und gemeinsam mit dem Feldmarschalleutnant spazierte er nach Hause, zurück unter das Joch des Ehestands, während der General T. noch ein Viertelstündchen sitzen blieb.
So ging das fünfzehn Jahre lang Tag um Tag, wenn nicht gerade ein Bürgerkrieg oder ein Putschversuch die Preference verhinderte.
Im sechzehnten Jahr erschien der General T. drei Tage hintereinander nicht zur Preference. Am vierten Tag erhielten seine beiden Freunde auf dem Dienstweg die Mitteilung, daß er an einem Herzstillstand gestorben sei.
Das Begräbnis erfolgte mit allen militärischen Ehren. Und ungeachtet ihrer ehrlichen Trauer waren der Feldmarschalleutnant und der Generalmajor voll des Zornes, denn auf der anderen Seite des Grabes standen eine gebrochene Witwe und ein reizendes vierjähriges Buberl.
Das Buberl war der spätere Legationsrat Dr. Tuzzi.
Die Generalswitwe, Tuzzis Mutter also, hatte ihren viel älteren Mann tief und treu geliebt (er sie übrigens auch). Nach seinem Tode fand sie am Leben keine Freude mehr, wurde eigensinnig und machte sich auf die Suche nach dem eigenen Tod. Sie begann damit, indem sie – es war nun 1938 und aus Österreich eine deutsche Provinz geworden – den Blockwart ihres Hauses ohrfeigte, weil sie ihn für schuldig hielt an der Austreibung einer jüdischen Familie. Der Blockwart hatte jedoch an diesem Geschehnis keinerlei Anteil gehabt, war aber gerade darum über die Ohrfeige der Generalin so empört, daß er im Gefühl gekränkter Unschuld unverzüglich dem Ortsgruppenleiter Meldung erstattete. Dieser Mann, ein sogenannter alter Illegaler, wollte die Sache gütlich beilegen (der verstorbene General war immerhin Maria-Theresien-Ritter gewesen und hatte überdies im Laufe der Piave-Schlacht das Eiserne Kreuz erhalten), suchte also mit einem Blumenstrauß in der Hand die Witwe auf, empfing jedoch bereits an der Wohnungstür zwei kräftige Watschen und trat den Rückzug an. Vielleicht hätte er die Sache auf sich beruhen lassen, wenn er nicht in voller Parteiuniform gewesen wäre und Nachbarn den geräuschvollen Vorgang beobachtet hätten; aber so war natürlich nicht nur seine Ehre, sondern auch die der NSDAP befleckt worden, weshalb er es für seine unabänderliche Pflicht hielt, die Geschichte dem Kreisleiter zu erzählen.
Im weiteren Verlauf der Ereignisse ohrfeigte die Generalin diesen Kreisleiter, dann einen Gestapo-Beamten, einen Obersturmbannführer in Zivil sowie dessen Sekretärin und schließlich den Gauleiter, einen gewissen Buerckel.
Als fromme Frau stiftete sie dem heiligen Antonius in der Alserkirche für jede geglückte Ohrfeige eine Kerze.
Und nachher pflegte sie sich an das Klavier zu setzen und bei weit geöffneten Fenstern laut und mit schöner Altstimme die verbotene Bundeshymne der Ersten Republik zu singen.
Tuzzi, klein und verwirrt, begriff von alledem nicht sehr viel. Aber er bewunderte seine Mutter maßlos, wenn er neben dem Klavier auf dem Teppich saß und zu ihr emporblickte, während sie die feierlich-langsame Haydn-Melodie anschlug und dazu etwas über eine wunderholde Heimaterde sang, die ohne Ende gesegnet sei. Er verstand wenig von diesem Text; aber die Wortfügung »… freundlich schmücket dein Gelände Tannengrün und Ährengold« überwältigte ihn; er konnte sich nichts Schöneres vorstellen als das, ja diese Worte wurden für ihn zu Synonymen des Schönen, Ergreifenden und Erhabenen überhaupt. Und sein Leben lang sollte Tuzzis Seele unausweichlich vom Duft, der Farbe und dem Klang von Tannengrün und Ährengold erfüllt sein, wenn er gerührt oder ergriffen war.
Die Generalin hätte sich mit ihren Ohrfeigen möglicherweise bis zum Führer und Reichskanzler hinaufgearbeitet, wäre sie nicht endlich im Stiegenhaus des Gestapo-Quartiers am Morzinplatz nach einer Vernehmung gestrauchelt und solcherart zu ihrem Tode gekommen.
Des Vaters älterer Bruder übernahm die Vormundschaft. Da dieser Onkel Tuzzi allein lebte – seine Ehe war kurz nach dem Krieg im gegenseitigen Einverständnis geschieden worden –, schickte er seinen Neffen in ein Schweizer Internat. Fünf oder sechs Jahre gingen an dem durch die Ereignisse betäubten Knaben vorbei wie ein unbegreiflicher Traum; immerhin lernte er leicht und willig ein perfektes Französisch und die schwere Kunst, auf sich selbst aufzupassen.
Nach 1945 trat der Onkel wieder in den diplomatischen Dienst, aus dem ihn die Deutschen hinausgeworfen hatten, holte alsbald seinen Neffen in der Schweiz ab und verpflanzte ihn in das wiedereröffnete Jesuitengymnasium in Kalksburg, wo man ihm, wie schon vielen anderen vor ihm, ausgezeichnetes Benehmen, ordentliches Denken und eine gründliche Abneigung gegen jede Art von Frömmigkeit anerzog.
Die Sommer- und Weihnachtsferien verbrachte der heranreifende Tuzzi in den oft wechselnden Auslandsresidenzen seines Onkels, der als Attaché, Botschaftsrat und in ähnlichen Funktionen einen nicht unbeträchtlichen Beitrag zu jener globalen Verösterreicherung leistete, von der noch ausführlich die Rede sein wird.
Der allmählich zum Jüngling sich Gestaltende lernte solchermaßen einige bedeutsame Ausschnitte der Welt und etwas von den vielfachen Mechanismen ihrer Verwaltung kennen. Der Onkel war nach anfänglicher Scheuheit zu einem liebe- und verständnisvollen Freund geworden; da er schon seit langer Zeit nicht mehr jung war, behandelte er den Jüngeren wie einen reifen Mann und erzog ihn damit ohne eigentliche Absicht zu jener Desinvolture, die Tuzzi später bei Kollegen wie bei Frauen so angenehm machte.
Was letztere betrifft, so lernte der Neffe auch an den je nach dem Amtssitz wechselnden Freundinnen des diplomatischen Onkels manches Wichtige und Nützliche.
»Vor allem merke dir«, pflegte der Onkel zu sagen, nachdem er dem Neffen eine neue Michelle, Michiko oder Micaela vorgestellt hatte, »wenn du, wie ich hoffe, ein guter Diplomat werden willst, daß man niemals zu tief in das Wesen der Dinge eindringen darf. Nimm die Dinge, mein Lieber, wie sie sind, und versuche nicht, sie zu verstehen. Ihre Ursachen sind stets verwirrend, unklar und manchmal gefährlich für den, der sie zu begreifen sucht. Das Geheimnis des wahren Diplomaten ist, daß er darauf verzichtet, irgend etwas wirklich verstehen zu wollen. Und dieser Satz, mein junger Freund, gilt auch für die Frauen. Liebe sie, denn sie verdienen es. Ehre sie, denn sie verdienen es, bete sie von mir aus an, denn manchmal verdienen sie sogar das, und jedenfalls werden sie dich dafür lieben. Aber unternimm nie den Versuch – nie! –, sie auch verstehen zu wollen, denn wenn sie das merken, werden sie unerträglich. Ich bin am näherrückenden Ende eines ziemlich langen Lebens zu der festen Überzeugung gelangt, daß alles Malheur dieser Welt nur aus dem Haß kommt, den sie uns entgegensetzt, wenn wir sie begreifen wollen. – Und nun, mein lieber Neffe, würde ich proponieren: Ein Besuch in diesem neuen türkischen Bad im Viertel Shinzasa wäre vielleicht ein hübscher Abschluß des heutigen Abends – stimmst du zu?«
Das war übrigens das letzte Mal, daß Tuzzi von seinem Onkel solche Worte hörte, denn nach seiner Botschaftszeit in Tokio ging der Onkel in Pension. Und wie so viele ehemalige Kalksburger vor ihm rekonvertierte er auf seine alten Tage zur Religion seiner Jugend, tat sich wieder mit seiner Frau zusammen – sie war einst eine gefeierte Schönheit der Wiener Salons gewesen, hatte nach ihrer Scheidung wieder geheiratet und war nun eine würdige Witwe – und unternahm mit ihr eine Wallfahrt zum heiligen Jakobus von Compostela, wo ihn der Schlag traf.
Möglicherweise hatte er einen verspäteten Versuch unternommen, die Dinge doch noch begreifen zu wollen.
Es wird aus den bisherigen Angaben verständlich, warum die Beziehungen unseres Helden zur Welt – soweit sie nicht vom Prinzip des Dienstes an der Legitimität geprägt sind – vornehmlich erotischer Natur sein müssen und sich in den Kategorien der Hingabe, des Wartens auf Erfüllung, der Rücksichtnahme, des Taktes, der Liebe und der Treue bewegen. Infolgedessen scheint es uns, da wir noch ein wenig Zeit haben (denn noch hat Tuzzi, wie wir mit einem schnellen Seitenblick feststellen, die Gehsteigkante auf der anderen Seite des Minoritenplatzes nicht erreicht), sinnvoll, die Biographie des Legationsrates durch eine Liste seiner bisherigen Liebesbeziehungen zu erweitern und zu vervollständigen.
Wir schicken voraus, daß diese Liste nichts Sensationelles enthält, für einen Beamten aber doch recht beachtlich ist.
Mit 3 bis 6 Jahren bewundert Tuzzi seine Mutter. Wenn sie, nach verabreichter Ohrfeige, neben ihm vor dem Bildnis des hl. Antonius kniet oder am Klavier von Tannengrün und Ährengold singt, erscheint sie ihm im Licht der Opferkerzen oder des weit offenen Fensters überirdisch schön wie die Pallas Athene vor dem Parlament.
Mit 8 Jahren liebt Tuzzi ein kleines schwarzhaariges Mädchen, das manchmal in den Zweigen eines Kirschbaumes hinter der Mauer des Internatsgartens sitzt und so lange ernsthaft auf den Turnplatz der reichen Kinder blickt, bis es von einem Lehrer vertrieben wird. Tuzzi träumt, daß er über die Mauer klettern und das Mädchen suchen wird. Dann wird er mit ihm in den Wald laufen; es gibt in der Schweiz so große Wälder, daß man sich leicht in ihnen wird verstecken können. Aus Steinen und Moos werden sie sich ein kleines Haus bauen und am Feuer Pilze und Fische braten. Der Lehrer hat erzählt, daß man zur Not auch von Wurzeln leben kann. Tuzzi sammelt Schnüre und Spagatreste und wird daraus ein Seil flechten. Denn das braucht man in den Bergen. – Eines Tages wird der Kirschbaum gefällt, und das Mädchen läßt sich nie mehr sehen.
Mit 14 Jahren verliebt sich Tuzzi in einen Internisten, der etwas jünger ist als er. Da der Geliebte eine andere Klasse besucht und in einem anderen Flügel des Konvikts untergebracht ist, sieht Tuzzi ihn nur selten und meist nur von weitem, doch fühlt er sich von diesem Anblick jedesmal zu Tränen gerührt. Noch nie hat er etwas so wunderbar Vollkommenes gesehen wie die eleganten Bewegungen, das engelhafte Gesicht und die schmalen Hände jenes Knaben, gegen den er sich selbst häßlich und unsauber vorkommt. Einmal steht Tuzzi vor dem Tor und kramt in seinen Taschen, ob er genug Geld bei sich hat, um sich unten im Ort ein Gefrorenes leisten zu können. Da sagt hinter ihm eine Stimme: »Du hast was verloren …!« Tuzzi fährt herum. Vor ihm steht der andere und hält ihm lächelnd ein Schillingstück hin. Tuzzi glaubt, in der nächsten Sekunde sterben zu müssen. Er wagt nicht, das Geldstück zu nehmen, er fürchtet den entsetzlichen Augenblick, in dem er die Hand und die Haut des anderen berühren wird. Der aber lacht unbetroffen, vielleicht auch verstehend, drückt Tuzzi die Münze in die schwitzende Hand und läuft davon. Tuzzi geht langsam in einen dunklen Winkel des Parks, wird plötzlich von einem hemmungslosen, ihn fast erstickenden Weinkrampf befallen und ist erstaunt, daß er nicht stirbt. Später bringt er den Mut auf, den Vorfall in der Beichte zu verschweigen, und ist von diesem Augenblick an Agnostiker. Erst nach vielen Jahren begreift Tuzzi, daß es nicht Liebe war, was ihn damals so erschüttert hat, sondern der plötzliche, unvorbereitete Anblick der Schönheit. – Im übrigen endete oder verlief sich diese Episode recht prosaisch: Während der Ferien raubte die Pubertät dem anderen durch einen Wachstumsschub und viele Pickel jede Anmut. Und Tuzzi verliebte sich in ein Mädchen.
15 Jahre: Das Mädchen heißt Sylvia, und Tuzzi lernt es im Eisgeschäft des Ortes kennen. Gemeinsam wandern sie nun täglich den Weg zum Eissalon hin und her. Mehr als eine gelegentliche flüchtige Berührung der Hände oder Ellbogen ereignet sich nicht. Dennoch ist es eine große und tiefe Liebe. Noch einmal erlebt Tuzzi, doch diesmal ohne Schmerz, die Erfahrung dessen, was schön ist: Schön ist der sanfte Schimmer ihres dicken, braunroten Haares, schön ist die bräunliche Haut ihres Gesichtes, schön sind die kleinen goldenen Härchen darauf, alles ist schön, alles.
Im Alter von 15½ Jahren verbringt Tuzzi eine Ferienwoche im Landhaus eines Schulfreundes. In der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag betritt dessen Mutter das Zimmer, in dem Tuzzi untergebracht ist, setzt sich an sein Bett, sagt: »Du bist ein hübscher Bub, weißt du das?« und verführt ihn ohne weitere Umstände. Tuzzi lernt nach dem Schrecken und dem Zauber der Liebe auch ihre Erfüllung kennen. Es bleibt übrigens bei dieser einzigen Begegnung, doch gedenkt Tuzzi bis ins reife Mannesalter hinein jener Dame mit Rührung und Dankbarkeit. (O widerführe doch jedem heranwachsenden Jüngling ähnliches!)
Mit 16 Jahren liebt Tuzzi weiterhin die rotbraune Sylvia, vermeidet jedoch unter dem Eindruck des Pfingstnachtereignisses jede weitere Begegnung – nicht so sehr aus schlechtem Gewissen, sondern weil er in intensives Nachdenken über die Vereinbarkeit von Liebe, Bewunderung und Sexus verfällt und die daraus resultierende Verwirrung ihm jede vernünftige Beziehung zu dem Mädchen unmöglich macht. Ein solches Maß an Skrupeln spricht für Tuzzis Charakter, die Tatsache jedoch, daß er den Fronleichnamstag dazu benützt, um an der Mutter eines anderen Schulfreundes seinerseits einen erfolgreichen Verführungsversuch vorzunehmen, für sein Talent, erworbenes Wissen zu praktischer Anwendung zu bringen.
Mit 17 Jahren unterbinden gewisse Schwierigkeiten in den Unterrichtsfächern Mathematik, Chemie und Physik die Verfolgung anderweitiger Interessen. Jedoch wird Tuzzi für diese Abstinenz durch einen Sommeraufenthalt bei seinem Onkel, der gerade sein letztes Diplomatenjahr in Tokio hinter sich bringt, glanzvoll entschädigt. Der liberale Onkel läßt es sich angelegen sein, den Neffen mit den Bequemlichkeiten fernöstlicher Liebeskunst bekannt zu machen1, wobei Tuzzi den angstlosen Eros kennenlernt.
Mit 18 Jahren wird Tuzzi von einem verspäteten und darum umso heftigeren Rilke-Infekt befallen und vermeidet infolgedessen auch weiterhin jede Begegnung mit der immer noch geliebten Sylvia, weil er nun wiederum seine Tokioter Erlebnisse nicht in Kongruenz mit ihr zu bringen vermag. – Dann jedoch wird es Mai, und die Matura wird bestanden, und im Festsaal des Konvikts findet der Abschlußball statt. Und plötzlich, unerwartet, aber heimlich ja doch immer herbeigesehnt, steht in weißem Kleid und hochgesteckten rotbraunen Haares das Mädchen Sylvia da, und es geschieht das, was sonst nur in Jünglingsträumen geschieht: Sie geht geradeaus auf Tuzzi zu und macht einen kleinen Knicks vor ihm, und die kleine Musikergruppe hebt zu spielen an, und wenn sie auch keine Sarabande spielen, sondern den Blacksmith-Boogie und Tuzzi kein besonders guter Tänzer ist – an diesem Abend hat er Flügel und schwebt wie auf Wolken dahin. Im Park unten küßt er sie dann. Und sie hat überraschenderweise ganz kühle Lippen.
19-22jährig: Tuzzi und Sylvia besuchen gemeinsam die juridische Fakultät der Universität Wien. Es vergehen drei Jahre einer ebenso totalen wie verwirrten Glückseligkeit, in der die Begriffe der Rechtswissenschaft und die Worte der Liebe ganz und gar durcheinandergeraten; Bett und Hörsaal, Rigorosum und Liebkosung, Kelsen und van de Velde, die Paragraphen des ABGB und des Kamasutra, römisches Recht und Eros purzeln bunt und leidenschaftlich durcheinander. Tuzzi ist schwindlig vor Glück.
Als er 22½ Jahre alt ist, teilt ihm Sylvia mit, daß sie einen von Tuzzi bisher nur als wesenlosen Schatten im Hintergrund seines Glücks wahrgenommenen Tierarzt aus Kaltenleutgeben heiraten wird. – Tuzzi macht die Erfahrung, daß die alte Redewendung vom Herzen, das zu zerbrechen droht, eine Realität beschreibt. Sein Herz tut ihm tatsächlich zum Zerreißen weh. Die Welt wird von einem Tag zum anderen ein Hades, in dem sich Schatten stumm von ihm abwenden. Zwei volle Jahre lang leidet er sehr, umso mehr, als er nach dem Tode seines Onkels keinen Menschen hat, dem er sich mitteilen könnte, denn natürlich hat er in den Tagen der Verliebtheit keine Freunde gesucht. Diese Einsamkeit kommt jedoch dem Studium zugute, mit dem er sich zu betäuben sucht.
Mit 25 Jahren steht Tuzzi schon vor der Promotion. Er findet Freunde, unter anderen auch den jungen, seinem Studium mit geringerem Erfolg, aber nobler Lässigkeit obliegenden Trotta, und wird mit ihm lange verbunden bleiben. Der Anblick hübscher Kolleginnen schmerzt ihn allmählich nicht mehr, und endlich bemerkt er sogar, daß zwischen diesen Kolleginnen ein eifriger und mit viel Bosheit geführter Wettstreit um seine Gunst im Gange ist – durchaus verständlich, denn Tuzzi sieht nicht nur gut aus, sondern kann sich als Erbe eines wenn auch nicht übermäßigen Vermögens Maßanzüge und sogar ein Auto leisten. Da ihn seine bitteren Erfahrungen zu einem interimistischen Zyniker gemacht haben, wählt er aus diesem Angebot schließlich eine gewisse Elise, ein ausgekochtes, aber recht attraktives Luder, die vermöge ihres Esprits zu anderer Zeit als Mätresse eines großen Herrn ganz gut Karriere gemacht hätte. Das Verhältnis mit ihr ist libertinös und lustig, und es stört Tuzzi nicht einmal, daß sie im weiteren Verlaufe einen bekannten Staatsanwalt heiratet, von dessen hoffnungsloser Leidenschaft sie sehr amüsante Geschichtchen erzählen kann. Diese Beziehung löst sich erst, als Elise sich von einem dritten, einem Jazz-Klarinettisten, schwängern läßt und ihrem glückseligen Staatsanwalt einen Sohn schenkt. Sie würde ihr Verhältnis zu Tuzzi trotzdem ohne weiteres aufrechterhalten, aber der findet die Sache nun doch etwas unappetitlich und verzichtet höflich.
Mit 26 Jahren macht Tuzzi seinen Doktor und beginnt seine Laufbahn im Außendienst der Republik, wie es seinem Namen, seiner Neigung und seiner Erziehung entspricht. Von nun an bis zu seinem vierzigsten Lebensjahr hat er mehrere Liebschaften, Amouren und Verhältnisse, von denen sich jedoch keine als besonders dauerhaft erweist, sehr zu seinem Leidwesen, denn Tuzzi ist ein Mensch mit einer starken, wahrscheinlich durch seine einsame Kindheit bedingten Neigung zu dauerhaften und soliden Beziehungen. Aber er ist auch vorsichtig geworden und stellt unabsichtlich mehr Ansprüche, als die meisten Frauen zu erfüllen bereit oder imstande sind. Die häufigen Auslandsaufenthalte, die der Dienst erfordert, sind dauerhaften Relationen auch nicht gerade günstig; mehr als einmal findet sich der künftige Legationsrat, wenn er von einem Außendienstposten nach Wien zurückkehrt, betrogen oder schon verlassen.
Als 40-Jähriger, kurz vor dem Beginn dieser Aufzeichnungen, ist Tuzzi Legationsrat Erster Klasse und ein noch junger Mann, den seine Freunde und Kollegen hochschätzen, ein Mensch, der zwar etliche Neider, aber keine Feinde besitzt. Wir haben bereits bemerkt, daß er einem Prinzip, dem der Legitimität und der Kontinuität nämlich, treu und der Welt in einer gewissen erotisch gefärbten Weise zugetan ist, woran keine Erfahrung mehr etwas ändern kann. Die mentalen Zwänge seiner großbürgerlich-elitären Herkunft sowie die Repressionen des herrschenden kapitalistisch-bourgeoisen Klassengeistes hat Tuzzi in einem Ausmaß verinnerlicht, das vielleicht nicht den Beifall jener unserer Leser wecken wird, die sich auf der Höhe des augenblicklichen Zeitgeistes befinden, das wir aber sehr hochachten müssen, denn eben dies wird den Legationsrat Tuzzi in die Lage versetzen, eine für sein Land und also auch uns äußerst bedeutsame, wenn nicht sogar lebenswichtige Leistung zu erbringen.
Es bleibt nachzutragen, daß Tuzzi seit mehr als zwei Jahren in ein zum erstenmal wieder dauerhaftes Liebesverhältnis zu einer jungen Dame namens Ulrike hineingeraten ist.
Aber davon später. Wir müssen schleunigst auf den Minoritenplatz zurück, denn länger können wir den Schritt unmöglich verzögern, mit dem der Legationsrat das alte Palais betritt, in dem die Arbeit eines heißen Tages auf ihn wartet.
1 Dem Verfasser dieser Biographie bleibt der verehrungswürdige Diplomat gleichfalls unvergeßlich – oder wenigstens seine in schönster Ballhausplatz-Nasalität vorgebrachte Mitteilung: »… mir is meine Frau davong’laufen, wissen S’!« Pause. »Ich leb’ schon lang als Junggeselle, wissen S’!« Längere Pause. »Aber, wissen Sie: In Tokio g’spürt man das net so stark …«