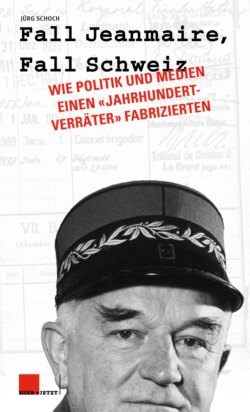Читать книгу Fall Jeanmaire, Fall Schweiz - Jürg Schoch - Страница 7
III. Die Überwachung
ОглавлениеMur mutiert zu Morat
Der Sommer verstrich, die Politik ruhte, die Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte ging ohne Zwischenfall, aber begleitet von kritischen Tönen der bürgerlichen Presse, über die Bühne.
Am 15. August 1975 berief Bundesanwalt Rudolf Gerber eine Konferenz seiner engsten Mitarbeiter ein, um das Dispositiv für Jeanmaires Überwachung zu erstellen. Die Devise, nach der zu handeln war, lautete: maximale Effizienz, maximale Diskretion. Zwei Vorgaben also, die in einem schwierigen Verhältnis zueinander standen. Bis zur Stunde verfügte die Abwehr lediglich über die paar Hinweise der XX-Verbindung, denen die Bupo zwar voll vertraute, die aber vage, teils auch diffus waren und darüber hinaus Handlungen betrafen, die grösstenteils lange zurück lagen. Auf dieser Basis war natürlich nicht an eine sofortige Festnahme oder direkte Konfrontation des Verdächtigen zu denken. Jetzt ging es darum, den Verdacht zu erhärten, seine Vita auszuleuchten und Beweismittel zu sammeln. Im Grunde musste die Abwehr geradezu hoffen, der angehende Pensionär sei noch immer deliktisch tätig, da es andernfalls beinahe unmöglich sein würde, ihm das nachzuweisen, was er laut XX angestellt hatte.
Für die jetzt anbrechende Phase ersetzte die Bundespolizei die Phantombezeichnung Mur durch den Codenamen Morat.
In den folgenden Tagen unterzeichnete der Bundesanwalt eine Reihe von Anträgen zur Überwachung des Telefonverkehrs, die ein Funktionär dem zuständigen Dr. H. beim Rechtsdienst der Generaldirektion PTT persönlich zu übergeben hatte. Sie betrafen Jeanmaires Anschlüsse in seinem Büro, zu Hause in Lausanne und in seiner Absteige in Bern. Dazu kamen etwas später die Anschlüsse zweier Telefonkabinen in Lausanne, die er an Wochenenden regelmässig benutzte, sowie jene seiner Freundin Verena Ogg und im Büro an der Thunstrasse, das ihm nach seiner Pensionierung für die Arbeit an der Zivilschutzstudie zugewiesen worden war. Gleichzeitig mit der Telefon- wurde auch die Postüberwachung angeordnet.
Militärattaché Wladimir A. Pronine, der in der Berner Sowjetbotschaft das Militärbüro leitete, war schon zuvor ins Visier der Bundesanwaltschaft geraten. Oberst Pronine, der englisch, spanisch und französisch sprach, hatte seine Funktion in der Schweiz erst am 24. Januar jenes Jahres aufgenommen. Zwei Wochen später lieferte die XX-Verbindung der Abwehr einen Abriss von Pronines Karriere, der mit der Bemerkung endete: «Auf Grund seiner Stellung wird er als GRU-Funktionär eingestuft.» Am 19. Februar – Monate bevor Mur identifiziert worden war – eröffnete die Bundesanwaltschaft gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Widerhandlungen gegen Artikel 272 StGB und ersuchte die PTT, auch seinen privaten Telefonanschluss zu überwachen.1 Die Telefone von Pronines Adjunkt Wladimir Davidov, der bereits seit 1970 in der Schweiz weilte und sich als Kontaktmann Jeanmaires herausstellen sollte, wurden schon seit längerem abgehört.
Als weitere Massnahme ordnete der Bundesanwalt an, Jeanmaire und die Mitglieder des sowjetischen Militärbüros zu observieren. Es ging darum, «die Nahtstelle zwischen Agent und Führung zu ermitteln. Es muss der Nachweis der ND-Tätigkeit erbracht werden können (Nahtstelle als schwächster Punkt).»2
Alle diese Vorkehrungen markierten den Beginn einer Phase intensiver Beschattung des Brigadiers und seiner wahren oder vermeintlichen sowjetischen Kontaktleute. Die Arbeit, die die Berner, die Waadtländer und die Bundespolizisten leisteten, fand ihren Niederschlag in Hunderten von Seiten amtlichen Papiers, auf denen sie alles, aber auch wirklich alles notierten, was sie sahen, hörten, rochen und fühlten. Das Resultat ist ein polizeiliches Prosawerk, von dessen Lektüre eine eigentümliche Faszination ausgeht. Nicht, weil das Schrifttum sprachliche Genüsse böte – das wird kaum der Zweck polizeilicher Rapporte sein können. Auch nicht, weil die Alltagswelt des alternden, aber noch immer vitalen Beschattungsobjekts besonders reizvoll gewesen wäre. Faszinierend ist die Lektüre vielmehr deshalb, weil sie eine Welt offen legt, die dem Publikum üblicherweise verschlossen bleibt. Eine Welt, in der Augen anders sehen, Chauffeure anders fahren, Zeit eine andere Rolle spielt, Gefühle anders interpretiert und Begriffe oder einzelne Wörter verwendet werden, die den polizeilich nicht geschulten Beobachter amüsieren und seinen Sprachschatz jedenfalls erweitern.
«Chefiturm, tout le monde descend!»
Morat war ein eifriger Stadtwanderer. Die Rapporte schildern, wie er durch Berns Gassen und Gässchen flanierte, wo er Spinat, Fleisch und Früchte einkaufte (die Früchte, vorwiegend Trauben, immer am gleichen Früchtestand), wo er einkehrte (vorwiegend in der «Schmiedstube», im «Schweizergarten», manchmal im «Della Casa»), wie sich seine Laune verschlechterte, wenn die Bedienung wieder einmal zu wünschen übrig liess. Beginn und Ende der Mahlzeiten halten die Rapporte ebenso präzis fest wie das, was er mit sich trug, nämlich eine Mappe mit Zeitungen oder nur Zeitungen, wem er begegnete, ob er die Person lediglich grüsste oder ein paar Worte mit ihr wechselte, wie er sich bewegte (schnell oder langsam), ob er sich umschaute, wann er das Büro betrat oder Feierabend machte und sich den Genüssen des Aperitifs zuwandte:
Um 16.27 verlässt er das Büro und spaziert über die Kirchenfeldbrücke, den Kasinoplatz und Theaterplatz und durch die Marktgasse bis zum Käfigturm. Dort kauft sich Morat beim Marronibrater heisse Marroni. Marroni kauend geht er weiter durch die Neuengasse–Genfergasse nach dem Hotel Krebs, wo er um 16.50 hineingeht […].3
Der Umstand, dass Morat zwei Wohnsitze hatte und daher häufig auf Achse war, erschwerte in gewissem Sinn seine Überwachung. Verliess er die Bundesstadt im Auto und zeichnete sich ab, dass die Fahrt Richtung Lausanne ging, mussten die Berner Polizisten unterwegs ihre Waadtländer Kollegen informieren, wo diese ihn «übernehmen» sollten. Solche Absprachen hatten insofern ihre Tücken, als Mitte der 1970er-Jahre das Handy noch nicht erfunden und auch der Polizeifunk, wie es scheint, nicht immer disponibel war, sodass die Observanten stets nach Telefonkabinen oder Restaurants Ausschau halten mussten. Natürlich zeitigten solche Telefonhalte unangenehme Folgen:
Es ist zu erwähnen, dass Morat eine äusserst schnelle Fahrweise an den Tag legte. In Romont musste unsererseits ein kurzer Halt zwecks Avisierung der Waadtländerkollegen eingeschaltet werden, während dieser Zeit Morat einen Vorsprung herausholen und sich einer Überwachung entziehen konnte.4
Andere Male wurden die Beamten wieder abgehängt, weil die Ampeln im ungünstigsten Moment auf Rot wechselten, ein anderer Wagen ihnen den Vortritt verweigerte oder das Bierauto der Brasserie Beauregard ein umständliches Manöver durchführte.
Dem Observierten hingegen schienen die Fahrten zwischen Lausanne und Bern zu behagen: «Ich bin um 9 Uhr aufgebrochen und ganz gemütlich durch das Pay de Vaud gerollt, dabei wählte ich eine sehr schöne Route, ich kam bei Mézières vorbei», meldete Morat telefonisch einem Freund.5 Mézières, dieses kleine, auf dem Plateau du Jorat gelegene Dörfchen mit seinen knapp tausend Einwohnern hatte Morat ins Herz geschlossen. Sein Name taucht wiederholt in den Rapporten auf, und jedes Mal wird auch der Grund des kleinen Umwegs vermerkt. Es war aber nicht das Geburtshaus von General Guisan, dem Morat regelmässig die Reverenz erwies, auch nicht dem renommierten Théâtre du Jorat, sondern der ortsansässigen Metzgerei, die Bratwürste und Charcuteriewaren verkaufte, welche im Ruf standen, vorzüglich zu sein.
Einfacher gestalteten sich die Filatüren – so lautet der polizeiliche, dem Französischen entlehnte Begriff für Beschattung –, wenn Morat im Zug reiste. Aber auch dann gab es ordentlich zu tun, weil Morat eine unruhige Natur war. Am 31. Oktober 1975 etwa hielten die polizeilichen Protokollanten folgendes Verhalten fest:
14.27 M. in der Halle des HB-SBB in Bern vom ND-Sikripo übernommen. Er ist in Eile und begibt sich sofort nach dem Quai 1. Hält sich dort beim Aufgang auf und blickt ständig nach rückwärts.
14.33 Einfahrt des Schnellzuges aus ZH. M. drängt sich sofort durch die wartenden Reisenden auf dem Bahnsteig und belegt einen Einzelplatz. Schwarze Bügelmappe und kleine schw. Serviette legt er ins Gepäcknetz. Drängt sich sofort durch die Leute im Durchgang nach der Plattform, wo er offensichtlich nach jemandem Ausschau hält. Achselzuckend und mit sich redend nimmt er kurz vor Abfahrt des Zuges Platz.
14.36 Abahrt des Zuges nach Fahrplan. M. gegenüber nimmt ein Herr (Typ BR Ritschard) Platz. Ca. 50-jährig, ca. 185–187 cm, Statur kräftig, trug h/blauen Anzug von der Stange. M. nahm kaum Notiz von seinem Gegenüber, welcher zwei, drei Worte in Französisch (kaum Muttersprache) mit ihm wechselt. M. liest Zeitung …. Kurz vor Ankunft des Zuges in Lausanne zieht M. den Regenmantel an, behändigt die Mappen und begibt sich auf die Plattform. Der andere Herr (erwähnt) folgt dicht auf. Kein Gespräch zwischen den beiden.
15.43 fahrplanmässige Ankunft des Zuges in Lausanne. M. springt, wie üblich, noch im Fahren von der Bahn ab und eilt dem Ausgang zu. 2 Funktionäre des SR-VD hängen sofort an. Kontaktaufnahme mit diesen nicht möglich, da M. sich immer wieder umschaut. Überwachung des sign. Unbekannten, welcher M. im Zuge gegenüber sass. Dieser nimmt vor dem Bahnhof eine Taxe und fährt Richtung Oberstadt davon.6
Ein anderer Rapport vermerkt:
Während des kurzen Aufenthaltes in Romont entdeckt er durch das Fenster, auf dem Perron, einen Soldaten ohne Kopfbedeckung, lässt das Fenster herunter und schnauzt den Mann an. Er verwendet dabei (obschon in Zivil) das Wort Militärpolizei, wonach der «Kerl» sichtlich beeindruckt sein Tenu in Ordnung bringt. M lächelt verschmitzt.7
Oder jener andere Zwischenfall:
An der Neuengasse vor dem Restaurant Hopfenkranz legt sich Morat mit Jugendlichen an und «stürmt» mit ihnen. Ein Jüngling tituliert Morat mit Schimpfnamen (alte Seckel) und lässt ihn einfach stehen. Frau O. kann Morat zum Weitergehen veranlassen […].8
Denkbar ist, dass die mässige Ereignisdichte während der wochenlangen Observierungen die polizeiliche Aufmerksamkeit schmälerte. Am 4. November 1975 allerdings kam bei den Beschattern Alarmstimmung auf. Dank Telefonabhörung war bekannt geworden, dass Morat in die Sowjetbotschaft angerufen und Oberst Davidov verlangt hatte. Weil Davidov nicht anwesend war, versuchte es Morat bei diesem zu Hause. Dort antwortete Frau Davidova, welcher der Schweizer Offizier sein Begehren erklärte, worauf sie umgehend ihren Mann anrief, der sich offenbar doch in der Botschaft aufhielt. Das Gespräch, das für die Bundespolizisten aus dem Russischen übersetzt wurde, verlief folgendermassen:
Frau D: Wolodja, wann fährst Du nach Hause?
Herr D: Etwa in dreissig Minuten. Wieso denn?
Frau D: Komm sogleich her; ich habe Dich nötig.
Herr D: Was? Ein Unglück?
Frau D: Ja, was. Alles ist in Ordnung. Komm her! Um Gottes Willen komm her! Ich kann es Dir nicht am Telefon sagen. Geh nach Hause.9
Das Protokoll vermerkt weiter: «Anfangs war Fau Davidova gefasst; aber man spürte es, dass sie sich beherrschte. Zuletzt war sie im höchsten Grade aufgeregt.»
Was war der Grund dieser Aufregung? Morat wollte den Sowjetoffizier lediglich fragen, ob er abends vielleicht mit ihm zum Hotel Silvahof fahren könne, wo «die Italiener» einen Cocktail gaben zum Tag der Armee. Morat wohnte ganz in der Nähe der Davidovs, und da er auf solchen Cocktails gern mehr als ein Glas trank, trachtete er in der Regel danach, mit jemandem fahren zu können.
Doch der auffällige Telefonverkehr löste eine gesteigerte, jedenfalls raumgreifende Beschattung aus.
Ins Visier nahmen die Polizisten ausser Morat und Davidov auch Leonid Larine, der zum Militärbüro des Sowjetattachés zählte und den Gendarmen einschlägig bekannt war. Larine, in Gümligen wohnhaft, hatte sich immer wieder «aussergewöhnliche Bogen und Tricks» geleistet, war durch eine ungewöhnliche Fahrweise aufgefallen und auch dadurch, dass er, war sein Wagen in der Tiefgarage seines Wohnblocks einmal parkiert, rätselhafterweise nicht, wie man hätte annehmen können, ein paar Minuten später in seiner Wohnung erschien. Diese Eigentümlichkeit irritierte die Beamten und bewog sie wiederholt, in jene Garage zu schleichen, die Kühlerhaube zu befühlen und zu versuchen, den Kilometerstand zu eruieren. Also war es nur natürlich, dass sie sich auch am Abend jenes 4. November an die Fersen Larines hefteten. Viel schaute dabei freilich nicht heraus:
Ungefähr um 21.11 muss L. zu Hause sein und man wartet noch etwas zu um nachzusehen, ob L. wirklich sein Domizil erreicht hat.
21.25 wird am Domizil Nachschau gehalten, aber L. ist noch nicht in der Wohnung, kein Licht in Wohnung und Treppenhaus. Es ist somit anzunehmen, L. gehe nochmals weg oder reviere10 in der Umgebung, wie das schon früher festgestellt wurde.
Ihre Kräfte konzentrierte die Polizei an jenem Novembertag aber auf Davidov und Morat. Tatsächlich konnte sie beobachten, wie der Russe den Schweizer abends nach 18 Uhr abholte und ihn im Auto zum Hotel Silvahof mitnahm. Und wie ein anderer Herr, der sich später als EMD-Pressechef Ernst Mörgeli herausstellte, den Brigadier wieder nach Hause brachte.11
Den Fahndern war an jenem Abend zwar verborgen geblieben, dass Davidov sich während der kurzen Fahrt das «Reglement Zivilschutz und Luftschutztruppen Ausgabe 1972, in drei Sprachen, ein nicht klassifiziertes Reglement»12 aushändigen liess. Aber sie hatten immerhin einen Hinweis darauf, dass der Kontakt, den Morat mit dem Russen pflegte, den Rahmen des Üblichen irgendwie sprengte. Gleichzeitig aber schien ihnen sein Verhalten «vollends unverständlich», denn im Lauf jenes Herbstes hatte der Brigadier Generalstabschef Johann Jakob Vischer ersucht, ihn von den protokollarischen Verpflichtungen gegenüber den sowjetischen Militärpersonen zu entbinden, und zwar mit der Begründung, diese «Saukommunisten» stünden ständig in seinem Büro13.
Es muss also im Kreis der Ermittler eine gewisse Ratlosigkeit geherrscht haben. Und die hielt auch an, denn in den kommenden Wochen sackte das Rendement ihrer Bemühungen wieder auf null ab. Die Rapporte der Waadtländer Polizisten, ohnehin kürzer als jene ihrer Berner Kollegen, beschränkten sich darauf, die Orte anzugeben, an denen Morat gesichtet wurde, beim Käsehändler, auf dem Steueramt, beim Pâtissier, im Lausanner Café des Philosophes, wo er regelmässig «un verre» genehmigte. Wenig Interessantes hatten auch die Berner Beamten zu vermelden, deren Tage oft am Sonnenhofweg 40 ihren Abschluss fanden. In Ermangelung zielführender Erkenntnisse verlegten sie sich darauf, zumindest die Licht- und Schattenspiele in den auf gleicher Etage liegenden Wohnungen von Morat und Fräulein Ogg aufzuzeichnen:
18.30 ist in Morats Wohnung überall das Licht eingeschaltet. Die Nebenwohnung ist noch dunkel. Um
18.40 wird das Licht in der Küche der Nebenwohnung eingeschaltet. Morat selbst hantiert in der Küche.
19.20 wird die Nebenwohnung dunkel und kurz darauf kann die Mieterin in der Küche bei Morat gesichtet werden. Um
19.25 wird die Store bei Morats Küche hinuntergelassen. Das Licht brennt jedoch. Um
20.40 wird es in der Küche dunkel und das Wohnzimmer bei zugezogenen Vorhängen beleuchtet. Die Nebenwohnung bleibt dunkel. – Um
21.00 wird die weitere Überwachung aufgehoben.14
Zu Beginn des Jahres 1976 durften die Polizisten neue Hoffnung schöpfen. Von den ersten Hinweisen auf das Leck hatten sie noch den Hinweis in Erinnerung, die Sowjetagenten hätten in den Wäldern zwischen Lausanne und Bern möglicherweise einen toten Briefkasten eingerichtet. Diesem Versteck glaubten die beiden Wachtmeister der Berner Sikripo, Ba. und Bä., die an jenem kühlen, aber sonnigen Wintermorgen des 9. Januar im Filatüren-Einsatz standen, unmittelbar auf der Spur zu sein.
Noch als es dunkel war, hatten sie mit der Observierung Morats am Sonnenhofweg begonnen. Wir verzichten hier auf die Wiedergabe des morgendlichen Spiels der Lichtquellen und hängen uns den beiden Wachtmeistern zwei Stunden später an die Fersen.
08.56 fährt Morat via Thunstrasse–Kirchenfeldstrasse […] Richtung Flamatt und um
09.15 auf die Autobahn Richtung Freiburg. Die Fahrt geht über Romont–Militärkaserne–Siviriez–Esmonts–Ursy–Rue–Ecublens nach Mézières zur bekannten Metzgerei, wo er um
10.20 durch die Kollegen aus Lausanne übernommen wird. –
Anlässlich dieser Überwachung hat sich folgende Begebenheit zugetragen:
Zwischen Ecublens und Mézières, d. h. 1700 Meter nach der Kapelle in Ecublens und auf der Anhöhe im Wald, ist Morat mit seinem Wagen von der Durchgangsstrasse nach links in den ersten Fahrweg abgebogen und hat nach ca. 50 Metern angehalten. Bei unserm Passieren hatte Morat bereits den Rückwärtsgang eingeschaltet, was anhand der Rückblende sichtbar war. Wir sind zugefahren, haben nach 100 Metern rechts in einen Fahrweg abgebogen und das Auto abseits in den Wald gestellt. Durch den Tannenwald und Kleinholz sind wir nach der Stelle hin, wo sich Morat aufhalten musste, um dessen Tun beobachten zu können. Aus Distanz sahen wir, dass Morat seinen PW inzwischen auf die Durchgangsstrasse manövriert und diesen unmittelbar bei der Einmündung des Fahrweges, Kühler Richtung Mézières, parkiert hatte. Morat selbst befand sich im Waldstück auf unserer Seite. Wegen den einfallenden Sonnenstrahlen konnte nicht gesehen werden, was Morat machte. Jedenfalls begab er sich unvermittelt zu seinem Wagen zurück und fuhr um 10.10 Uhr Richtung Mézières weg. –
Wir haben die ungefähre Stelle, wo sich Morat aufgehalten hat, kurz besichtigt und uns auf einem Umweg auf die Strasse begeben. Gegenüber der Stelle, wo Morat seinen Wagen parkiert hatte, befindet sich ein Grenzstein der Kantone Freiburg und Waadt mit der Jahrzahl 1957, also ein markanter Punkt. –
Von Romont aus haben wir Herrn Kom N. von unsern Wahrnehmungen telefonisch Kenntnis gegeben. Herr Kom N. ordnete an, dass die Stelle zu beobachten und allfällige Passanten oder Motorfahrzeuge zu notieren seien. Er, N., werde mit Herrn Kom Pilliard unverzüglich nachkommen. Nach dem Eintreffen der beiden Kommissäre wurden die Örtlichkeiten gründlich nach einem eventuellen TB [toten Briefkasten] abgesucht. Es konnte festgestellt werden, dass jemand 15 Meter im Waldesinnern und zwar auf der Höhe des erwähnten Grenzsteines, seine Notdurft verrichtet hat. Der Kot, eher dünnflüssig, schien noch frisch. In der Nähe lagen Teile von Papierservietten. Etwas entfernter lag eine Schokoladenhülle, Marke Frigor, mit dem auf der Rückseite aufgeklebten Preis von Fr.1.80.
Herr Kom N. ersuchte uns, abzuklären, wo die Schokolade allenfalls gekauft wurde. Bekanntlich hat Morat bei der Drogerie Schütz am Ostring, beim Kiosk bei der Tramhaltestelle Sonnenhof und Tea Room Tschirren, Kramgasse 73, Einkäufe getätigt. Die getroffenen Erhebungen ergaben, dass die Schokolade beim Kiosk gekauft worden sein könnte, da die dort vorhandenen Frigor-Schokoladen den auf der Rückseite angebrachten Kleber mit dem aufgedruckten Preis aufweisen. Bei der Drogerie Schütz ist keine Schokolade erhältlich und diejenigen vom Tea Room Tschirren weisen keine Kleber auf. –
Es ist somit mit Sicherheit anzunehmen, dass Morat im erwähnten Gebiet seine Notdurft verrichtet hat.»15
Da standen nun die vier Männer im Winterwald und mussten sich damit abfinden, dass ihr kleiner Hoffnungsschimmer, kaum aufgeleuchtet, schon wieder verblasst war.
Wenig später fand wieder ein Cocktail statt, diesmal auf der jugoslawischen Botschaft. Franzosen, Deutsche, Bulgaren, Ungaren, Polen, Rumänen, Norweger, Schweden, Thailänder und Russen fuhren mit ihren Wagen auf, auch die Schweizer stellten eine Delegation, die sich sehen lassen durfte: zwei Korpskommandanten, ein Divisionär, der Chef des Auslandnachrichtendienstes, Spitzenbeamte des EMD – und Morat, der jetzt bereits pensioniert war. Die Polizei setzte nicht weniger als elf Kommissäre, Inspektoren und Wachtmeister in Trab. Ihr Aufgebot mochte deshalb so gross gewesen sein, weil die Ermittler hofften, den am 4. November 1975 gewonnenen Verdacht unüblicher Kontakte von Morat zu erhärten. Aber nichts dergleichen. Der Rapport hält fest, der Observierte habe sich in keiner Weise verdächtig verhalten und sei gemächlichen Schrittes nach Hause gebummelt.16
Ähnlich enttäuschend wie dieser Grosseinsatz verlief, ganz abgesehen von den täglichen Routineüberwachungen, die Aktion Kehrichtsack.
Aus abgehörten Telefongesprächen war der Bupo zur Kenntnis gelangt, dass Morat nach seiner Pensionierung grössere Mengen militärischer Unterlagen von seinem vormaligen Chefbüro der Luftschutztruppen an der Wylerstrasse 52 in seine Absteige am Sonnenhofweg verbracht und nach Neujahr 1976 begonnen hatte, diese Unterlagen neu zu ordnen und jene Schriften, die ihm uninteresssant schienen, zwecks Abfuhr in Plastiksäcke zu stopfen. Also richtete die Bupo nun ihr «besonderes Augenmerk» auf die herausgestellten Abfallbehälter, wenn die städtische Kehrichtabfuhr den Sonnenhofweg bediente.
Die Arbeit an der Abfallfront oblag indes wiederum den Berner Polizisten. Sie fischten Jeanmaires Säcke heraus, überprüften eingehend den Inhalt und gaben sich alle Mühe, zerrissene Aktenstücke «im Puzzle-Verfahren wieder zusammenzusetzen».17 Die Ausbeute war gleich null.
Auch in den folgenden Wochen und Monaten ereignete sich nichts, das als Aha-Erlebnis hätte gewertet werden können. Morat kaufte Trauben, verköstigte sich in der Schmiedstube oder im Schützengarten, machte seine Abstecher zum Metzger in Mézières, arbeitete an der Zivilschutzstudie – courant normal also. Am 13. Februar 1976 wussten die Waadtländer Kollegen zu berichten:
Man erfährt, dass JM in seinem Hotelzimmer18 gefallen sein und ev. ein oder zwei Rippen gebrochen haben soll. Als er um 13.43 mit dem Zug von Bern ankommt, wird festgestellt, dass er sich effektiv mit Mühe bewegt.19
Vermutlich beugten sich die Fahnder in Anbetracht dieses unspektakulären Lebenswandels nochmals über den ursprünglichen Hinweis der Verbindung XX und versuchten, aus jenem ziemlich rätselhaften Text weitere Ansatzpunkte für ihre Ermittlungen herauszulesen. Darin war angedeutet worden, die Eheleute Mur und Mary, die mit Denissenko in Kontakt standen, seien «im Juni 1964 bei einem Treffen in St. Gallen einem andern GRU-Führungsoffizier übergeben» worden. Nur so ist zu erklären, dass die Bundesanwaltschaft im Frühsommer 1976 ihre Netze auch in die Ostschweiz auswarf. Am 16. Juni ersuchte sie den Nachrichtendienst des Polizeikommandos St. Gallen, in der Hotelkontrolle der Jahre 1964/65 nach den Namen Denissenko, Issaev, Zapenko und Khomenko zu forschen. «Die Nachschlagung liegt im Interesse der Abwehr nachrichtendienstlicher Umtriebe», begründete sie ihr Gesuch, in dem aus Gründen der Diskretion von Jeanmaire nicht die Rede war.
Am 7. Juli meldete die St. Galler Kantonspolizei zurück, die Kontrollen seien negativ verlaufen: «Zu erwähnen ist, dass die grössere Anzahl der Polizeistationen keine Nachschau mehr halten konnte, da die Unterlagen fehlten.» Man sei, belehrte die Kantonspolizei den Bundesanwalt, nur verpflichtet, «die Hotelkontrolle während fünf Jahren aufzubewahren». Dennoch fand sie heraus, dass Denissenko am 24. Juni 1961 im Gasthaus Traube in Sevelen und am 4. Mai 1963 im Hotel Hirschen in Wattwil abgestiegen ist. Doch diese Erkenntnis half den Fahndern auch nicht weiter.
Als unergiebig erwies sich auch die Abhörung der Telefone. Was die Protokollanten vernahmen, waren Alltäglichkeiten eines Mannes, der seiner Frau meldete, wann er heimzukommen gedenke, ob er etwas mitbringe oder ob man auswärts essen gehe, welche Namen sie auf die Stimmzettel zu schreiben habe und dergleichen. Telefonierte er im Büro neben Geheimdienstler Bachmann, regte er sich regelmässig über die miserable Qualität seines Apparats auf:
Wr.: Ja
M.: Morat, hören Sie mich gut?
Wr. Ja normal, ja.
M.: Normal?
Wr. Ja ja.
M.: Sehr bestens.
Wr.: Ich nehme auch immer die Hand zur Sprechmuschel, sonst versteht man mich schlecht.
M.: Diejenigen, welche von auswärts kommen, verstehe ich also alle zusammen gut, aber jetzt ist es das dritte Mal, dass man mir heute sagt, man verstehe mich fast nicht.
Wr.: Eben ja, das ist eine Sauerei, mit dem muss man eben rechnen, hähähä, ich hab’s schon gemeldet. Der Herr St. ist schon im Bild, der Chef vom Telefonwesen […].
M.: Weiss er, dass unsere Apparate schlecht sind?
Wr.: Ja ja ja, ja ja, der ist schon durch, hähä, ich kenne ihn gut.
M.: … wer tut abhorchen dort, wer wer?
Wr.: Jä, eben, das ist die Frage.
M.: (lachen) Moskau, nicht wahr, der Kreml?
Wr.: Vermutlich schon. Ich habe schon manchmal etwa, wenn ich es knacken höre und ein Stromabfall drauf habe, wenn ich irgendjemand am Telefon oder wenn ich heim angeläutet habe, habe ich gesagt: «… die verdammten Saucheiben, die verfluchten Sidiane können nur mit Spionage vorwärts kommen, die Sauhunde» und so tue ich etwa am Telefon.
M.: Mh, ich habe bei der alten Abteilung, die ich hatte, auch gemerkt hie und da ist es plötzlich ein wenig leiser geworden, nicht wahr, und da habe ich einfach immer gesagt: «Der Hörer an der Wand hört seine eigene Schand», dann ist es plötzlich wieder gut gegangen.20
Mittlerweile war es Sommer geworden, Morat arbeitete schon ein halbes Jahr an seiner Zivilschutzstudie, und der Bund finanzierte brav die Leistungen des Verdächtigen. Am 8. Juli orientierte er seinen Auftraggeber, UNA-Chef Weidenmann, über den Stand seiner Arbeit:
M.: Und nun wegen der Kadenz der Militär- und Verteidigungsattachés wird sie auf Mitte Jahr nicht fertig, ich möchte das aber gerne fertig machen, diese Arbeit interessiert mich nämlich. Ich möchte nicht künstlich den Auftrag verlängern, ja nicht, das möchte ich also ehrlich gesagt haben. Aber, ich habe Dir sagen wollen, wie wir weiter vorgehen wollen wegen Finanzen usw. damit keine Geschichten entstehen. Du hast schliesslich den Geldsäckel in der Hand.
W.: Jetzt, wie lange hast Du noch?
M.: Nehmen wir an, bis Ende Jahr kann es fertig sein, nicht wahr.
W.: Also das ganze Jahr noch?
M.: Ende Jahr, jawohl, dann ist es fertig, nicht wahr. Wenn ich vorher fertig werde, tant mieux.
W.: Gut, ich muss das da mit meinem Finanzminister besprechen.
M.: Jawohl. Es geht mir also nicht darum, Geld zu verdienen, ich habe mit meiner Pension und mit meiner AHV genug, nicht wahr, das gebe ich Dir unumwunden zu. Wenn Ihr sagen wollt, Ende Juli wollt Ihr abklemmen und wollt mir etwas geben, wenn alles fertig ist, gesamthaft oder irgend etwas, das ist mir gleich, es geht mir also nicht um Geld.
W.: Du hörst noch von mir.
M.: Dann tue ich schön weiter machen und …
W.: … hörst du noch von mir.
M.: Und bekomme Nachricht von Dir.
W.: Richtig.21
Morat konnte sich also, auch wenn ihm die vorsichtige Ungeduld Weidenmanns kaum verborgen geblieben war, weiterhin seines netten Arrangements erfreuen, konnte zwischen Lausanne und Bern pendeln, mal ein paar Tage in der Bundesstadt bleiben und dort das Leben geniessen. Das Geschwätz über die sowjetischen Sidiane, die angeblich sein Telefon abhörten, war mit Sicherheit nicht ernst gemeint; solche Bemerkungen waren damals gang und gäbe. Und darauf, dass es die PTT sein könnte, die sein Telefon abhörte, wäre er nicht im Traum gekommen.
So präsentierte sich der Pensionär in jenen Sommertagen – nicht ahnend, dass es für lange Zeit seine letzten in Freiheit sein würden – in ausgesprochen fröhlicher Laune, schwatzend, trinkend, das Kalb machend. Die Beschatter notierten:
18.53 Morat kommt ebenfalls mit dem Tram von der Stadt her, steigt am Helvetiaplatz aus und geht ins Rest. Kirchenfeld. Er ist mit einem dunklen Blazer, weissem Hemd und Kravatte bekleidet und hat einen hochroten Kopf. So wie er geht, scheint er leicht angetrunken zu sein.
20.30 Uhr Morat und Frl. O. verlassen das Rest. Kirchenfeld. Morat hat nun schwere «Schlagseite» und muss von Frl. O. geführt und gehalten werden. Zusammen besteigen sie die Strassenbahn in Richtung Zentrum. Vor dem Aussteigen bei der Haltestelle Bärenplatz ruft M. mit lauter Stimme durch das Tram: «Chefiturm, tout le monde descend»!22 In der Folge wird Morat von seiner Begleiterin an der Hand aus dem Tram geführt und mit einiger Mühe über den Bärenplatz und durch die Neuengasse direkt ins Hotel Krebs verbracht, wo sie um 20.55 Uhr eintreffen.23