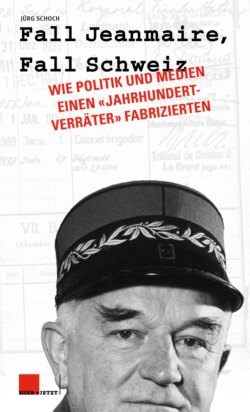Читать книгу Fall Jeanmaire, Fall Schweiz - Jürg Schoch - Страница 8
IV. Die Verhaftung
ОглавлениеDer Bundesanwalt in Zugzwang
Im Gegensatz zu Morat wurden dessen Bewacher und vor allem ihre Vorgesetzten, Bundespolizeichef Amstein und Bundesanwalt Gerber, zunehmend nervös. Insbesondere der Bundesanwalt sah sich in einer wenig beneidenswerten Lage.
Der 1928 im aargauischen Brugg geborene Rudolf Gerber hatte in den Zürcher Justizbehörden Karriere gemacht. Nach seiner Tätigkeit als Bezirksanwalt in Horgen war der dem Freisinn nahestehende Jurist zunächst zum ausserordentlichen, später zum ordentlichen Staatsanwalt des Kantons Zürich aufgerückt. Auf den 1. Oktober 1973 berief ihn der Bundesrat an die Spitze der Bundesanwaltschaft. Seine Person umgab allerdings eine merkwürdige, dem Prestige eines obersten Anklägers kaum förderliche Aura. Im Herbst 1975, als die geheime «Aktion Morat» bereits auf Hochtouren lief, beschuldigte ihn Detektivwachtmeister Kurt Meier, besser bekannt als «Meier 19», vor dem Zürcher Geschworenengericht, er habe seinerzeit als Bezirksanwalt während der Untersuchung des berühmt gewordenen Diebstahls von Zahltagstäschchen Zeugenaussagen manipuliert.
Nicht eben günstig entwickelte sich die Situation für den Bundesanwalt zu Beginn des folgenden Jahres. Am 10. Januar 1976 war Anne-Marie Rünzi, Gattin des bekannten Ballonfahrers Rünzi, in einem kleinen Wald zwischen Zumikon und Zollikon ermordet aufgefunden worden. Die Umstände, die zu ihrem Tod geführt hatten, wurden nie aufgeklärt. Bald aber kursierten Gerüchte, Gerber habe ein Verhältnis mit der Ermordeten gehabt. War damit Bundesrat Furglers Spitzenbeamter, der auf einem der sensibelsten Posten der Bundesverwaltung überhaupt sass, erpressbar geworden?
Exakt diese Frage griff, allerdings erst dreizehn Jahre später, jene Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) unter Nationalrat Moritz Leuenberger auf, die die «Vorkommnisse im EJPD» rund um den Abgang von Bundesrätin Kopp durchleuchtete.1 Im Kapitel «Erpressbarkeit von Bundesanwalt Rudolf Gerber» heisst es:
Das Verhältnis von Bundesanwalt Rudolf Gerber mit dem Mordopfer und die Tatsache, dass er auch mit einer Tatverdächtigen Kontakte hatte, führten zu Spekulationen über eine besondere Verwundbarkeit oder allenfalls sogar Erpressbarkeit des Bundesanwalts […]. Übereinstimmung besteht bei allen angehörten Personen darin, dass die Verwicklungen in den Mordfall R. dem Ansehen des Bundesanwaltes abträglich waren. Es fehlen aber Anhaltspunkte dafür, dass er durch diesen Fall tatsächlich erpressbar geworden wäre.
Diese späte Entlastung ändert indes nichts an der Tatsache, dass im Zeitpunkt des Geschehens das Verhältnis zwischen Gerber und seinem Chef nicht eben harmonisch war. Bundesrat Kurt Furgler, der sein Departement (Justiz und Polizei) rigoros führte und von seinen Leuten nicht nur Loyalität und Einsatzbereitschaft rund um die Uhr, sondern auch moralische Integrität verlangte, duldete schlicht keine Affären, die den Glanz seiner Regierungstätigkeit hätten beeinträchtigen können – schon gar keine Affären dieser Kategorie. Seine Missbilligung liess er den Bundesanwalt denn auch spüren. Und just dieser Mann sah sich jetzt gezwungen, in einer andern Affäre zu handeln, die grösste Risiken in sich barg.
Bereits im Mai hatte der leitende Ermittler, Kommissär Pilliard, in einem Bericht zuhanden des Bundesanwalts gemahnt:
Die Mehrbelastung an Arbeit, die die zahlreichen Beschattungen und Überwachungen verursacht haben, ist nicht mehr erträglich, weder für die Berner noch für die Waadtländer Polizei. Daher sollte man unserer Meinung nach, was «MU R» und «MARY» betrifft, innert kürzester Frist eingreifen.2
Allein die Berner Polizisten hatten Morat während 2000 Stunden observiert.3 Dazu kam der Einsatz der Waadtländer, über deren Aufwand keine Stunden-Buchhaltung vorliegt. Zieht man in Betracht, dass an den Filatüren stets zwei, oft aber deutlich mehr Beamte teilnahmen, so kommt man auf eine Anzahl Mannstunden, die bei 10 000 oder eher darüber liegen dürfte. Hinzuzurechnen ist der Aufwand für die Telefonabhörung und die Abfassung der entsprechenden Protokolle, der, da Jeanmaire von gesprächsfreudiger Natur war, ein imposantes Ausmass annahm.
«Mit der Überführung Jeanmaires wurde möglichst lange zugewartet, um möglichst viel Material verfügbar zu haben», gaben die Berner Polizeikommandanten vor der Arbeitsgruppe Jeanmaire zu Protokoll. Diese Aussage suggerierte, die in der Tat enormen Anstrengungen hätten schöne Erfolge erzielt. Dem war nicht so. Von «Material», das im Zeitpunkt der Festnahme Jeanmaires eine «Überführung» erlaubt hätte, konnte nicht die Rede sein. Kommissär Pilliard bilanzierte die Überwachungsaktion, die beinahe ein ganzes Jahr gedauert hatte, in internen Berichten mit entwaffnender Nüchternheit:
Die technischen und physischen Überwachungen gaben der Berner und der Waadtländer Polizei viel zu tun. Doch wir müssen einräumen, dass nichts Konkretes festgestellt werden konnte, das erlaubt hätte, mit Sicherheit zu sagen, «MU R» arbeite noch immer für die Sowjets. Die Postkontrolle brachte kein Resultat. Sie konnte nicht unter normalen Bedingungen durchgeführt werden, da der Briefträger, der die Wohnung des Betreffenden bediente, nicht alle Sicherheitsgarantien erfüllte.
Auch die Telefonkontrolle brachte uns nichts Entscheidendes ausser jenem Gespräch, das Jeanmaire am 4. November 1975 mit Davidov führte und bei dem er diesen bat, ihn zu Hause abzuholen und zum Silvahof zum Empfang der Italiener zu chauffieren.4
Dennoch zweifelte Pilliard nicht im Geringsten daran, dass «Mur» und «Mary» für die Sowjets arbeiteten. Er fühlte sich in seiner Überzeugung schon deshalb bestärkt, weil in zwei ähnlich gelagerten, freilich viel weniger bedeutenden Fällen die Informationen, die man aus der Quelle XX schöpfen konnte, sich als richtig erwiesen hatten.
Es gab einen weiteren Grund, weshalb Pilliard den Bundesanwalt zum Handeln drängte. Bei den Fahndern hatte sich in jüngster Zeit der Eindruck verstärkt, ihr Objekt gleite ihnen mehr und mehr aus den Augen. Die sich abzeichnende Unübersichtlichkeit hatte mit dem «Röstigraben» zu tun. Kommissär Hofer umschrieb die Sachlage in seinem bereits erwähnten Bericht so:
Trotz des Sonderauftrages des Generalstabschefs für die Zeit nach der Pensionierung hielt sich JM im Sommer 76 immer seltener an seinem Arbeitsplatz in Bern auf, wo er intensiv überwacht werden konnte.
Die vermehrte Präsenz in Lausanne bewirkte unüberwindliche Überwachungsprobleme. Die Sicherheit der Observationsmassnahmen war in der heimischen Umgebung des Brigadiers nicht mehr gewährleistet. Es bestand zudem die Gefahr, dass die Führung des JM bei vermehrter Präsenz in Lausanne an die GRU-Residentur in Genf hätte übergehen können.
JM bemühte sich im Sommer 76 um die Erhaltung seiner Informations- und Dokumentationsquellen im EMD, verlor aber gleichzeitig (vermutl. wg. der Haltung des Departementschefs EMD) den Kontakt zu verschiedenen Kollegen in Bern. Sowohl im EMD wie auch im Kt. VD bestand die Gefahr, dass JM durch verändertes Verhalten von Bekannten und evtl. Indiskretionen hätte gewarnt werden können.
Alle diese Gründe bewogen den Bundesanwalt schliesslich zur Intervention. Dabei war ihm bewusst, dass er sich auf ein riskantes Spiel einliess. Zwar hielt Hofer in seinem Bericht fest, die im Ermittlungsverfahren zusammengetragenen Belastungsfragmente hätten «eine stabile Grundlage für die bevorstehende Einvernahme von JM» ergeben. Damit beschönigte er die Situation. Tatsache war, dass die Polizei praktisch mit leeren Händen dastand. Vor der Arbeitsgruppe Jeanmaire musste später auch der Bundesanwalt einräumen, «rechtsgenügende Beweise» für ein strafbares Verhalten hätten im Zeitpunkt der Festnahme keine vorgelegen.5
Bis jener Zeitpunkt endlich da war, befleissigte sich die kleine Schar der Eingeweihten absoluter Diskretion. Sie pflegten die formellen Kontakte mit den Sowjets und erfüllten mit staunenswerter Kaltblütigkeit selbst die Pflichten der Courtoisie, die ihnen ihre Ränge auferlegten. Anfang Juli lud der Chef des Militärprotokolls, Oberst Erich Kipfer, verschiedene Militärattachés, darunter den sowjetischen, zusammen mit den Chefs des Generalstabs, der Fliegertruppen und des Geheimdienstes in sein Wochenendhaus am Murtensee ein, wo die Herren in Begleitung ihrer Damen einen ungezwungenen Sommerabend verbrachten.6
Mitte Juli trafen sich UNA-Beamte auf dem bundeseigenen Landsitz Lohn mit einer Dreierdelegation des westdeutschen Bundesnachrichtendienstes. Eines der Themen, über die man sich austauschte, war der Zivilschutz in der DDR. Eigentlich war vorgesehen, auch Jeanmaire einzuladen, war er in jenem Zeitpunkt doch der Mann, der dank seiner Studie die Materialien am gründlichsten kannte. Sein Beizug musste den Verantwortlichen dann doch zu riskant erschienen sein, jedenfalls unterblieb das Aufgebot an den Brigadier.7
Der 9. August 1976
Den Haftbefehl hatte Bundesanwalt Gerber bereits am 6. August 1976 ausgestellt. Doch erst drei Tage später war es so weit. Jeanmaire schlägt in jenen Passagen seiner Memoiren,8 in denen er aufzeichnete, wie der Schicksalstag begann, geradezu lyrische Töne an: «Es war der 9. August 1976. Ich mag die Morgenstunden, wenn die Luft frisch und fast unverdorben über der Stadt liegt …» Der Brigadier war Frühaufsteher, oft riss ihn sein Tatendrang schon um drei Uhr aus den Federn, spätestens aber um sechs, wie auch an diesem Montag, sodass er sich Zeit nehmen konnte, gemütlich die kleinen Arbeiten des Morgens zu erledigen und seiner «kranken Frau einen sanften Kuss auf die Stirn zu drücken». Danach machte er sich auf den Weg zum Bahnhof, die Morgenluft tief einatmend, den Anblick des ihm ans Herz gewachsenen Parks Mon Repos mit seinen ruhig und gravitätisch im Erdreich stehenden Bäumen geniessend und, wie so oft, über die moderne Volkskrankheit sinnierend, die sich darin manifestiere, «dass man zu spät aufsteht, um dann den ganzen Tag damit zu verbringen, die verschlafene Zeit einzuholen».
Den Haftbefehl stellte der Bundesanwalt am 6. August 1976 aus. Festgenommen wurde Jeanmaire am Morgen des 9. August 1976, kurz nachdem er seine Wohnung in der Avenue du Tribunal Fédéral verlassen hatte.
Auf seinem Gang durch das morgendliche Lausanne weilte er in Gedanken schon in Bern, malte sich aus, wie er «bei einem Schwatz mit Oberstleutnant Albert Bachmann, dem pfeifenrauchenden Rotschopf», einen Kaffee trinken und sich danach den Listen und Tabellen seiner Zivilschutzstudie widmen würde. Dergestalt versunken, beachtete er die beiden Männer am Rand seines geliebten Parks zunächst nicht. Dann überstürzten sich die Ereignisse:
Als ich sie bemerkte, war es zu spät auszuweichen, selbst wenn ich das gewollt hätte. Da ich jedoch für den Nachrichtendienst arbeitete, beunruhigte es mich nicht weiter, als die eine der beiden Gestalten mir den Weg vertrat. Er wies sich als Kommissär der Bundespolizei aus. Sofort schaltete mein Gehirn von Privatmann und Rentner auf Brigadier und Waffenchef. Ich sagte nichts, zog meine Brauen zum berühmten finsteren Bogen zusammen und schaute den Polizisten fragend an. Vage kam er mir bekannt vor, aber ich hätte nicht zu sagen vermocht, woher. «Mein Name ist Louis Pilliard, Kommissär Bundespolizei. Dies ist mein Kollege Lugon, Sicherheitspolizei des Kantons Waadt. Nehmen Sie bitte in diesem Wagen Platz, wir haben Ihnen einige Fragen zu stellen!»
Die zwei Beamten fuhren mit dem Brigadier zur Mercerie, dem Büro des waadtländischen Untersuchungsrichters, und führten ihn dort in einen kleinen, vergitterten und dazu schlecht gelüfteten Raum. Nachdem man Platz genommen hatte, eröffnete Kommissär Pilliard seinem Gegenüber, um was es ging:
Erstens: Es bestehen gravierende Lecks in Richtung Osten!
Zweitens: Sie haben sich mit Russen getroffen …
Drittens: Sie werden festgenommen auf Befehl von Bundesrat Furgler.
Viertens: Sie werden das Gefängnis nicht mehr lebendig verlassen.
Ob sich jene Szene wirklich so abgespielt hat, wie sie Jeanmaire in seinen Memoiren formuliert, lässt sich nachträglich nicht mehr rekonstruieren. Das erste «Abhörungsprotokoll»9 hält, aber dies liegt wohl in der Natur der Sache, einen weniger dramatischen Einstieg fest:
Frage: Sie werden einvernommen als Folge einer vom Herrn Bundesanwalt eröffneten gerichtspolizeilichen Untersuchung wegen möglichen Verstössen gegen die Artikel 27410 und 30111 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs. Was antworten Sie darauf?
JM: Ich nehme Kenntnis davon.
Frage: Sagen Sie uns, mit welchem Diplomaten oder Funktionär östlicher Länder Sie während den letzten Jahren in offiziellem oder privatem Kontakt standen.
JM: Ich hatte vor allem Kontakte mit sowjetischen Militärattachés, die versuchten, das Unrecht zu reparieren, das meinen Schwiegereltern widerfuhr, die Russland nach der Revolution verlassen mussten […].
Jeanmaire schreibt in seinen Memoiren, im ersten Moment habe sein Denken ausgesetzt, und ein Schock sei ihm in die Glieder gefahren. Die beiden Polizisten hatten mit ihrer Taktik genau das bewirkt, was sie erhofft hatten: Jeanmaire war überrumpelt. Und als er sich fürs Erste gefasst hatte, suchte er Zuflucht in der irrigen Meinung, das über ihn hereingebrochene Ungemach sei ein Missverständnis, das er, der befehlsgewohnte Brigadier, rasch würde aus der Welt schaffen können. Die Zeit, sich eine klare Strategie für die anstehende Befragung auszudenken, nahm sich der Festgenommene nicht – oder, wohl eher zutreffend, diese Zeit wurde ihm nicht gewährt. Dafür fiel er, was kaum überrascht, in jenes Grundmuster seines Charakters, das sich wie ein roter Faden durch die unzähligen Qualifikationszeugnisse und Führungsberichte zieht, die sich im Lauf seines Instruktorenlebens angesammelt hatten: in seine Redseligkeit.
Jeanmaire redete – lang, ausführlich, zahlreiche Details weit zurückliegender Geschehnisse erwähnend, was ihm, der über ein ausgezeichnetes Gedächtnis verfügte, keine Mühe machte. Er redete, diesen Eindruck vermittelt das erste Protokoll, bereitwillig und sich offenbar in der Gewissheit wiegend, bei den beiden Polizisten Verständnis für sein Tun zu wecken. Er erzählte ihnen, wie sich die Kontakte mit Sowjetattaché Denissenko angebahnt hatten, wie er diesen Russen bei sich zu Hause empfing, wie es dazu kam, dass er ihm 1964 den Offiziersetat des Jahres 1961 überliess, die Ordre de bataille des 2. Armeekorps zeigte und der Sowjetoffizier danach ein Couvert hervorzog:
Vielleicht war es an jenem Tag, als Denissenko mir einen Umschlag mit Geld hinstreckte. Dieser war geöffnet und ich sah, dass sich Hunderter- oder Tausendernoten darin befanden. Ich warf dieses Couvert auf den Tisch und erklärte, dass ich mich nicht kaufen lasse. Meine Frau wohnte dieser Szene bei, und Denissenko nahm den Umschlag wieder an sich. Er wollte mir das Geld unter dem Vorwand anbieten, die Verluste wieder gutzumachen, die meine Schwiegereltern anlässlich der Revolution erlitten hatten.
Einige Zeit später, teilte Jeanmaire den Polizisten weiter mit, sei bei ihnen anonym ein Schwarzweiss-Fernseher abgeliefert worden:
Ich konnte mir vorstellen, dass dieses Geschenk von Denissenko kam. Obwohl wir den Apparat störend und kompromittierend fanden, behielt ich ihn bis 1975. Letztes Jahr schenkte ich ihn der Organisation «Jugend und Sport» in Bern.
Jeanmaire machte im Lauf jenes ersten Vernehmungstags weitere Angaben über seine sowjetischen Kontaktpartner. Um die Mittagszeit suchten die drei ein Restaurant auf. «Es gab ein Glas Wein und die Atmosphäre entspannte sich ein wenig», hält Jeanmaire in seinen Memoiren fest, wogegen das Protokoll vermerkt: «Jeanmaire wollte während der Mittagspause weder essen noch trinken.» Anschliessend fuhr die Troika zur UBS Lausanne. Die beiden Polizisten wünschten Einblick in den Banksafe des Brigadiers. Dort lagen seine vier Sparbüchli, anhand derer er zu beweisen suchte, dass er nie irreguläre Zahlungen erhalten hatte. Zum Vorschein kamen allerdings auch jene andern Geschenke, die Denissenko dem befreundeten Ehepaar gemacht hatte: eine Krawattennadel und ein Paar Manchettenknöpfe aus Gold für ihn, Jean-Louis, ein Collier (mit Anhänger) und eine Armspange, ebenfalls aus Gold, für sie, Marie-Louise.
Kaum hatte Jeanmaire an jenem Morgen sein Domizil an der Avenue du Tribunal Fédéral verlassen, läutete es an seiner Wohnungstür. Polizei. Die Gendarmen präsentierten Frau Jeanmaire einen Hausdurchsuchungsbefehl und unterzogen auch sie einer ersten Einvernahme. Auf die Frage, ob sie die sowjetischen Diplomaten bei sich zu Hause empfangen habe, erklärte sie kategorisch:
Hier, in meiner Wohnung oder auch anderswo in Lausanne habe ich nie einen Funktionär der sowjetischen Botschaft getroffen. Diese Zusammenkünfte fanden stets in Bern, in der Botschaft, statt […].
Ich bin sicher, dass mein Mann nie einen Funktionär der Botschaft in Lausanne eingeladen oder getroffen hat.12
Sie verneinte ferner, einen Fotoapparat oder Einrichtungen zu besitzen, um Filme zu entwickeln. Sie sei auch nie beauftragt worden, von sowjetischen Diplomaten Post zu erhalten und an Dritte weiterzugeben oder anderweitige Dienste zu leisten. Und im Auftrag ihres Mannes habe sie den Sowjets nie Dokumente übergeben. Die Einvernahme ging um 10.45 Uhr mit folgendem Schlusswort zu Ende:
Ich habe die ganze Wahrheit gesagt und wünsche nicht, meinen Erklärungen etwas beizufügen.
In der Mittagspause tauschten die beiden Einvernahme-Teams ihre Erkenntnisse aus. Somit wussten die beiden Beamten, die bei Frau Jeanmaire gewesen waren, was ihr Mann über die häuslichen und ausserhäuslichen Kontakte mit «den Russen» und deren Geschenke ausgesagt hatte. Und ein Blick in die beschlagnahmten Agenden13 von Frau Jeanmaire, die in einer späteren Phase des Verfahrens noch Gegenstand weit verzweigter, geradezu abenteuerlicher Recherchen werden sollten, zeigte rasch, dass ihr apodiktisches Schlusswort die «ganze Wahrheit» betreffend so nicht stimmen konnte.
Um 14.45 Uhr meldeten sich die Beamten wieder in der Wohnung und konfrontierten Frau Jeanmaire mit Fragen nach Denissenkos Besuchen. Sie antwortete:
Ich bestätige meine Antwort vom Morgen in dem Sinne, dass ich nie einen sowjetischen Funktionär zu Hause empfangen habe, an der 38, avenue du Tribunal Fédéral.
Einrede der Beamten: Trotz Ihrer negativen Antwort wissen wir, dass Herr Denichenko14 zwischen 1960 und 1964 mehrere Male in Ihre Wohnung gekommen ist. Ihr Mann war auch anwesend, und Sie haben zu Dritt in Restaurants der Umgebung von Lausanne gegessen. Was sagen Sie dazu?
Tatsächlich ist diese Person zwei oder dreimal zu uns in unsere Wohnung gekommen und wir sind, wenn ich mich recht erinnere, essen gegangen in Savigny und in Villars-Sainte-Croix […].
Warum haben Sie unsere Frage erst bejaht, nachdem wir Ihnen genauere Details unterbreitet hatten?
Seit drei Jahren bin ich halbseitig gelähmt, was häufige Gedächtnisverluste verursacht.
Danach wollten die Beamten wissen, ob die Attachés ihr und ihrem Mann Geschenke überreicht hätten. Frau Jeanmaire antwortete: «Nein, nie.» Die Polizisten legten ihrerseits dar, was sie wussten, worauf Frau Jeanmaire den Empfang von Geschenken bestätigte. Die Polizisten wurden zunehmend stutzig:
Sie verneinten, zu Hause Funktionäre der sowjetischen Botschaft empfangen zu haben, Sie reagierten gleich, als wir Sie nach Geschenken fragten, und erst, nachdem wir Ihnen Beweise vorgelegt haben, gaben Sie ihre Handlungen zu. Ihr Verhalten lässt vermuten, dass Sie ihren Mann decken wollen. Wie antworten Sie?
Ja, das ist richtig.
Trifft es zu, dass Denissenko Ihrem Mann in Ihrer Wohnung, in Ihrer Gegenwart, eine bedeutende Summe Geld in einem Umschlag geben wollte?
Ich habe keine Erinnerung daran. Persönlich bekam ich nie Geld und ich erkläre, dass dies auch für meinen Mann zutrifft, in der Wohnung. Trifft es zu, dass Ihr Mann Denissenko und seinem Nachfolger verschiedene Dokumente übergab, dies in Ihrer Gegenwart und sogar auf Ihre Anregung?
Nein, das ist nicht wahr. Ich weiss auch nicht, ob mein Mann so gehandelt hat und Dokumente übergab.
Wie erklären Sie den Wert der Geschenke, die Ihnen von diesen beiden Personen gegeben wurden?
Sie wollten uns eine Freude machen, da ich in Russland geboren wurde.
Wieder endete die Einvernahme mit der Erklärung Frau Jeanmaires, sie habe nichts beizufügen oder irgendwelche Modifikationen anzubringen.
Interessant ist, wie unterschiedlich die beiden Eheleute in diesen ersten Verhören reagierten. Wählte der Mann, in zahlreichen Kursen geschult in taktischem Denken, den Weg der Mitteilsamkeit und Kooperation, ja beinahe der Bonhomie, so versuchte die Frau, wenn auch mit geringem Erfolg, die Befrager mit taktischen Finten zu täuschen. Nachteilige Folgen hatten ihre Falschaussagen für sie indes kaum. Erstens schaltete auch sie schon zwei Tage später auf Kooperation um, zweitens nahm die Polizei auf ihren Gesundheitszustand Rücksicht – und in gewisser Weise schien den Beamten sogar zu imponieren, wie verzweifelt die angeschlagene Frau versuchte, ihren Mann in Schutz zu nehmen.
Doch zurück zum Schauplatz der Hauptfigur. Gegen Abend eröffnete Kommissär Pilliard, immer laut Protokoll, dem Festgenommenen:
Der Herr Bundesanwalt, der über den gegenwärtigen Stand der Untersuchung informiert ist, hat beschlossen, Sie zu seiner Verfügung zu halten und daher einen Haftbefehl gegen Sie ausgestellt, den wir Ihnen hiermit unterbreiten. Morgen wird ein Vertreter des Bundesanwalts sie anhören und Ihnen die Anschuldigung bekannt geben. Was haben Sie dazu zu sagen?
Ich nehme es zur Kenntnis.
Wir teilen Ihnen mit, dass wir Sie nach Abschluss dieser Anhörung ins Gefängnis Bois-Mermet in Lausanne überstellen werden. Haben Sie Reklamationen anzubringen über den Ablauf der bisherigen Behandlung? Wir teilen Ihnen auch mit, dass Ihre Gattin nach ihrer Einvernahme zu Hause verbleibt im Beisein Ihres Sohnes. Was antworten Sie? Ich habe keine Reklamationen anzubringen.
Mit der Abwicklung dieser Formalitäten ging der erste Vernehmungstag zu Ende. Unter den obligatorischen Vermerk am Schluss des Protokolls («gelesen und bestätigt») setzte Jeanmaire seine Unterschrift in gewohnt schwungvoller Manier, ebenso unter den Haftbefehl, den ihm Pilliard präsentierte. Zunächst hatte der Brigadier zwar Anstalten gemacht, diese zweite Unterschrift zu verweigern. Doch rasch sah er ein, dass mit Obstruktion nichts auszurichten war; als ehemaliger Militärrichter wusste er, dass man Haftbefehle zu unterzeichnen hatte. Also griff er zur Feder und signierte seine «Fahrkarte zur Hölle».15
Chefermittler Pilliard muss Bundesanwalt Gerber bereits um die Mittagszeit über Jeanmaires Aussagen ins Bild gesetzt haben. Denn um 15 Uhr verfasste dieser eine Notiz16 an seinen Vorgesetzten, Bundesrat Furgler. Sie lautet:
Br Jean-Louis Jeanmaire, Lausanne
wurde heute früh wegen Verdachts des verbotenen militärischen und politischen Nachrichtendienstes von unserem Polizeidienst angehalten und einvernommen. Die Befragung sowie die ebenfalls angeordneten Hausdurchsuchungen sind noch im Gang. Vorläufiges Ergebnis: Jeanmaire gibt zu, den Russen gewisse klassifizierte Dokumente ausgehändigt zu haben, u. a. eine «ordre de bataille». Offenbar als Gegenleistung will er ein Fernsehgerät erhalten haben.
Sobald ich Näheres weiss, werde ich Sie orientieren.
Da Sie seinerzeit Herrn Bundespräsident Gnägi persönlich über den auf Jeanmaire lastenden Verdacht in Kenntnis gesetzt hatten, nehme ich ohne Gegenbericht an, dass Sie dies auch heute selbst tun wollen.
Offenbar im Bewusstsein, mit dieser Notiz ein Dokument in Händen zu halten, das den Beginn einer historischen Affäre anzeigte, vermerkte der Departementschef auf dem Papier in seiner steilen und etwas zackigen Handschrift die präzise Uhrzeit der Kenntnisnahme und die Anordnungen, die er in den folgenden Minuten traf: nämlich, dass er von der Bundesanwaltschaft «wünsche, über alle weiteren Massnahmen und deren Ergebnisse unverzüglich orientiert zu werden», und dass er den Bundespräsidenten jetzt und auch weiterhin selbst orientieren werde.
Am Abend jenes 9. August 1976 durften der Bundesanwalt und sein Chefermittler Pilliard einen kleinen, vorsichtigen Triumph feiern. Jeanmaire hatte angebissen, hatte seine inoffiziellen Kontakte zu den Russen und auch die Übergabe gewisser Dokumente zugegeben. Und das Verhalten seiner Ehefrau, gerade weil sie sich widerständiger zeigte als ihr Mann, lieferte ihnen zusammen mit den beschlagnahmten Agenden immerhin ein paar interessante Ansatzpunkte für die kommenden Verhöre. Um es bildlich zu formulieren: Gerber und Pilliard mochten sich fühlen wie zwei Bergsteiger, die lange vor einer Wand gewesen waren, die unbegehbar schien, und die nun einen Einstieg entdeckt hatten.
Erfolglose Suche nach Belastungsmaterial
Viel Musse, das kleine Glück des verheissungsvollen Starts zu geniessen, blieb den Ermittlern allerdings nicht. Die folgenden Tage verlangten ihnen hohe Präsenzzeiten ab. Die Verhöre gingen weiter, und eine ganze Reihe anderer Erkundungen war in die Wege zu leiten.
Der kurze Augenschein im Banksafe der UBS, den die beiden Polizisten in Gesellschaft Jeanmaires vorgenommen hatten, hatte wohl eine Übersicht über dessen Vermögenslage vermittelt. Doch die Ermittler wollten tiefer graben. Jeanmaire, sagten sie sich, war von den Russen «gekauft». Also musste Geld geflossen und der Judaslohn auf irgendeinem Bankkonto versteckt worden sein.
Deshalb wandte sich die Bundesanwaltschaft brieflich an jene fünf Banken, mit denen der Verhaftete Verbindungen hatte. In den vertraulichen Schreiben, das die Bupo-Kommissäre den Direktoren persönlich zu übergeben hatten, wurden die Institute ersucht, Auskunft über Jeanmaires Bankverkehr zu geben. Freundlich, aber bestimmt formulierte der Bundesanwalt in den gleich lautenden Schreiben folgende Warnung an die Adresse der Empfänger:
Wir erlauben uns schliesslich, Sie unter Hinweis auf Art. 205 des Schweizerischen Strafgesetzbuches zu ersuchen, ohne ausdrückliches Einverständnis seitens des Unterzeichnenden oder seiner gesetzlichen Stellvertreter […] weder mit Ihrem Kunden, noch dessen Geschäftspartner, noch allfälligen Bevollmächtigten oder anderen Drittpersonen über dieses Auskunftsersuchen und die Auskunftserteilung durch Ihr Institut Rücksprache zu nehmen.17
Auf Verlangen der Bundesanwaltschaft lieferte in jenen Tagen die Generaldirektion PTT ihrerseits eine Aufstellung von Jeanmaires Postcheckverkehr seit 1973 ab, ein dickes Bündel von Listen, in denen sich – vergleichbar mit den Bankauszügen – aber lediglich ein Geldverkehr spiegelte, wie er für einen Haushalt des gehobenen Mittelstandes üblich ist.18 Bald schon gelangten die Ermittler denn auch zur Einsicht, finanzielle Interessen seien bei Jeanmaires Verrätereien vermutlich doch nicht im Spiel gewesen. «Aufgrund der bisherigen Auswertungen des finanziellen Hintergrundes liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, aufgrund derer J. der Empfang von Geldzuwendungen nachgewiesen werden könnte», heisst es im Sachbearbeiter-Protokoll vom 20. August 1976, und eine Woche später, als die Ermittler und ihre Chefs erneut Motivforschung betrieben, hielt der Protokollführer fest: «Was das Motiv betrifft, scheint nach den heutigen Erkenntnissen Geld vermutlich keine Rolle gespielt zu haben.»19
Damit gab – obgleich noch nicht definitiv, wie sich zeigen sollte – die «finanzielle» Fährte, von der man sich etwelche Druckmittel für die Einvernahmen erhofft hatte, bald nichts mehr her.
Wenn die von der EMD-Bürokratie speditiv zusammengestellten Ausland- und Ferienabwesenheiten Jeanmaires den Ermittlern ebenfalls keine brauchbaren Anhaltspunkte verschafften, so hoffte man, wenigstens in dessen Büro an der Thunstrasse 22 fündig zu werden. Zwei Tage nach seiner Verhaftung räumten drei Bupo-Beamte im Beisein von Oberstleutnant Bachmann seinen Schreibtisch.
Das Resultat ist zusammengefasst in einem «Hausdurchsuchungsprotokoll»,20 aus dessen sieben eng beschriebenen Seiten dem Leser der Hauch des Unheimlichen entgegenweht – nicht, weil diese Seiten brisante Hinweise auf ein verwerfliches Tun enthalten hätten, sondern weil sich darin polizeiliche und buchhalterische Akribie in höchster Vollendung paarten und ein Dokument hervorbrachten, dessen Erscheinungsbild in irritierendem Gegensatz steht zu seinem banalen Inhalt. Im «Pult, Schublade oben links», im «Pult, Schublade rechts mitte» usw. fanden die Fahnder: einen Nasenspray, Heftpflaster, Mahlzeitencoupons, ein Stempelkissen, Blei- und Filzstifte, ein Couvert mit 500 Franken, dazu einen beträchtlichen Haufen Papier: Dienstreglemente, Zeitungsausschnitte, das Schul- und Kurstableau 1976, Quittungen für Geheimakten und viel Material über den Zivilschutz in andern Ländern.
Kompromittierende Dokumente? Kein einziges. Nur zwei Rubelnoten machten die Ermittler für einen Moment stutzig. Bei genauerem Hinsehen stellten sie dann fest, dass es sich um Scheine aus dem Jahr 1947 handelte.
In jener frühen Phase der Einvernahme spielte auch die technische Seite eine Rolle. Kurz bevor Bundesanwalt Gerber sein Amt angetreten hatte, waren Günter und Gisela Wolf verhaftet worden, ein deutsches Ehepaar, das in unserem Land seit 1967 unter dem Decknamen Kälin für die DDR Spionage betrieb.21 Für die Bundesanwaltschaft war die Aufdeckung des Falles ein schöner Erfolg – und dazu ein «Eigengewächs», wie Gerber auf einem Handzettel notierte, womit er offensichtlich andeutete, dass man den Wolfs alias Kälins nicht als Folge von Hinweisen befreundeter Nachrichtendienste, sondern aus eigener Erkenntnis auf die Schliche gekommen war. Ihr Licht stellte die Bundesanwaltschaft insofern nicht unter den Scheffel, als sie jene Affäre für eine Art pädagogische Aufklärungsaktion benutzte, indem sie die Öffentlichkeit eingehend über die raffinierten Machenschaften der Eheleute orientierte. Unauffällig hatten diese in einer gut bürgerlichen Wohnung gelebt, zu deren Mobiliar auch eine antike Truhe gehörte, die – und dieser Umstand wurde als Gipfel der Abgefeimtheit besonders hervorgehoben – nur Tarnung war für ein topmodernes Übermittlungsgerät. Der Fall Kälin eignete sich ausgezeichnet, Einfallsreichtum und Verschlagenheit des ideologischen Gegners zu demonstrieren.
Jene Erkenntnisse legten auch im Fall Jeanmaire den Verdacht nahe, bei seinen verräterischen Handlungen seien technische Hilfsmittel zum Einsatz gekommen, dies umso mehr, als bereits in einem der ersten Hinweise die Rede davon war, der Schweizer Offizier sollte mit der «Exacta»-Kamera vertraut gemacht werden. Und der Verdacht erhärtete sich noch, nachdem Jeanmaire bereits am ersten Einvernahmetag angegeben hatte, von Denissenko einen Fernsehapparat geschenkt bekommen zu haben. Also machten sich die Ermittler auf zur Spurensicherung.
Mit derselben Gründlichkeit wie im Berner Büro verfuhren die Beamten, diesmal ihrer fünf, bei der Durchsuchung von Jeanmaires Lausanner Wohnung. Darüber müsste an sich auch ein Protokoll vorliegen, eigentümlicherweise aber fehlt es in den archivierten Akten. So ist man auf Jeanmaires Memoiren angewiesen:
Man hatte nach einer geheimen Dunkelkammer gesucht, in der ich Fotografien von Dokumenten hätte entwickeln sollen. Ich, der ich ein Leben lang nichts vom Fotografieren verstand, der ich dunkle Machenschaften hasste, ich hätte in Büros eindringen, Dokumente fotografieren und in meiner Wohnung heimlich entwickeln sollen? Lächerlich. Die Bundespolizei durchsuchte aufs gründlichste Lavabo und Abort in meiner Wohnung, Keller, Estrich, Autos, einfach alles.22
Dafür könnte an dieser Stelle die Geschichte des erwähnten Fernsehers eingeflochten werden, ist doch dem Schicksal eines Geräts dieser Gattung kaum je ein Schrifttum solchen Ausmasses gewidmet worden.23 Nur, Schlüsse liessen sich aus seiner Vita keine ziehen. Nichts wies darauf hin, dass jemand versucht hätte, das «cheiben» Möbel in ein Sendegerät umzubauen. Selbst die technische Sektion der Gruppe für Generalstabsdienste musste eingestehen: «Hierbei konnte jedoch nichts Irreguläres festgestellt werden (Spektrumsmessung negativ).»
Bald mussten die Beamten ausserdem erkennen, dass die Sache mit der «Exacta»-Kamera definitiv nichts hergab. Jeanmaire hatte keinen Hang zur Fotografie. Seine Freundin Verena Ogg bestätigte zwar anlässlich ihrer Abhörung, dass er irgendeinen Apparat besitze, fügte jedoch hinzu:
Sicher ist Jeanmaire kein passionierter Fotograf. Ich weiss nur von einer Gelegenheit, als er Eichhörnchen fotografierte. […] Jeanmaire hat zudem kein grosses technisches Verständnis.24
Wie der finanzielle, bot auch der technische Sektor keine Handhabe, den Verhafteten in die Enge zu treiben.25 Nach wie vor hingen die Ermittler allein von dessen Aussagebereitschaft ab.