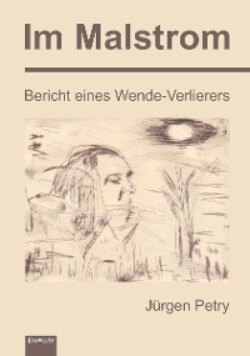Читать книгу Im Malstrom - Jürgen Petry - Страница 13
V
ОглавлениеAlles in allem ging es uns materiell ja eigentlich ganz gut im „real existierenden Sozialismus“. Zumindest solange wir die Landesgrenzen nicht überschritten. Taten wir das, zum Glück ging es ja nur nach Osten, begann unsere Diskriminierung. Wir konnten eben in keiner Beziehung mithalten, nicht einmal mit dem letzten Arbeitslosen von „denen da drüben“. Unvergesslich wird mir ein Erlebnis in einer Kleinstadt der hintersten polnischen Provinz bleiben. Das Ereignis fand an der Bar des einzigen Hotels in jenem Ort statt. Wir waren zur Montage dorthin geschickt worden und sollten Hochleistungsmaschinen aus unserer Firma in einem neu gebauten Werk anschließen und einfahren, wie das genannt wurde. Eines Abends langweilten wir uns, mein Kollege und ich. Wir saßen in der halbdunklen, einzigen Bar der ganzen Gegend. Das Etablissement war spärlich und nur von Männern besucht. Wir waren, glaube ich, beim sechsten oder siebenten widerlich warmen polnischen Wodka angelangt, der bekanntlich in jedem Land der Welt alle Frauen immer schöner werden lässt. Zu später Stunde, als wir schon alle Hoffnung auf ein interessantes harmloses Gespräch aufgegeben hatten, flogen doch noch ein paar Mädels ein, deren Passion in Polen mit „Möwen“ umschrieben wurde. Schnell teilten sie sich an den Tischen der wenigen Männer auf. Eine etwas korpulente exotische Schönheit schob einen Barhocker zwischen mich und meinen Kollegen und fragte mit einem bezaubernden Augenaufschlag, zuerst englisch, dann in gebrochenem Deutsch, ob wir ihr nicht ein Gläschen Krim-Sekt spendieren würden. Das taten wir natürlich gern. Nicht, dass ich auch nur im Entferntesten daran gedacht hätte, meine geliebte Jana hier im finsteren Polen mit einer einheimischen Möwe zu betrügen. Das hätte ich nie getan. Aber unterhalten wollten wir uns schon mit ihr. Doch gerade als wir sie zu einem zweiten Glas einladen wollten, entschloss sie sich, den Vorgang abzukürzen und fragte sehr direkt: „Kommt ihr aus dem großen, dem kleinen Deutschland oder Österreich?“ Als ich wahrheitsgemäß antwortete: „Aus dem kleinen“, denn ich nahm an, sie würde ehrlich erfreut sein, auf zwei Angehörige eines sozialistischen Brudervolkes getroffen zu sein, rutschte sie mit einem leisen Gemurmel, das mich an einen, auch bei uns gebräuchlichen, Fluch erinnerte, ohne ein weiteres Wort vom Barhocker. Nie werde ich den Blick tiefster Verachtung vergessen, den sie uns noch zuwarf. Völlig zu Recht, denn wir hatten sie unbewusst geschädigt, weil wir sie von der Arbeit abgehalten hatten, wie ich heute weiß. Eine Minute später hörten wir sie an einem nahen Tisch, mit drei betagten äußerst fiesen Typen, die gleiche Frage stellen. Die mussten die Typen wohl zufriedenstellend beantwortet haben, denn sie setzte sich zu ihnen an den Tisch. Der Barkeeper öffnete auf ein Fingerschnipsen des Fiesesten der drei Fieslinge den Kühlschrank, holte einen eiskalten französischen Champagner hervor, zumindest hatte die Flasche ein solches Etikett, und servierte ihn in devoter Haltung direkt am Tisch. Mehr wollten wir nicht sehen und hören auch nicht, deshalb verließen wir sofort die Bar. Unsere Ostmark nahm der Schnapsschüttler zwar, anstelle der beinahe schon wertlosen einheimischen Währung, steckte sie aber inklusive Trinkgeld mit einer beleidigenden Gleichgültigkeit und ohne zu danken ein.
Wem das geschah, der kann vielleicht unsere immer wieder aufflammende „Freiheitssehnsucht“, die uns schließlich um den Leipziger Ring trieb, besser begreifen. Sicher hat auch unser heutiger Herr Bundespräsident im Osten, bei den „Brudervölkern der DDR“, etwas Ähnliches erlebt. Seine schwer zu erforschenden Wege müssen ihn auch zu unseren Nachbarn und dort in eine Bar mit Möwen geführt haben. Irgendeine Erklärung muss es doch dafür geben, dass er bei jeder sich bietenden Gelegenheit gebetsmühlenartig die „Freiheit“ beschwört. Was damit gemeint ist, wissen wir ja jetzt. Kränkungen haben eben manchmal eine Langzeitwirkung und direkt spricht ja niemand gern darüber. Wir aber wissen, dass nach einem solchen Vorkommnis selbst dem an mehreren Parteischulen studierten treuesten Genossen Zweifel an der historischen Mission des „real existierenden Sozialismus“ kommen mussten. Uns jedenfalls fiel nach dem Barbesuch sofort wieder ein, wie sehr wir geknechtet waren im Osten und das Bedürfnis nach der Freiheit, die D-Mark hieß, stieg.
Ich hatte Elektriker gelernt, anschließend in Zwickau auf Ingenieur studiert und leitete in unserem Unternehmen eine Brigade Betriebshandwerker, genauer gesagt die Elektrikerbrigade „Stromschnelle“. Meine Frau Jana, ich erwähnte es bereits, war Slawistin an der hiesigen Universität und unser Sohn Dreher in einem metallbearbeitenden Betrieb der Stadt Leipzig. Eigentlich liefen unsere familiären Beziehungen bis dahin recht harmonisch. Irgendwann setzten dann aber auch bei uns, zunächst unmerklich, die Vorwendeturbulenzen ein. Jeder gegen jeden. Als ich es bemerkte, war es fast zu spät.
Bei seiner nunmehr festen Freundin Ilona hatte unser Sohn Waldemar Henry nicht nur wegen seines neuen „Sexy-Namens“ das Rennen gemacht, sondern vor allem, weil er ihr gleich am Anfang ihrer sich entwickelnden Beziehung versichert hatte, dass er im laufenden Jahr, also noch 1989, fest auf der Verteilerliste der AWG für eine Neubauwohnung stände. Das war eine „Super-Aussteuer“ für jeden künftigen Lebenspartner, vielleicht nicht nur in der DDR, dort aber auch. Als Ilona sich durch Nachfrage bei der AWG von der Wahrheit dieser frohen Botschaft überzeugt hatte, war ihre Entscheidung gefallen. Mehr bedurfte es nicht. Sie gab ihrem bisherigen Freund, der auf den Namen Günter Krause hörte, den Laufpass und zog zunächst zu uns. Das heißt in das bis dahin von Waldemar Henry allein bewohnte Kinderzimmer. Mich zu fragen, hatten sie aus Versehen vergessen. Zunächst schwieg ich, wenn auch verbissen. Doch als ich in der Folge davon innerhalb einer Woche zweimal meinen Bus verpasste, weil die Beiden schamlos gemeinsam unser Bad zu meiner gewohnten Aufstehzeit blockierten und ich mit dem Fahrrad zur Arbeit hetzen musste, lief das Fass über.
Das Verhalten Waldemar Henrys und seiner Ische überschritt meine ohnehin durch die Anspannungen niedrig gewordene Toleranzgrenze. Ich kündigte zunächst meiner geliebten Frau Jana an, dass ich die Beiden ratz patz auf die Straße zu setzen gedächte. Sie stimmte mir zu meiner Überraschung nicht zu, sondern fing an zu schmeicheln. „Sei doch nicht so borstig“, begann sie und strich mir demonstrativ mein unrasiertes Kinn. „Die sind nun mal jung und verliebt. Es ist ja auch nicht für lange. Dann haben sie ihre eigene Wohnung.“ Ich blieb hart. Da wurde meine Jana schnippisch. „Du bist nur neidisch“, fing sie an. Dann sich steigernd und meiner Meinung nach völlig aus dem Zusammenhang gerissen: „Denke ruhig einmal nach, bevor du dich aufspielst, wie lange es her ist, dass wir beide uns gemeinsam im Bad vergnügt haben.“ Als ich auf die Anspielung nicht reagierte, wurde sie richtig spitz: „Das sagt dir natürlich nichts mehr?“ Es sagte mir schon etwas. Ich wurde sogar verlegen, wollte aber das Thema nicht wechseln. Wütend gemacht hatte mich ja nicht allein die verschlossene Türe zum Bad, sondern alles zusammen. Deshalb schniefte ich nur, jede Vorsicht vergessend: „In meiner Wohnung gelten immer noch meine Regeln. Auch wenn ich schon nicht gefragt werde, bevor mein Sohn hier so etwas wie ein Stundenhotel einrichtet.“ Das war vielleicht etwas stark und traf, zugegeben, auch nicht genau den Kern. Sofort lief meine geliebte Jana rot wie die Arbeiterfahne an und holte zum Tiefschlag aus: „Unsere Wohnung meinst du wohl und unser Sohn ist es auch. Zumindest wahrscheinlich!“ Das saß bei mir und sie wusste, dass es gesessen hatte. Jana drehte sich um und knallte mir vor der Nase die Türe zu. Es war der erste wirklich böse Streit zwischen uns. Niemand war mehr darüber verblüfft als ich.
Entsetzt über den ungewohnten Ton und die Andeutung in der letzten Satzhälfte starrte ich ihr hinterher, bis ich ihr schließlich ins Wohnzimmer folgte. Rette, was noch zu retten ist, muss ich wohl gedacht haben. Auf jeden Fall machte ich alles falsch. Mein Eintritt ins Wohnzimmer besänftigte Jana nicht, sondern stachelte sie richtig auf. Messerscharf klang jetzt ihre Stimme: „Wann hätte dich der Kleine“, gemeint war unser 1,86 Meter große Lulatsch Waldemar Henry, „eigentlich dazu befragen sollen? Du hast wohl vergessen, dass du deine Zeit seit Wochen nur noch auf zweifelhaften Demos oder mit sinnlosen Palavern in deiner Firma, aber nicht hier, in der eigenen Familie, verbracht hast?“ Ich war so erschrocken, dass mir nicht sofort eine passende Entgegnung einfiel. Das legte Jana wahrscheinlich als Sieg aus, denn sie schmetterte mir wie eine Fanfare entgegen: „Wenn hier einer geht, dann bist du es!“ Nach diesem kategorischen Imperativ knallten wieder die Türen. Erst die vom Wohn-, dann die vom Schlafzimmer. Dabei blieb es nicht. Jana verbannte mich für die folgende Nacht auf unsere Wohnzimmercouch. Ich begann zu ahnen, dass etwas schief zu laufen begann in unserer Familie.