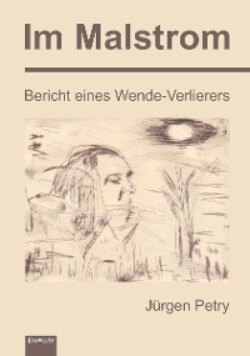Читать книгу Im Malstrom - Jürgen Petry - Страница 17
IX
ОглавлениеDer Frieden in unserer Familie war nach dem großen Badbenutzungskrach wieder so einigermaßen hergestellt. Vor allem weil ich vor der geballten Koalition von Ehefrau Jana, Sohn Waldemar Henry und seiner Ische Ilona dann doch zurückgewichen war. Wir hatten uns verständigt, dass die Beiden ihre morgendlichen Spielchen nicht mehr im Bad vollführten oder zumindest nicht in der Zeit, die mir von Anbeginn unserer ehelichen Gemeinschaft in dieser Wohnung für meine Morgentoilette zugestanden worden war. Dadurch bekam ich morgens auch wieder meinen Bus.
Im Gegenzug sollte ich keinen weiteren Versuch unternehmen, das mir lästige Pärchen vor die Türe zu setzen. Inzwischen wurde das gesellschaftliche Chaos in allen Lebensbereichen der unmittelbaren Vorwendezeit in der DDR flächendeckend. Davon musste auch die AWG in Mitleidenschaft gezogen worden sein, denn sie machte keine Anstalten, die unserem Waldemar Henry für 1989 fest zugesagte Wohnung bereitzustellen. Unser Pärchen störte das zunächst nicht, denn sie lebten bei uns wie in einem Hotel, in dem nichts etwas kostet. Jana hatte sich für ihren damaligen Ausbruch zwar nicht entschuldigt, mir aber durch ihr Verhalten hier und da zu verstehen gegeben, dass sie mir meinen angeblichen Ausraster nicht weiter nachtrug.
Trotzdem war mein Leben anders geworden. Nicht nur weil irgendetwas Fremdes zwischen uns getreten war. In unserem Betrieb fanden beinahe täglich irgendwelche Versammlungen statt, in denen hitzig darüber debattiert wurde, wie alles besser, vor allem aber anders werden könne. Daran nahm ich häufig teil, fast immer als Zuhörer. Ich wollte wissen, wohin das alles läuft. Und ehrlich gesagt wich ich damit möglichen weiteren Konflikten in der Familie auch noch aus.
Anfangs führten das Wort in den Betriebsversammlungen noch überwiegend bekannte Mitarbeiter, Frauen wie Männer meist unterhalb der Führungsetagen, denen es um wirkliche Verbesserungen im Kombinat ging und die Fragen und Lösungsvorschläge wurden überwiegend ruhig und meistens auch sachlich vorgetragen. Nur diskutiert wurde darüber immer hitziger. Nach und nach drängten aber immer undurchsichtigere Typen vor. Ihre Forderungen wurden radikaler und der Ton anmaßend. Misstrauensanträge gegen Leiter waren an der Tagesordnung. Mal mit Erfolg, meistens zwar ohne, aber davon irritiert schmissen Führungskräfte hin, setzten sich in den Westen ab oder wurden direkt abgeworben. Das gab es auch. Manchmal war ich vom Verlauf einer Versammlung richtig angetan, manchmal schnürte mir die Angst vor der Zukunft die Luft ab. Vor allem, wenn ich sah, wie ungeniert Vertreter von westlichen Konkurrenten begannen, sich in unserer Firma zu bewegen. Gehindert wurden sie von niemandem daran. Das, was heute mit Industriebrachen bezeichnet wird, bereitete sich schleichend vor. Ich hatte bereits die Übersicht über Ziel und Richtung unserer Bewegung verloren, nahm aber trotzdem weiter an den Debatten teil. Wahrscheinlich auch, wie gesagt, weil ich Auseinandersetzungen in meiner Familie ausweichen wollte. Genau weiß ich es aber nicht mehr. Es war am Sonntag, dem dritten Advent. Wir saßen beim Frühstück. Ich bemühte mich, dem Pärchen ein freundliches Gesicht zu zeigen und beteiligte mich zunächst locker an den belanglosen Gesprächen. Plötzlich sagte meine Jana: „Du, die Kinder möchten nach dem Westen. Sie wollen sich ihr Begrüßungsgeld abholen.“ Seit durch den Auftritt des zwielichtigen Schabowskis eher zufällig als geplant die Grenze geöffnet worden war, strömten täglich Tausende in den Westen. Schamlos flogen sie mit Kind und Kegel bei Verwandten oder Bekannten ein, um sie mit ihrer Anwesenheit zu erfreuen. Vor allem aber wollten sie sich ihr Begrüßungsgeld abholen, das ihnen, wie sie meinten, zustand. Jana und ich hatten einmal darüber gesprochen und waren uns einig: Wir nicht! Wir lassen uns nicht bestechen! Nicht von denen da im Westen. Und schon gar nicht wollten wir unseren Brüdern und Schwestern das Schauspiel bieten, uns wie arme Verwandte stundenlang in Warteschlangen nach jämmerlichen 100 D-Mark Begrüßungsgeld anzustellen. Wer wollte, sollte das tun, wir aber nicht. Der Westen lief uns nicht davon und mit je 100 D-Mark wäre ohnehin hier kein Problem gelöst. Wie gesagt, darüber waren wir uns einig. Deshalb sah ich sie erstaunt an und merkte sofort, wie verlegen sie wurde. Ich sah auch, dass sie am Halsausschnitt rote Flecken bekam. Das geschah immer, wenn ihr etwas peinlich war oder sie sich aufregte.
Deshalb sagte ich ruhig: „Wenn die jungen Herrschaften sich das Begrüßungsgeld holen wollen, dann bitte sehr, warum nicht?“ Das sagte ich so gelassen wie ich konnte. „Habt ihr schon einmal …“, wollte ich fortfahren, doch da fiel mir unsere angehende Schwiegertochter ins Wort. „Und ihr, wollt ihr es verfallen lassen und denen schenken? Das sind 100 D-Mark für jeden, keine Alu-Chips, richtiges Westgeld. Außerdem haben die hier genug rausgeschleppt mit ihrem Schwindelkurs. Das ist das Mindeste, was uns zusteht.“
Eigentlich wollte ich ja etwas Grundsätzliches sagen, überlegte nur noch, wie und was, da fiel mir wieder einmal Waldemar Henry in den Rücken. „Hör zu, mein Alter. Jetzt überwinde mal den eingebildeten Stolz deiner Arbeiterklasse. Außer dir hat den nämlich niemand. Die fahren alle hin und holen ihre Kohle, ich kenne jedenfalls niemand, der noch nichts geholt hat oder holen will. Manche haben es sogar zweimal gemacht. Einmal im Norden und einmal in Bayern und auch das hat geklappt. Natürlich nur, wenn sie einmal bis Bayern gefahren sind. Glaubst du vielleicht, dass die da drüben eine Strichliste vorliegen haben und plötzlich bemerken, aha, der Paschke Heini aus Wolfen Nord, der hat sein Begrüßungsgeld nicht geholt. Was für ein stolzer Mensch, dieser Heinrich!?“ Er nickte mir spöttisch zu und sagte dann noch richtig höhnisch: „Nichts änderst du, gar nichts, wenn du es dir nicht holst und alle anderen tun es!“
Am liebsten hätte ich ihm in meiner aufsteigenden Wut ein paar gescheuert! Direkt in seine grinsende Larve. Doch eingedenk des Kräfteverhältnisses in meiner Familie und der versprochenen Friedenspflicht hielt ich mich gerade noch zurück. Darüber vergaß ich allerdings, dass ich eigentlich sagen wollte, dass das etwas mit menschlicher Würde zu tun hat, von der die beiden wohl noch nie etwas gehört hätten. Stattdessen sagte ich nur: „Fahrt doch!“ Mein anschließendes mehrfaches tiefes Durchatmen zeigte meiner geliebten Jana wohl an, dass es Zeit zum Eingreifen war, wenn sie verhindern wollte, dass gleich ein riesiger Krach losgetreten würde. Zunächst gab sie sich neutral und sagte zu unserem Sohn: „Kein Grund zum Höhnen, lieber Henry. Dein Vater und ich haben beschlossen, das Geld nicht anzunehmen. Dein Vater meint, dass wir uns vor denen da drüben nicht so demütigen lassen dürften. Das solltet ihr respektieren. Wir, er“, sie nickte mit dem Kopf in meine Richtung, „und ich, sind uns da einig. Fahrt doch einfach allein.“
Waldemar Henry verstand offenbar den Wink und lenkte ein. „Entschuldige bitte, Papa, ich wollte dich nicht kränken. Ilona und ich haben nur gedacht, wenn wir es nicht holen, freuen die da drüben sich nur. Und wir haben nichts davon. Ilona hat es doch schon gesagt. Die da haben jahrelang auf unsere Kosten gelebt, wenn sie hier ihr Geld eins zu fünf umgetauscht haben. Dabei war hier auch so schon alles viel billiger. Erinnere dich nur, Papa, wie du dich erregt hast, als wir einmal in Prag waren. Ich weiß es wie heute. Da saß eine Herde Halbwüchsiger aus dem Westen auf der Terrasse des Hotels Jalta. Wir hätten uns dort mit unserem Tages-Umtausch-Satz nie sehen lassen dürfen. Und die hingen bereits zehn Uhr lallend herum! Rings um sich leere Sektflaschen und von außen die empörten Blicke der Tschechen. Denkst du, dass sich auch nur einer von denen dafür geschämt hat? Nee, geschämt haben wir uns. Die haben sich gedacht, sie schädigen die Kommunisten, wenn sie überhaupt gedacht haben.“ Ich lachte ironisch, denn beide glaubten, mich mit dem Argument „Die haben doch …“ umstimmen zu können.
Jana wusste es. Dennoch war sie es, die das Anliegen auf den Punkt brachte. „Hör mal, Heinrich, die Kinder meinen es doch nur gut mit uns. Wir haben ein Auto, sie nicht. Komm, gib dir einen Ruck, lass uns zusammen mit dem Wartburg einen schönen Tag machen. Die beiden jungen Leute holen sich ihr Begrüßungsgeld und wir sehen uns inzwischen irgendeine Stadt an. Hamburg vielleicht oder, falls du lieber nach Bayern möchtest, dann eben Nürnberg oder München.“ Darum also ging es. Sie wollten auch noch das Fahrgeld sparen. Ich sollte sie kutschieren. Nach Hamburg oder nach München! Das waren ungefähr 1000 Kilometer hin und zurück. Dazu brauchte ich drei Kanistern Benzin im Kofferraum. Bezahlen wollten sie mir den Westsprit sicher nicht von ihrem Umtauschgeld. Drei Kanister, das wäre dann eine fahrende Bombe, die beim kleinsten Unfall explodieren konnte. Ich war so wütend über die Zumutung, dass ich für einen Moment dachte, gib ihnen für dieses Selbstmordkommando doch dein Auto. Vielleicht klappt es! Wütend wollte ich beiden etwas entgegenschleudern, doch dann siegten die Scham und die Vernunft. Das sind deine Kinder, du dämlicher Heini, zumindest dieser Waldemar, sagte ich mir und meine Wut war verflogen. Ich wusste plötzlich, dass ich kapitulieren würde, auch ohne weitere Diskussionen. Ich hörte kaum noch zu, als Ische Ilona mit zuckersüßer Stimme nachlegte: „Wir verstehen dich ja, lieber Heinrich!“ Sie lächelte in meine Richtung. Ich sah nur noch irritiert in die Runde, denn ich hatte ihr weder das Du angeboten noch ihr gestattet, mich mit dem Vornamen anzureden. Bisher hatte sie es auch noch nie getan.
„Machen wir es doch einfach so, wie es Jana vorgeschlagen hat. Ihr seht euch die Stadt an und wir holen uns unser Begrüßungsgeld. Es muss ja nicht gleich München sein. Hof genügt und da musst du keine Kanister mitnehmen. Und wenn ihr euch geniert, dann gebt ihr uns einfach eure Ausweise und wir versuchen es euch mitzubringen. Vielleicht geht auch das. Ist das ein Vorschlag?“ – „Nein!“ Ich wunderte mich, wie ruhig ich meinen letzten Widerstand aufbaute. „Begreift ihr denn nicht, dass sie uns kaufen? Wie können wir je mit ihnen auf Augenhöhe bleiben, wenn wir zuvor nach zugeworfenen Brocken geschnappt haben wie hungrige Hunde? Die werfen uns Sand in die Augen und keiner will es merken!“
Mit meinem Argument erreichte ich niemand, nicht einmal Jana. „Hör mal, Heini“, sagte sie auf einmal, meinen verstümmelten Vornamen wie bei einem ungehorsamen Kind explizit betonend. „Du weißt, dass ich immer auf deiner Seite bin und du weißt, dass ich genauso darüber denke wie du. Aber sei mal ehrlich, glaubst du wirklich, dass du auch nur das Geringste erreichst, wenn alle ihr Begrüßungsgeld holen und du nicht?“ Das hatte ich doch gerade erst gehört. Nicht von ihr, von Waldemar Henry! Gerade hatte Jana noch von uns gesprochen, dächte ich. Jetzt stellte ich wieder nur fest, dass ich auch in dieser Frage allein bleiben würde und antwortete deshalb, jedes Wort einzeln betonend, innerlich aber schon resigniert: „Nein, Jana, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das nur etwas mit Würde zu tun hat.“ Zwei Tage später fuhren wir alle vier in meinem Wartburg nach Hof in Bayern.
Damals hätte ich mir nicht einmal im Traum vorstellen können, dass zu dem Zeitpunkt, als wir in unserer Wohnküche in Wolfen Nord noch darüber debattierten, ob es ehrenrührig sei, Begrüßungsgeld anzunehmen, George W. Bush und Helmut Kohl sich bereits über den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland verständigt hatten. Nur wenig später, am 25./26. Januar 1990 würde Michael Gorbatschow, der noch drei Monate zuvor in Berlin frenetisch gefeierte Gorbi, dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik grundsätzlich zustimmen. Gegen eine beachtliche Milliarden-Morgengabe versteht sich. Damit hatte er offenbar kein Problem. Seinem langjährigen Sattelitenchef, dem Saarländer Honecker, würde die „Noch-Sowjetunion“ wenig später sogar den minimalsten Schutz, das Asyl, verweigern und ihn ausliefern.
„Was für ein Tag der Schmach!“ (2. Könige 19,3). Zu Gorbatschows Ehre kann lediglich gesagt werden, dass nicht er es war, der ihn letztlich auslieferte.