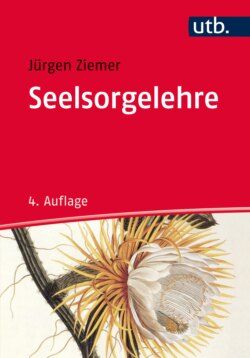Читать книгу Seelsorgelehre - Jürgen Ziemer - Страница 25
2.2.4Seelsorge als Hirtendienst (Schweizer Reformation)
ОглавлениеHirtendienst als Metapher für die Seelsorgearbeit setzt unterschiedliche Sinngehalte frei. Es kann damit mehr „Fürsorge“ oder mehr „Aufsicht“ assoziiert werden, mitunter auch beides zugleich. Diese Kennzeichnung für die Seelsorge bei den Vätern des reformierten Zweiges der Reformation legt sich schon aus äußeren Gründen nahe. Zwinglis pastoraltheologische Hauptschrift von 1524 trägt den Titel „Der Hirt“ und Martin Bucer versteht seine ausführliche Darstellung „Von der waren Seelsorge“ (1538) als Auslegung des Hirtenwortes Ez 34, 16: „Ich will das Verlorene suchen und das Verirrte zurückbringen …“ Für das Verständnis der Seelsorge Zwinglis und Bucers ist es hilfreich, auf drei signifikante Unterschiede zur Seelsorgeauffassung Luthers hinzuweisen:
•Luthers Seelsorge ist sehr stark von eigenen existenziellen Erfahrungen her geprägt, und mit ihr reagiert er vor allem auf die Not des geängsteten Gewissens. Zwingli und Bucer reagieren mit ihren Entwürfen zur Seelsorge auf je unterschiedliche Weise auf das Nachlassen der Kirchenbindung und Glaubenstreue bei den Gemeindegliedern.
•Luthers Seelsorge schlägt sich vor allem in konkreten und relativ spontanen Reaktionen auf bestimmte Konfliktsituationen einzelner Betroffener nieder. Zwingli und Bucer haben sich auch und vor allem systematisch in den genannten Schriften dazu geäußert.86
•Luthers Seelsorge ist auf dem Hintergrund seiner soteriologischen Grundanschauungen zu verstehen (also im Zusammenhang der Frage nach dem „gnädigen Gott“), während für die Seelsorgeauffassung von Zwingli und Bucer der ekklesiologische Denkzusammenhang bestimmend ist.
Huldrych Zwinglis Schrift „Der Hirt“87 mag als „erste protestantische Darstellung der pfarramtlichen Seelsorge“88 angesehen werden. Seelsorge kommt im Zusammenhang der gesamten pastoralen Tätigkeit und besonders auch der Verkündigungsaufgabe in den Blick. Der Schwerpunkt der Seelsorge liegt auf dem „Bewahren und In-Ordnung-Halten“89. Das ist der rechte Hirtendienst, darüber zu wachen und dafür zu sorgen, dass „die gearzten Schäflein nicht wiederum in Krankheit verfallen“90. Um diese Aufgabe zu erfüllen sind verschiedene erzieherische Mittel notwendig, die in seelsorglicher, also differenzierender Weise anzuwenden sind: „Gerade wie der Hirte etliche Schafe schlägt, etliche mit der Hand, etliche mit dem Fuß vorwärts stößt, etliche mit Pfiffen treibt …, damit ihm die Schäflein gemehrt, sauber und gesund werden.“91 Hirtendienst ist für Zwingli Wächterdienst, und er hat sein Vorbild und Urbild in Jesus Christus selbst. Damit ist den Pfarrern eine hohe Aufgabe gestellt. Sie setzt voraus, dass die Hirten sich ihrer Verantwortung für die evangeliumsgemäße Verkündigung bewusst sind und ihres Amtes in Liebe und ohne Falsch walten.
Hinter Martin Bucers Schrift von 153892 steht einerseits die Sorge angesichts des Nachlassens der ersten Liebe, also der Lockerung der Kirchenbindung bei vielen Gemeindegliedern, und andererseits die Trauer und der Zorn über die „jämmerliche und verderbliche Spaltung der Religion“, wie es im vollständigen Titel heißt.
Bucer – darin mit allen anderen Reformatoren eines Sinnes – geht von der Glaubensgewissheit aus, dass Christus die Kirche regiert und letztlich selbst ihre Zukunft bestimmt. Dazu braucht Christus bestimmte Mittel und geeignete Diener, „durch die will er mich zu seinem Reich sammeln, mir die Sünde verzeihen, mich neu gebären, erhalten, lehren und einführen ins ewige Leben“93. Das ist das Hirtenamt mit all seinen unterschiedlichen Funktionen. Seelsorge vollzieht sich für Bucer vielfältig – als Predigt, im Gespräch, beim Hausbesuch oder auch im Zusammenhang kirchenzuchtlicher Maßnahmen. Das Hirtenamt setzt Hirten voraus mit „Ansehen, Furcht und Vorbild des Lebens“, ausgestattet mit „vornehmen Gaben und Geschicklichkeiten neben dem aller ernsten Eifer zur rechten Leitung des Hirtenamtes“. Und das Ziel des Hirtendienstes ist vor allem „der Erwählten Besserung“94.Von „Besserung“ spricht Bucer im Zusammenhang der Seelsorge oft und gern. Konkret bedeutet das: Es geht in der Seelsorge darum, die Gemeindeglieder in der Gemeinde zu erhalten oder sie dahin zurückzuführen. Die Kirchenbeziehung ist der eigentliche und primäre Focus der bucerschen Seelsorge. Dabei empfiehlt er den Seelsorgern, ihren Dienst adressatenspezifisch auszuführen – je nachdem, wie nah oder fern der Kirche die einzelnen Gemeindeglieder stehen. Bucer unterscheidet in Anlehnung an Ez 34,16 fünf verschiedene Typen von Kirchenzugehörigkeit 95: die verlorenen Schafe, die der Kirche Entfremdeten (obwohl noch zu ihr Gehörenden), die Sünder in der Gemeinde, die Glaubensschwachen und die wahren Christen.
Je nachdem hat der Hirtendienst nun eher missionarisch-suchende, zur Buße fordernde oder den Glauben stärkende Aufgaben. Auch die Kirchenzucht kann dabei zu einem notwendigen Mittel der Seelsorge werden. Vor allem für die „starken Sünder“ in der Gemeinde wird sie Seelsorgern empfohlen: „Daneben aber werden sie auch die Kirchenzucht und Seelenarznei, welche die Diener des geistlichen Bindens und Lösens verrichten sollen, mit höchstem Fleiß fordern.“96
Auch die „gesunden, starken Schafe“ sind dem Hirtendienst anbefohlen. Hier gilt es zu festigen und zur Teilnahme an den „heiligen Kirchenübungen“ anzureizen. Vom „Geist Christi“ heißt es in Bezug auf diese Gruppe – und es scheint so, als wäre dies auch indirekt ein Modell für die visitatio domestica: „dass er seine Schüler in alle Wahrheit führet. Darum luget er auch von Haus zu Haus, von Mensch zu Mensch, wie seine Lektionen der öffentlichen gemeinen Predigten aufgenommen werden, wie sie bei jedem verfange, behöret sein Schüler, siehet, was sie begriffen haben oder nicht. Also hat ers in seiner Kirche allwegs gehalten; und wem das nicht gefällt und (wer) das nicht in Übung zu bringen begehrt, der will nicht, dass der h. Geist seine Kirche recht lehrt …“97.
Insgesamt gesehen haben wir es bei Bucer mit einer eindrucksvollen Seelsorgetheorie zu tun, einem geschlossenen poimenischen Gesamtentwurf. Ein gewisser erzieherischer Impetus ist dieser Seelsorgelehre unverkennbar eigen. Die einseitige Betonung des ekklesiologischen Aspektes führt dazu, dass andere Konfliktfelder und Krisenerfahrungen des individuellen Lebens praktisch aus dem Blick geraten. Für den modernen Leser Bucers ist überraschend, wie die präzisen Beschreibungen der verschiedene Entfremdungserfahrungen in Kirche und Gesellschaft immer wieder Assoziationen zu unseren Gegenwartserfahrungen freisetzen.
Auch in einer nur exemplarischen Skizze der Seelsorgegeschichte darf der Name von Johannes Calvin natürlich nicht fehlen. Der enge Zusammenhang von Seelsorge und Ekklesiologie ist aber auch für ihn evident. Und die kirchenzuchtlichen Seiten des Hirtendienstes sind bei ihm besonders deutlich ausgeprägt, freilich keineswegs in dem Maße, wie manches Vorurteil es gerne wahrhaben möchte. In gewisser Weise mag Calvin als der engagierteste Seelsorger der Schweizer Reformation angesehen werden. Calvins Seelsorge muss einerseits in ganz enger Verknüpfung mit seiner stark seelsorglich ausgerichteten Predigttätigkeit gesehen werden. Denn seine Predigten kreisen „um die Ehre Gottes und um die Ruhe des Gewissens“98. Andererseits gibt es einen festen Zusammenhang der Seelsorge mit der praktischen Arbeit des Reformators beim Gemeindeaufbau in Straßburg und Genf.99
Für die ganz praktische Seite von Calvins Seelsorgetätigkeit sind dann natürlich auch seine Briefe heranzuziehen. Es hat sie geschrieben an hoch gestellte und politisch einflussreiche Personen ebenso wie an einfache Gemeindeglieder in Notlagen, an Verfolgte, an ganze Gemeinden und an einzelne Pfarrer.100
Seelsorgliche Tiefe und kirchenzuchtliche Strenge – das sind charakteristische Merkmale der Seelsorge Calvins.