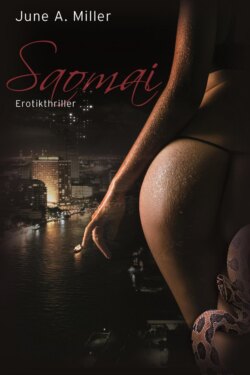Читать книгу SAOMAI - June A. Miller - Страница 2
ОглавлениеDas Knarren der schweren Eingangstür ließ Annan Thanom aufatmen. Wie immer, wenn seine Tochter von ihrem Spätdienst im Krankenhaus heimkam, hatte er besorgt ihre Rückkehr erwartet. Ein leises Schleifen über Steinfliesen ließ ihn noch einmal in Richtung Flur horchen. Wieso ging sie denn in den Keller? Ihr erster Weg führte normalerweise in die Wohnstube, wo sie Annan meist lesend auf der Couch vorfand. Jetzt ächzte die Tür zum Vorratsraum. Die Geräusche im Haus verwunderten ihn. Zumal eines fehlte: das Klackern ihrer Absätze. Seine Tochter liebte hohe Schuhe und zog sie nicht einmal im Haus aus. Heute jedoch schlich sie umher, als sollte er sie nicht hören.
Über die Schulter rief er ihren Namen. Keine Antwort. Wahrscheinlich hatte sie diese Knöpfe im Ohr, aus denen pausenlos Musik tönte. Annan seufzte und nahm den ziegeldicken Medizinschmöker zur Hand, den er eben beiseite gelegt hatte. Er hob das Buch auf seinen Schoß und schlug es im hinteren Drittel auf. Ungeduldig blätterte er zurück. Ein Zettel ragte lose zwischen den Buchseiten hervor. Mit spitzen Fingern zog er daran und betrachtete ihn voller Unbehagen. Drei Worte waren mit flüchtiger Hand auf das Papier geworfen. Für Annan Thanom bedeuteten sie sein Leben.
Zum wohl zwanzigsten Mal an diesem Abend verglich er die kantigen Buchstaben mit der Unterschrift eines Schriftstücks, das neben ihm auf dem Sofa lag. Ein dunkler Schatten glitt über sein gutmütiges Gesicht.
Erst der sonore Gong einer antiken Pendeluhr riss ihn aus seinen Grübeleien. Halb zwölf schon! Annan ließ das Buch zuklappen. Wo sie nur blieb? Sie hatte ihm noch immer nicht ‚Guten Abend‘ gesagt.
Ein Scheppern im Flur ließ ihn zusammenfahren. War sie etwa gegen die große Bodenvase gestoßen? Die stand ja nun schon ewig da!
Er stutzte, als er mit einem Mal begriff: Da draußen im Flur, das war nicht seine Tochter! Sein Kopf ruckte hoch, seine Sinnesorgane spannten ihre Membranen und jedes einzelne Härchen seines Körpers meldete wie ein Seismograph Gefahr.
Annan lauschte. Doch über dem Rauschen in seinen Ohren vernahm er kein weiteres Geräusch. Hastig legte er Brief und Zettel in das Buch zurück und bedeckte es unter einem Sofakissen. Er blickte sich im Zimmer um, als betrachte er es zum letzten Mal. Dann stemmte er sich aus dem tiefen Ledersofa hoch, bereit sich dem zu stellen, was ihn erwartete. Ein Luftzug streifte Annans Rücken.
Im selben Augenblick schoss ihm ein Brennen in die Seite, als würde ihm kochendes Wasser injiziert. Er jaulte auf und presste eine Hand auf die schmerzende Stelle in seinem Rücken. Sie fühlte sich warm und feucht an und seltsam klebrig. Seine Chirurgenhände ertasteten ein Loch, wo unversehrtes Fleisch hätte sein sollen. Wie durch Watte vernahm er ein Pfeifen, das er zunächst nicht deuten konnte. Doch zusammen mit der Wunde in seinem Rücken machte es Sinn.
Er war angeschossen worden!
Zitternd griff Annan nach der Sofalehne, stützte sich keuchend darauf, während sein Verstand fieberhaft nach einem Ausweg suchte. Zu seinen Füßen breitete sich eine glänzende Lache aus und ihm dämmerte mit eisigem Entsetzen, dass es Blut war. Sein Blut.
Die Götter stehen mir bei, betete er.
Ein zweiter Schlag katapultierte ihn nach vorn und ließ ihn wie einen gefällten Baum in den hölzernen Couchtisch krachen. Das Brennen weitete sich auf seine Brust aus, das seltsame Pfeifen gellte zum zweiten Mal in seinen Ohren. Bevor ihn tiefschwarze Finsternis umfing, galt Annan Thanoms letzter Gedanke seiner Tochter. Saomai.
****
Ein Dutzend Männerköpfe flog hoch, als sie aus dem kuppelförmigen Eingangsportal der „Sky Bar“ ins Freie trat. Die darunter liegende Terrasse war zum Bersten voll mit gestylten Menschen. Saomai verharrte kurz, um in der Menge nach dem einen bekannten Gesicht zu suchen. Die Herren musterten sie wie Freiwild und sie bereute, das knappe Etuikleid gewählt zu haben. Von da unten konnten sie ihr vermutlich bis aufs Höschen sehen. In der Ferne hob sich eine kleine Damenhand. Strassbesetzte Armreifen sprühten Funken, ein wilder Rotschopf reckte sich in die Höhe. Chandra. Saomai rüstete sich für den Abstieg auf der zum Catwalk erleuchteten Freitreppe. Unsicher setzte sie einen Fuß vor den anderen. Die Finger ihrer linken Hand tasteten nach einem Handlauf, fanden jedoch nur raues Mauerwerk. In leiser Verzweiflung hob sie den Blick. Und verstand, warum Chandra diese Bar gewählt hatte! Es war, als spielten einem hier oben, dreiundsechzig Stockwerke über dem nächtlichen Bangkok, die Sinne einen Streich. Als schritte man auf einem Lichtstrahl hinunter auf die Stadt. Nur dass Saomai nicht das Gefühl hatte, zu schreiten. Ihr vernarbter Fuß schmerzte in dem viel zu hohen Pump und sie spürte, wie sich die Blicke der Männer darauf hefteten. Schon wandten sich einige der Herren ab. Es interessierte sie nicht.
Unten angekommen, kämpfte sich Saomai durch die Cocktails schlürfende Menge, die träge zu den Rhythmen schwerer Club Beats wogte. Endlich erreichte sie ihre Freundin und ließ sich ihr gegenüber in einen Loungesessel fallen.
„Hallo meine Liebe.“
„Hallo“, antwortete Saomai schwach.
Ihr Tisch lag an der äußersten Ecke der Dachterrasse, flankiert von einem gläsernen Geländer, dahinter der Abgrund. In diesem Teil der Bar war es ruhiger, die Musik drang gedämpft herüber. Chandras kreisrundes Thaigesicht mit den stoppelkurzen Haaren tanzte vor Saomai wie ein roter Vollmond über nachtdunklem Meer.
Muss an den Schmerztabletten liegen, dachte sie und schloss die Augen.
„Dir geht es nicht gut, was?“
Chandra klang besorgt.
„Doch, doch, es geht schon“, wehrte Saomai ab. „Es ist nur das erste Mal, dass ich ausgehe, seit…“
Sie ließ den Satz unvollendet.
Die beiden Frauen schwiegen betreten.
Schließlich räusperte sich Chandra und sagte: „Saomai, wir haben uns seit dem schrecklichen Tod deines Vaters nicht mehr gesehen. Es gibt keine Worte, die ausdrücken könnten, wie leid mir das tut!“
„Danke. Ist schon in Ordnung.“
„Nein, das ist es nicht. Lass uns nicht so tun, als könnten wir das heute Abend ausgrenzen“, insistierte sie.
„Ja, du hast vermutlich Recht.“
„Warum hast du nie zurückgerufen?“ fragte ihre Freundin eindringlich. „Ich wollte dir damals doch helfen.“
„Ich weiß“, antwortete Saomai leise. Die schmalen Schultern hoben und senkten sich. „Es ist nur so, dass mir niemand helfen konnte.“
„Das glaube ich nicht! Zumindest braucht man doch jemanden zum Reden, jemanden, der sich um einen kümmert. Du warst plötzlich ganz allein, hast keine Familie mehr. Ich wäre gern für dich da gewesen!“
Saomai sah zu Boden.
„Ja, jemand zum Reden tut schon gut.“ Gerade war es ihr aufgefallen.
„Dann lass uns jetzt reden“, sagte Chandra sanft. „Willst du mir erzählen, was damals passiert ist?“
Saomai seufzte. Sie hatte die Geschichte so oft erzählt. Der Polizei, dem Staatsanwalt, sogar der Presse. Damals, vor fast einem Jahr. Es hatte nichts genützt.
Ein Kellner nahm ihre Bestellung auf. Als er sich abwandte, legte Saomai die Stirn in Falten.
„Es war ein Dienstag“, begann sie zaghaft. „Ich hatte Spätschicht auf meiner Station und eigentlich längst Feierabend. Aber weil mich daheim um die Zeit nichts Besonderes erwartete, sah ich noch bei einem frisch operierten Patienten vorbei. Ich duschte im Krankenhaus, dann erst ging ich heim.“
Sie starrte in die Flamme der Kerze auf dem Tisch vor sich und hatte Mühe, weiter zu sprechen. Als sie es tat, war ihre Stimme brüchig.
„Ich habe mir richtig Zeit gelassen, verstehst du? Wäre ich eine halbe Stunde früher zu Hause gewesen, wäre mein Vater vielleicht noch am Leben!“
Chandra hatte ihre Hand genommen, streichelte mit dem Daumen darüber.
„Als ich fast da war, sah ich zwei Männer aus unserem Haus kommen. Dunkle Kleidung, den Blick gesenkt, als ob sie niemand erkennen sollte. Der hintere steckte sich irgendetwas in den Hosenbund. Erst später habe ich begriffen, dass es eine Pistole war. Die Situation kam mir so unheimlich vor, dass ich blind vor Sorge loslief. Im selben Augenblick sprangen sie in ein Auto. So ein schwerer Geländewagen. Der Motor muss die ganze Zeit gelaufen sein, sonst hätten sie nicht so schnell losfahren können“, sie schluckte schwer, „und ich wäre nicht in das Auto gerannt.“
Bei der Erinnerung an den Aufprall fröstelte sie trotz der tropischen Nachthitze. Die feine Narbe über ihrem linken Auge zuckte.
„Mein rechter Fuß kam unter den Reifen und mit dem Gesicht schlug ich gegen die Fahrertür.“
Chandra sah sie entsetzt an.
„Und dann?“, fragte sie behutsam, weil sie spürte, dass Saomai die Geschichte trotz aller Qual zu Ende erzählen musste.
Der Kellner brachte ihre Getränke. Saomai nahm einen Schluck Martini, bevor sie weitersprach.
„Ich war wohl bewusstlos. Jedenfalls standen Menschen um mich herum, als ich zu mir kam. Ich zeigte auf unser Haus und rief: „Mein Vater! Mein Vater!“, aber die Leute verstanden nicht, was ich meinte. Sie dachten wohl, ich hätte einen Schock. Ich wollte aufstehen, aber mein Fuß... Die Schmerzen habe ich gar nicht gespürt. Ich konnte nur einfach nicht stehen. Eine Frau hielt mich schließlich am Boden fest und sagte, der Krankenwagen sei unterwegs. Erst als meine Kollegen eintrafen, hat mir endlich jemand zugehört.“
„Oh Gott, wie furchtbar!“, rief Chandra voller Mitgefühl.
„Ja, zumal das wichtige Minuten waren.“
Saomais Stimme verebbte zu einem Flüstern. „Mein Vater ist nicht an den Schüssen in seinen Rücken gestorben. Er ist daran verblutet!“
Tränen rannen über ihr schönes Gesicht. Auch Chandra konnte ihre nicht zurückhalten. Schweigend saßen sie da und hielten einander an den Händen.
„Ist“, Chandra korrigierte sich, „sind die Täter gefasst worden?
„Nein.“
„Hast du die Männer denn nicht beschreiben können? Es gab doch bestimmt Verdächtige, eine Gegenüberstellung?“
„Ich hab‘ der Polizei sehr konkrete Hinweise gegeben“, sagte Saomai und ihre schwarzen Augen blitzten, „sie haben sie ignoriert.“
„Wieso ignoriert?“ Chandra konnte nicht glauben, was sie da hörte.
„Mein Vater hatte Morddrohungen erhalten und es war klar, von wem die kamen. Ein Immobilienhai, der sich schon das halbe Altstadtviertel unter den Nagel gerissen hatte, und dem nur noch das Krankenhaus fehlte, setzte uns zu.“
Chandra sah sie fragend an.
„Mein Pa war Direktor des Memorial Hospitals, in dem ich die Kinderstation leite. Die städtische Verwaltung gab viel auf seine Meinung. Er sprach sich gegen den Verkauf, und damit den Abriss des Krankenhauses aus, und sie folgten seinem Rat.“
„Wie mutig von deinem Vater. Ich meine, eine Morddrohung ignoriert man ja nicht einfach!“
„Wir waren natürlich besorgt deshalb. Trotzdem waren wir uns einig, nicht nachzugeben. Du kennst das Viertel – es ist noch so ursprünglich. Das darf nicht einfach platt gemacht werden! In unsere Klinik kommen viele Arme, die woanders nicht behandelt werden. Daraus wollen die eine Wellness-Farm machen!“
Saomai hatte sich in Rage geredet. Etwas ruhiger fuhr sie fort: „Das ganze Bauprojekt hing wohl an dem Krankenhaus. Und damit am Widerstand meines Vaters.“
Chandra sah sie eindringlich an. „Wenn es diese Drohungen gab, ist die Polizei denen doch bestimmt nachgegangen?“
Saomai wurde starr und drückte den Rücken durch.
„Lass uns von etwas anderem sprechen, o.k.?“
„Ja“, antwortete Chandra überrascht, „natürlich.“
„Erzähl mir von deinem Massage-Salon“, bat Saomai. „Wie läuft das Geschäft?“
Ihre Studienfreundin hatte sich vor eineinhalb Jahren aus der Medizin verabschiedet, um endlich Geld zu verdienen, wie sie spaßeshalber sagte.
„Sehr gut“, begann Chandra zögernd. Dann ließ sie sich auf den Themenwechsel ein. „Die Miete ist zwar horrend, aber das ist nun mal so im Business District. Dafür gibt es dort ein zahlungswilliges Klientel.“
Sie rieb Zeigefinger und Daumen der rechten Hand aneinander und grinste.
„Seit der Eröffnung vom ‚Delight Massage Club‘ habe ich 20 neue Thai-Masseurinnen eingestellt und schon dreimal neue Räume hinzugemietet.“
„Dann musst du gar nicht mehr selbst ran?“, fragte Saomai lachend.
Sie hatte ihre Freundin anfangs damit geneckt, dass Männer in einem Club mit diesem Namen wohl mehr erwarteten, als ‚nur‘ eine Massage.
„Nein“, Chandra lachte ebenfalls, „ich manage nur noch. Und was das angeht, gibt es eine klare Regel bei uns: no happy ending!“
„Das ist gut“, gab Saomai zurück. Sie behandelte fast täglich Thaimädchen und -jungen, oft noch Kinder, die von Freiern missbraucht wurden, und war froh zu hören, dass Chandra so etwas nicht duldete.
„Ich habe übrigens ziemlich prominentes Publikum“, erklärte ihre Freundin stolz.
„Echt? Erzähl!“
„Den Innenminister zum Beispiel und ein paar Abkömmlinge der Königsfamilie.“
„Wow!“ Saomai war ehrlich beeindruckt. Sie überlegte kurz. „Deine Klientel tummelt sich bestimmt auch in Nobelclubs wie diesem, oder?“
Chandra sah sich suchend auf der Dachterrasse um und nickte.
„Siehst du da hinten das indische Paar?“ Sie deutete mit dem Kinn nach links. „Er ist Schauspieler und in Indien eine Berühmtheit. Kommt fast jede Woche zur Massage.“
Saomai reckte den Hals.
„Oder die zwei Männer an dem Tisch vor der Bar.“
Chandra zeigte in die entgegengesetzte Richtung.
„Der Linke, das ist Neill Ferguson, stinkreich. Ihm gehört das Penthouse über meinem Club. Hat jeden Dienstag und Donnerstag einen festen Termin.“
Saomai hatte aufgehorcht, als der Name fiel. Neill Ferguson war der größte Baulöwe der Stadt. Und, wie sie aus der Presse wusste, ein Geschäftspartner des Mannes, den sie für den Mörder ihres Vaters hielt. Sie machte Ferguson an einem der Tische vor der illuminierten Bar aus. Neugierig musterte Saomai ihn. Das kantige Kinn ließ auf Amerikaner tippen. Dabei war er Norweger, wie sie gelesen hatte. Sein Haar trug er leicht nach hinten gegelt. Wohl um die Locken zu bändigen, die ihm dennoch zurück in die Stirn fielen. Besonders auffallend waren seine breiten Schultern. Vielleicht war er Schwimmer. Oder Rugby-Spieler? Er wirkte zurückhaltend, sprach ohne übertriebene Geste mit seinem Gegenüber. Mehr konnte Saomai von ihrem Platz aus nicht erkennen. Es war merkwürdig, Ferguson in natura zu sehen. Saomai hatte in den letzten Monaten jeden Zeitungsbericht über ihn und seinen Partner verschlungen, ausgeschnitten, abgeheftet.
Die Erinnerung an die Geschehnisse vor einem Jahr krampfte ihr den Magen zusammen. Sie schlang fröstelnd die Arme um ihren Körper.
„Saomai, ist alles in Ordnung?“
„Ja, geht schon“, wehrte sie ab.
Dann kam ihr ein Gedanke, der sie kerzengerade werden ließ.
„Du kennst nicht zufällig einen Lamom Benjawan?“