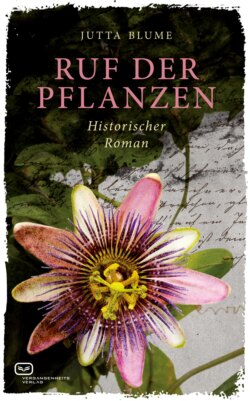Читать книгу Ruf der Pflanzen - Jutta Blume - Страница 6
Оглавление3
Der flaumige grüne Überzug der Felswand erwies sich bei genauerem Hinsehen als Mosaik von Grüntönen: graublaugrünes Geflecht, maigrüne zartblättrige Fächerpflanzen, Miniaturen mit kaum sichtbaren Blüten, freischwebende, dickblättrige Sterne. Das Geflecht nahm einen Moment ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Sie zeichnete mit dem Auge die Formenvielfalt nach, bis sie sich entsann, wo sie war – wenn sie das nur genau wüsste! Sie war in der Nacht in den Wald gelaufen, wo kein Mond ihren Weg erhellte. Sie hatte versucht, geradeaus zu gehen, so weit die Ranken ihr Durchlass gewährten. Sie hatte sich die Hände an dornigen Baumstämmen aufgerissen. Stimmen hatten sie begleitet, das Gebrüll einer Affenhorde in der Ferne, das Fiepen nächtlicher Kleintiere oben im Geäst, ein Grunzen aus dem Unterholz, das ihr einen Schauer über den Rücken jagte. Sie hielt zur Verteidigung ihr Messer umklammert, hauptsächlich, um ihr rasendes Herz zu beschwichtigen. Sie war gelaufen, bis es nicht weiter ging.
Ob sie sich nun nach rechts oder links wandte, überall schnitt ihr die grün gepolsterte Felswand den Weg ab. Schließlich hatte sie sich davor gelegt. Die Erschöpfung erlaubte ihr nicht länger, sich am Fels entlang zu tasten und gleichzeitig ihre Beine aus der stetigen Umarmung der Schlingpflanzen zu reißen. Sie musste sich ausruhen, und wenn es nur für eine Stunde war. Aber sie fiel in einen tiefen Schlaf, und als sie erwachte, herrschte die grüne Helligkeit des vollen Tages. Sie hatte keine Zeit zu verlieren und doch konnte sie nicht anders als zu stehen und zu staunen. Nie war sie so tief im Wald gewesen. Der Wald hatte immer dort hinter den Hütten und Feldern gelegen, greifbar nahe, und doch war er kaum mehr als der grüne Hintergrund ihrer Welt gewesen.
Ein paar Mal hatte sie Coba in den Wald begleitet. Coba hatte die Erlaubnis, weil sie eine Heilerin war und ihre Kräuter im Wald suchen musste, doch weit ins Dickicht wagte sich auch Coba nicht vor. Gerne ließ man sie nicht gehen. Immer wieder forderten die Herrschaften und die Wächter sie auf, ihre Kräuter im Garten anzupflanzen. Wieso sollten sie schließlich hundert Meter außerhalb des Waldes nicht wachsen, auf diesem Land, auf dem ohnehin alles wucherte, ob man nun wollte oder nicht? Coba brauchte Baumrinden und Pilze, die an den Wurzeln der Bäume und oben auf ihren Ästen wuchsen. So erhielt sie die Erlaubnis, hin und wieder in den Wald zu gehen. Ife hatte Coba begleiten dürfen, weil sie ihre Schülerin und Helferin war. Niemals hätte Ife auf einem dieser Ausflüge weglaufen können, weil sie Coba zu sehr liebte und Coba für Ifes Entkommen hätte büßen müssen.
Ife atmete. Die Luft war bis in ihre Lungen hinein grün gefärbt. Die Angst der letzten Nacht hatte sich unter dem Blätterdach aufgelöst. Der Wald war unglaublich ruhig, so als wäre sie das einzige Lebewesen weit und breit. Es war so ruhig, dass sie ihre Verfolger von Weitem hören würde. Sie sah an den geraden glatten Baumstämmen hoch, schwindelerregend und astlos verloren sie sich in der Höhe und boten keine Möglichkeit, sich vor Spürhunden zu retten.
Sie schlängelte sich durch die brusthohen Gewächse mit den riesigen Fächerblättern am Fuß der Felswand. Sie war nicht geübt im Klettern, aber gegen die Baumstämme war die Felswand ein Kinderspiel. Sie war ungefähr dreimal so hoch wie sie selbst. Von oben hingen Gewächse an Fäden hinunter, trügerische Seile, zu schwach für das Gewicht eines Menschen. Sie hakte ihre nackten Füße in eine Felsspalte, während ihre Hände nach Vorsprüngen tasteten. Einmal trat sie auf ihrem Weg nach oben auf etwas Weiches und sie glaubte, ein schwaches Fiepen zu hören.
Das Schwierigste war die Kante, denn den Pflanzen darauf war nicht zu trauen. Dann hing sie da, die Beine noch in der Tiefe baumelnd, der Oberkörper in der Waagerechten auf einer Moosschicht gebettet. Die Anstrengung der Kletterpartie war nicht groß und dennoch fühlte sie sich wieder unendlich erschöpft. Sie zog die Beine herauf, erhob sich auf alle Viere und schaute sich um. Hier oben war der Wald lichter, auch auf dem Boden wuchsen nur niedrige Polster und Kräuter. Dazwischen krabbelten unzählige schwarze Ameisen, jede so lang wie ihr halber kleiner Finger. Eine verlief sich zwischen ihren Zehen, fühlte sich bedrängt und biss beherzt zu. Ife rutschte ein winziges »Au« heraus und sofort presste sie strafend die Lippen zusammen, als könnte sie das kleinste Geräusch verraten.
Gehen, einfach gehen. So gerade wie möglich, wenn es schon keine Sonne gab, an der sie sich orientieren konnte. Etwas beunruhigt nahm sie zur Kenntnis, dass sich der Boden unter ihren Füßen wieder sanft nach unten wölbte. Sollte die Hürde, die sie genommen hatte, an anderer Stelle ganz bequem zu umgehen sein? Zumindest konnten die Hunde ihrer Spur nicht geradewegs folgen, würden bellend vor der steilen Wand stehen, bis ihre Halter sie um das Hindernis herumführten. Bald wurden die Pflanzen um sie herum wieder höher, standen aber nicht allzu dicht. Bei Tageslicht war der Wald erstaunlich durchlässig, Wurzeln, Lianen und andere Hindernisse waren nun sichtbar, und sie konnte ihnen aus dem Weg gehen. Die Pflanzen reckten sich nach oben, einer allzu fernen Sonne entgegen, die nur spärlich nach unten durchdrang. Trotzdem hatte sich auf Ifes Haut ein klebriger Film gebildet und sie sehnte sich nach einem erfrischenden Bad.
Auch nach Stunden hatte sich Ife nicht an die Stille gewöhnt. Ihr fehlten mit einem Mal das Knarren der Mühle, das Krachen von berstendem Holz in den Feuern, das anschwellende Rauschen der Siedekessel, das Rascheln von Zuckerrohr, der Gesang der Sklaven, selbst das Knallen der Peitsche. Stattdessen vernahm sie überdeutlich, wenn ein Stock unter ihren Füßen knackte, und das Bersten drang tief in den Wald hinein. Ganz selten hörte sie hoch über sich das Flügelschlagen oder den Schrei eines Vogels. Sie schien das einzige Lebewesen mit Beinen in einer Welt aus Pflanzen zu sein. Nicht ganz, da waren die Ameisen und andere lautlose Krabbeltiere.
Normalerweise hätte sie singen mögen, um sich zu vergewissern, dass sie Mensch und nicht Baum war. Doch ihr war es noch nicht gestattet, Mensch zu sein, zu nah war sie an der Plantage, und so musste sie sich in einen Baum oder Strauch verwandeln. Statt absichtlich laut zu sein, musste sie sich darauf konzentrieren, möglichst leise zu sein. Als Kind hatte sie es manchmal geübt, aber ihre Mutter hatte es ihr verboten, weil sie keine Indianerin war. Sie hatte dann heimlich Indianermädchen gespielt. Wenn sie die großen Wäschekörbe auf dem Kopf vom Fluss zum Haus balancierte, war sie ein Indianermädchen, das sich unbemerkt an Krokodilen und Jaguaren vorbeischlich. Krokodile waren in ihrer Fantasie die gefährlichsten Tiere der Welt. Wenn man sie weckte, sperrten sie ihr großes Maul auf, um ein Menschenkind mit einem einzigen Schnappen zu verschlingen. Jaguare schlichen sich unhörbar an, doch wenn man noch leiser ging als der Jaguar, dann hatte man gewonnen, und der Jaguar durfte einen nicht fressen. Sie erzählte ihrer Mutter nie von ihrer Indianerwelt. Ihre Mutter interessierte sich weder für Jaguare noch für Indianer. Dennoch gefiel der Mutter nicht, wie sie sich bewegte: »Dass du bloß nicht so an den Herrschaften vorbeistolzierst. Guck gefälligst zu Boden, wenn du ihnen begegnest. Wer hat dir eigentlich beigebracht, so mit den Hüften zu wackeln? Von mir hast du das nicht.« Und mehr zu sich selbst fügte sie hinzu: »Das wird ein schlimmes Ende nehmen mit diesem Kind, gütige Mutter, mach sie unsichtbar für die Augen der Gierigen.«
Ifes Mutter wusste natürlich nicht, dass sie, wenn sie erhobenen Hauptes daher stolzierte, kein Sklavenmädchen war, sondern eine frei geborene Indianerin.
Ife hatte selten Indianer zu Gesicht bekommen, auch wenn es hieß, dass sie dort draußen in den Wäldern lebten. Manchmal kam ein alter Mann auf die Plantage, der geheime Dinge mit dem Mister beredete. Seine Kleidung war ähnlich schlicht wie die der Sklaven, aber weniger zerlumpt. Er war mit allerlei Schmuck behangen, und sein Gesicht war mit roter Farbe bemalt. Die Sklaven betrachteten ihn stets voller Misstrauen. Es hieß sogar, dass die Indianer entflohene Sklaven jagten und sie zurückbrachten, manchmal tot, manchmal lebendig. Ihre Mutter hielt Ife bei den Strafzeremonien Augen und Ohren zu. Sie konnte sich aber nicht erinnern, dass die Entlaufenen von Indianern zurückgebracht wurden, auch wenn so einige nach kurzer Zeit wieder aufgetaucht waren.
Mutter, wenn du wüsstest, dachte Ife, du hast mich das hier nicht gelehrt. Mit deiner Ergebenheit. Wer den Kopf einzieht, wird von den Prügeln verschont bleiben. Ich hoffe, dass es dir geholfen hat. Es war merkwürdig: Wenn sie ihre innere Stimme an die Mutter richtete, blieb das Bild, das sie von ihr hatte, verschwommen, eine schwarze Fläche mit einer tiefen Narbe auf der Stirn, von einem Moment, als ihr das Kopfeinziehen nicht geholfen hatte. Ihr Mund, ihre Nasenflügel, der Schwung ihrer Augenbrauen blieb formlos. Ihre leise, ein wenig holprige Stimme war das, woran sich Ife am besten erinnern konnte, und daher fiel es ihr auch leichter, innere Zwiegespräche mit ihrer Mutter zu führen, als ihr Bild heraufzubeschwören. Wenn sie ihrer Mutter heute über den Weg liefe – nein, natürlich nicht im Wald, hier hätte man Mutter kaum in Ketten herschleifen können –, würde Ife sie überhaupt erkennen? Oder würde sie nur eine fremde gealterte Sklavin sehen, eine Frau mit faltiger Haut, hochgezogenen Schultern und gesenktem Blick? Wenn Mutter überhaupt noch am Leben war.
War es bereits Nachmittag, als Ife das Grün um sie herum lästig wurde? Sie liebte Pflanzen, sie hatte sich mit ihnen meistens besser verstanden als mit Menschen. Aber hier standen sie vor ihr als eine abweisende Armee von Fremden, die sie skeptisch beäugten, die ihr zuflüsterten: »Wir werden mal sehen, ob du hier durchkommst. Wo willst du denn eigentlich hin so alleine?« Es klang nicht bösartig, eher unbeteiligt. Ja, es störte Ife am meisten, dass ihr Schicksal ihnen ganz und gar egal war.
Irgendwann kam der Hunger, um ihr Gesellschaft zu leisten. Die Aufregung und die Erschöpfung hatten ihn erstaunlich klein gehalten, aber jetzt begann er in ihrem Magen zu rumoren und setzte sich über das Gebot der Stille einfach hinweg. Vielleicht wäre es klug gewesen, einige Handvoll Maniok zu stehlen, ein paar Stücke Zuckerrohr, es hätte ihr wenigstens über die ersten Tage geholfen. Der Hunger war zum Glück kein Fremder, sie traf ihn täglich, morgens beim Aufstehen, wenn sie vor dem Frühstück an die Arbeit musste und später, wenn sich der Tag dem Ende neigte.
Zum Hunger gesellte sich Durst. Gierig schaute Ife in die Hohlräume zusammengerollter Blätter, ob sich nicht hier und da ein paar Tropfen finden würden, aber es war zu lange trocken gewesen. Oft glaubte sie in einem Land ewigen Regens zu leben, aber wenn man den Regen brauchte, hatte er nicht einmal Spuren hinterlassen. Sie strengte ihre Ohren an, irgendwo in der Ferne das Plätschern eines Baches zu hören, und der Wunsch brachte erstaunlich realistische Töne hervor, doch Wasser konnte er nicht herbeizaubern. Ife besann sich der Kraft des Amuletts, das sie in sich trug. Würde sie an seiner Kraft zweifeln, wäre sie seiner auch nicht würdig. Ihr Körper war stark genug, nun musste ihr Geist wach genug sein, um ihre neue Welt zu finden. Leise, ganz leise, fast nur in ihrem Kopf hörbar, sang sie:
»Mi Aisa, mi aisa … «
Die Luft färbte sich erst dunkelgrün, dann graugrün und Ife wusste, dass nun innerhalb von Minuten die lange Nacht hereinbrechen würde. Es war die Stunde, zu der die Mücken ihr abendliches Mahl suchten.
In dieser Nacht ging sie nicht weiter, da sie niemanden auf ihren Fersen wähnte. Sie fand keinen besonders geeigneten Platz für ein Nachtlager und so rollte sie sich dort auf dem Boden zusammen, wo nicht zu viele Wurzeln in ihren Rücken drückten. Wie der Wald ihr tagsüber seine Stille entgegengeworfen hatte, so überschüttete er sie in der Nacht mit Geräuschen. Über ihrem Kopf begann es zu schreien und zu fiepen, Flügel wurden geschlagen, kleine Krallen kratzten an Baumstämmen. Auf dem Boden raschelte es mal schnell und leicht, mal knackte ein Holz, ja selbst das Atmen eines Tieres war zu vernehmen. Wenn sie die ganze Nacht auf die Geräusche hören wollte, würde sie kein Auge zutun.
Wie sollte sie die harmlosen von den gefährlichen Tieren an ihrem Blätterrascheln unterscheiden? Wie sollte sie wissen, ob sich in der Ferne ein Gürteltier oder ein Spürhund durch das Dickicht bewegte? Es gab so viel über diese fremde Welt zu lernen, doch aus Fehlern würde sie kaum klug werden. Sie musste das Kunststück bewerkstelligen, ohne Fehler zu lernen und im Schlaf wachsam zu sein.
Ife erwachte schon in der Dämmerung, wieder hatte sie tief und fest geschlafen, hatte sich unbedarft an die Nacht ausgeliefert. Direkt über ihr saß ein Vogel. Sein Lied klang vergnügt, und er zeigte keine Angst vor ihr. Selbst als sie ihren Körper stöhnend entrollte, bewegte er sich nicht von seinem niedrigen Ast. Er wackelte ein paarmal mit seinem Kopf, betrachtete sie mal mit dem einen, mal mit dem anderen Auge und setzte seinen Gesang unbeirrt fort.
Ife kratzte sich ausgiebig an Armen und Beinen, dann sah sie die haarige Spinne nur wenige Zentimeter von der Stelle, wo ihr Kopf gelegen hatte. »Du musst auf den Bäumen schlafen«, ermahnte sie sich. »Wie es die Indianer tun.« Die Indianer flochten sich Hängematten aus den Fasern des Waldes. Kein Indianer würde sich jemals wie die Sklaven in ihren Hütten auf ein ebenerdiges Strohlager legen. Doch sie hatte keine Zeit, sich eine Hängematte zu flechten. Jetzt noch nicht, sie musste noch weiter weg von der Plantage und möglichen Sklavenjägern.
Sie ging langsam und schaute immer wieder nach oben, ob in den Bäumen nicht irgendwelche Früchte hingen. Sie suchte nach den Früchten der Papaya und der Guayaba. Sofia-Bada liebte diese Früchte. Es war wichtig, die Winti bei Laune zu halten, am besten, indem man ihnen ihre Leibspeise gab. Loko mochte lieber irdene Gewächse wie den Maniok, füllte sich Ife den Magen mit seinem mehligen Brei, rieb er sich versonnen den Bauch. Aber Maniok musste man pflanzen, das wusste Ife, und man musste ihn kochen, wenn man sich nicht den Magen verrenken wollte. Maniok kam nicht infrage, Loko musste auf seine Leibspeise verzichten.
Die Dinge, die die Sklaven auf ihren eigenen Feldern und zwischen den Baracken des Yards anbauten, gab es hier nicht. Es gab andere Dinge im Wald, Dinge, die die Vögel aßen, wie Würmer und Ameisen. Coba hatte manches Mal ein Stück lose Rinde von einem Baumstamm abgehoben und sich die weißen, sich windenden Würmer in den Mund gesteckt. Ife hatte es mit Abscheu beobachtet.
»Was denn? Das ist besser als das, was sie uns auf der Plantage geben«, hatte Coba gesagt. »Greif zu, so etwas Gutes bekommst du so schnell nicht wieder.«
Doch Ife konnte nicht. Sie stellte sich vor, wie die Würmer sich in ihrem Inneren hin und her wanden, um schließlich aus der Nase wieder heraus zu kriechen. Sie konnte es nicht. Zwar hatte sie nie einen Wurm aus Cobas Nase herauskriechen sehen, aber vielleicht taten sie es auch nachts, wenn Coba schlief? Wenn ich bis heute Abend keine Frucht gefunden habe, dann will ich einen Wurm essen, dachte Ife. Sie wartete auf Lebas Kommentar dazu, doch Leba schien schon so von Hunger geschwächt, dass sie es nicht mehr wagte, die Stimme zu erheben.
Das Glück hatte ihr eine kopfgroße braune Kugel in den Weg gelegt. Ife lachte in Vorfreude auf die Nüsse, die ihr der Kopf, war er erst einmal geknackt, schenken würde. Sie versuchte erfolglos die Klinge ihres Messers in die harte Schale zu zwingen. Weit und breit lag kein einziger Stein am Boden. Ife warf die Kugel mehrmals gegen einen Baumstamm, der sie unbeeindruckt zurückwarf. Sie schleuderte die Frucht in die Höhe, aber sie landete nur mit einem dumpfen Geräusch auf dem weichen Waldboden. Schließlich nahm Ife die Kugel und ging weiter, irgendwann würde sie schon einen Stein finden, mit dem sie die Schale zertrümmern konnte. Sie musste nur Geduld haben.
Der Wald ließ sie warten. Nichts als Stämme, Ranken und Blätter, so weit sie sehen konnte. Einmal flogen zwei blaue Schmetterlinge vor ihr her, als wollten sie ihr den Weg weisen, erhoben sich dann aber plötzlich steil nach oben. Dann sanken ihre Füße immer tiefer in den Boden, und wenn sie sie hinauszog, füllten sich die Fußstapfen mit wässrigem Schlamm. Sie brauchte jetzt nur die hohle Hand hineinhalten und könnte das Wasser zum Mund führen. Doch sie forderte noch Geduld von ihren durstigen Winti. Ein Bach konnte nicht weit sein, klares Wasser satt, genug für die Bäuche einer ganzen Plantage. Sie konnte ihn schon hören. Sie musste nur hingelangen. Denn nun kratzten dornenbewehrte Sträucher an ihren Beinen, rissen Schrammen, an denen feine Blutströpfchen erschienen. Dichter und dichter wurde das Gestrüpp, es war kein Durchkommen, obwohl das Wasser gleich neben ihr liegen musste. Das Messer war kaum eine Hilfe.
Sie stapfte parallel zum Bach, dann entdeckte sie einen hüfthohen Gang zwischen den Büschen. Sie kroch auf allen Vieren hindurch und hoffte, kein Tier beim Laben am Wasser zu stören. Ein Tapir konnte sich den Gang gebaut haben, doch auch andere konnten sich über den einfachen Weg gefreut haben, etwa der Jaguar. Der Durst trieb Ife voran. Als sie endlich den Bach vor sich hatte, legte sie ihre Lippen auf die Wasseroberfläche und stillte ihren Durst wie ein Tier. Sie sah sich noch einmal um, ob sich auch kein Krokodil zu einem Mittagsschlaf ins Unterholz gelegt hatte. Aber da war nichts. Sie atmete auf, suchte nun das Ufer nach Steinen ab. Mit einem Kiesel trieb sie einen Riss in die braune Kugel, bis sie die Schale mit der ganzen Kraft ihrer Arme sprengen konnte. Die dreieckigen Kerne sprangen ihr in den Schoß, nun musste sie die zweite Schale öffnen, aber das war ein Kinderspiel. Sie ließ nicht von ihrer Beute ab, bevor sie die letzte Nuss mit den Zähnen zermalmt und heruntergeschluckt hatte. Sie war noch immer sehr hungrig.
Sie musste sich nun entscheiden, durch den Tiergang zurück in den Wald zu kriechen oder durch den Fluss zu waten. Der Weg durch den Fluss erschien einfacher, außerdem würde sie trinken können, wann immer der Durst sich meldete. Doch Coba hatte sie vor den Flüssen gewarnt. Alle Tiere liebten Flüsse.
Ife entschied sich trotzdem für den Fluss, um zumindest für eine Weile schneller voranzukommen. Außerdem brauchte jeder, der im Wald leben wollte, Wasser, auch die Freien, die sie suchte. Wenn sie sich nur in Wassernähe hielt, würde sie sie finden, da war sie sich sicher. Jedoch hatte der Fluss keine Eile, kurvig schlang er sich durch das Grün des Waldes, um es von allen Seiten begutachten zu können.
Bevor die Umgebung in einem undurchsichtigen Grau verschwamm, schnitt sich Ife einige Ranken von den Bäumen und verknotete sie zu einem grobmaschigen Netz, das sie tragen konnte. Sie hängte das Netz zwischen zwei Baumstämme und streckte sich darin aus so gut es ging. Es war nicht bequem, aber immerhin trockener als der Waldboden. Und die Müdigkeit tat das Übrige, um Ife erneut einen tiefen Schlaf zu bescheren.
Wieder umfing sie die Welt in sattem Grün. Was sie hier zu sehen bekam, war kunstvoller als die einfachen Zuckerrohrpflanzen. Oval, herzförmig, gefingert, gezackt, handgroß, tellergroß und noch größer waren die Blätter – wer hatte sich all das ausdenken können? Waren all diese Blattträger verschieden, oder gab es Brüder und Schwestern unter ihnen, Zwillinge gar, vom Charakter so ähnlich, dass sich die Götter vor ihnen erschreckten? War es möglich, diese Welt zu verstehen, die Pflanzen sprechen zu hören? Selbst Coba, die so viel über ihre Heilkräfte wusste – hatten die Pflanzen sie jemals wirklich angesprochen? »Guten Morgen«, flüsterte Ife in die Höhe, vielleicht war das leise Rascheln über ihr als Antwort zu verstehen.
Sie löste ihre einfache Hängematte von den Baumstämmen, zögerte einen Moment, ob sie sie für die nächste Nacht bei sich tragen sollte, entschied sich dann, auf den Ballast zu verzichten und zerstörte sorgsam ihr Werk, um keine Spuren zu hinterlassen. Ihr war übel vor Hunger. Sie schnitzte sich einen Speer, mit dem sie sich lauernd ins flache Wasser stellte. Das unruhige Glitzern auf der Oberfläche verstärkte noch ihre Übelkeit. In dem bewegten Wasser konnte sie die Fische nicht sehen. Mehrmals spürte sie einen glitschigen Körper ihr Bein streifen, doch sie konnte den Speer nur blind ins Wasser stoßen. Die Jagd war unter diesen Umständen eine Kraftverschwendung. Ife füllte den Magen mit Wasser und watete weiter. Als sich der Fluss über eine Stufe in die Tiefe fallen ließ, musste sie wieder an sein Ufer ausweichen. Der Weg war nun erstaunlich bequem, und so lief sie trockenen Fußes weiter, das Wasser immer in Hörweite.
Plötzlich warf sich ein Busch mit seinem gesamten Gewicht auf sie. Für sein lockeres Laub war er seltsam schwer und kompakt. Hart packte er sie im Nacken und drückte ihr Gesicht in den Boden.
»Ke kere aki?«, raunte er mit tiefer Stimme. Die Sprache des Busches war nicht ihre Sprache, wenngleich ihr der Klang nicht ganz fremd war.
»Wirst du mich zurück nach Sugar Creek bringen? Sie werden mir die Zehen abhacken, nicht wahr? Lass mich frei, ich bitte dich, ich bin eine nutzlose Sklavin, schwach durch eine schwere Krankheit, sie können nichts mit mir anfangen. Überlass mich hier meiner selbst, ich flehe dich an!«
Der Busch grunzte und zog sie am Nacken nach oben. Bei genauer Betrachtung verbargen sich zwischen seinen Blättern zwei weiß blitzende Augen.
»Wen«, sprach der Busch und drehte sich von ihr weg. Geschickt schlängelte er sich durch das Pflanzenreich. Ohne ihn zu verstehen, wusste sie, dass sie ihm folgen sollte. Doch fast verlor er sich schon im Grün, sie musste rennen, um mit ihm Schritt zu halten. Wer sich so wenig darum kümmerte, ob sie hinterher kam, konnte kein Häscher sein. Bald standen sie an einer Felswand, ähnlich der, die sich Ife in der ersten Nacht ihrer Flucht in den Weg gestellt hatte.
Der Busch entkleidete sich seiner Blätter. Auch ohne sein Laub war er ein Riese, sie wusste nicht, ob sie so ein großes Exemplar in Sugar Creek hatten. Dieser hier war so prachtvoll, dass sein Besitzer bestimmt zehn Häscher auf ihn angesetzt hatte. Er war nicht nur riesig, sondern auch, bis auf einen dürftigen Lendenschurz, nackt. Er steckte seine Zweige in einen Felsspalt, sah sich nach Ife um und wies mit seinem Kopf nach oben. Er musterte sie kurz, als wenn er fragen wollte: Schaffst du das auch? Ife sah sich die Wand an. Sie war höher als die letzte, die sie erklettert hatte. Stumm folgte sie dem Fremden. Ife beobachtete fasziniert, wie geschickt er Hände und Füße setzte und sich geschmeidig den Felsen hoch bewegte, sodass sie ganz vergaß ihm zu folgen. Er blieb an der Wand kleben und drehte den Kopf zu ihr um.
»Wen«, sagte er noch einmal. Ife ärgerte sich, dass sie sich vor lauter Bewunderung nicht gemerkt hatte, wo er entlang geklettert war. So musste er von oben auf die Stellen zeigen, an denen sie sich festhalten konnte. Als sie ihn erreicht hatte, packte er sie an den Armen und hob sie über die Kante.
Hatte es von unten so ausgesehen, als ob auf dem Felsplateau nur der ewige Wald wüchse, bot sich nun der Anblick einer mit dem Wald verwobenen Siedlung. Zwischen den Bäumen spannten sich kleine Dächer aus Palmengeflecht. Davor waren verschiedene Sträucher angepflanzt, Kakao und Bataten konnte Ife erkennen. Das Lager war luftiger als ihre Unterkünfte in Sugar Creek, die Dächer geschickter und filigraner gearbeitet. Unter den Dächern hingen geflochtene Hängematten. Erstaunlich an dem Lager war die Stille, die nicht anders war als im Wald. Ife hatte insgeheim gehofft, das Gemurmel menschlicher Stimmen zu vernehmen, vielleicht ein Lachen, vielleicht einen Schrei. Doch diese Menschen, von denen sie momentan nicht besonders viele sah, waren diskret wie die Tiere des Waldes. Sie verrieten sich weder durch ihre Tritte noch durch ihre Stimmen.
Ein kleiner alter Mann hockte im Schneidersitz vor einer Hütte und pulte fingerlange dunkelbraune Schoten auseinander.
Der Alte blinzelte sie aus misstrauischen Augen an, Echsenaugen, deren Lider sich in tausend Falten zusammenkniffen. Er rief etwas in einer unverständlichen Sprache zu dem anderen hinüber. Dabei sprach er nicht wirklich, es war eher ein tonloses, aber durchdringendes Raunen. Der andere schnaubte und hockte sich dann zu dem Alten. Ife blieb ratlos stehen. Sie fühlte sich nicht willkommen. Sie wagte nicht, sich dazu zu setzen.
Die beiden Männer tuschelten, der Alte immer noch in seine Schoten vertieft. Nach einer endlosen Weile kam der Jüngere zurück zu Ife.
»Sugar Creek?«
Ife nickte.
Er schüttelte den Kopf. »Impossible.«
Das Wort verstand sie, und es stahl ihre Hoffnungen.
Bevor sie sich weiter über ihr Schicksal Gedanken machen konnte, zog sie der Große leicht am Arm. Sie durchquerten schnell die Siedlung, Ife zählte zehn Behausungen. Bald standen sie wieder vor einem Abgrund. Der Mann holte eine dicke Liane aus dem Gebüsch, die er zum Abseilen hinunterwarf. Die Wand war an dieser Stelle glatt, gab keiner Hand und keinem Fuß Hinweis, wo sie Halt finden konnten. Unten angekommen, liefen sie stumm durch den Wald. Ife verlor schon bald wieder die Orientierung.
Sie überquerten einen Bach, dann standen sie plötzlich vor einer dornenbewehrten Palisade. Ifes Begleiter stieß einen Vogellaut aus. Nach einer Weile wurden von innen zwei glatte Stämme aus dem Zaun gezogen. Eine Frau mit harten Gesichtszügen und kräftigen Sehnen am Hals hielt die Stämme in den Armen. Sie war größer als Ife, barbusig und trug eine Kette aus aufgefädelten braunen Samen. Um die Hüfte hatte sie ein schmutziges Tuch geschlungen, darunter schauten muskulöse lange Waden und riesige nackte Füße hervor. Ifes Begleiter sprach einige Sätze mit ihr, dann wandte er sich zum Gehen. Die Frau rammte die beiden Stämme hinter Ife mit der Kraft ihrer bloßen Hände in die Erde. Danach musterte sie Ife von oben bis unten, ohne mit einer Miene zu verraten, was sie von dem Neuankömmling hielt.
Diese Siedlung war aufgeräumter als die oben auf dem Felsen. Die Hütten waren ähnlich gefertigt, standen aber enger beisammen. Und es gab hier Frauen und Kinder. Manche Frauen hatten ihre Säuglinge auf den Rücken gebunden, andere Kinder krabbelten auf der Erde herum. Die Kinder waren nackt, die meisten Frauen hatten ihre Hüften mit Tüchern verhüllt. Auch hier herrschte trotz der vielen Kinder eine ungewöhnliche Stille. Als ein Kind aufschrie, zischte die Mutter es sofort an. Das Kind verstummte schuldbewusst. Ife war dem Kind nur für diesen kleinen Schrei dankbar.
Ife zählte 15 Frauen und sieben Kinder. Sie waren damit beschäftigt, Wurzeln auszugraben und mit großen Mörsern etwas zu zerstampfen. Eine alte Frau schnitzte Pfeilspitzen. Die meisten ließen von ihrer Arbeit ab und kamen angelaufen, um Ife anzustarren. Es waren ernste bis feindselige Augen, die in hageren Gesichtern wohnten. Die Älteste im Kreis richtete das Wort an Ife. Sie sprach ein Englisch, das nur schwerfällig aus ihrem Mund wollte.
»Du kommst von Sugar Creek?«
Ife nickte.
»Du bist weggelaufen?«
»Ja.«
»Bist du alleine weggelaufen?«
»Ja.«
»Wieso bist du zu uns gekommen?«
»Ich bin nicht zu euch gekommen. Ein Mann hat mich im Wald gefunden.«
»Das wissen wir. Aber vorher bist du dorthin gelaufen.«
»Ich bin einfach gelaufen. Ich wusste nicht, wo ihr lebt. Ich würde auch nicht den Weg von hier zurück zur Plantage finden.«
»Das ist schlecht«, sagte die Alte. Ife schnürte sich der Hals zusammen. Sie sollte also zurück.
»Wenn du auch nicht wusstest, wo wir leben«, fuhr die Alte fort, »wolltest du dennoch zu uns.«
»Ich hatte von Freien gehört, die hier im Wald leben.«
»Und du dachtest, wir würden uns über jede Neue freuen.«
Statt einer Antwort ließ Ifes Magen ein grollendes Knurren vernehmen. Die Alte schaute bedeutungsvoll in die Runde und rollte mit den Augen. Ife schaute betreten zu Boden, verfluchte ihren Magen und die Stille, die seine Unzufriedenheit noch lauter erklingen ließ.
»Was kannst du?«, fragte die Alte ein wenig milder als zuvor.
Ife fühlte sich plötzlich wieder wie ein dummes kleines Mädchen, das zu nichts zu gebrauchen war und dem man damit drohen konnte, es am nächsten Samstag zum Sklavenmarkt zu bringen. Verschwunden war das stolze Indianermädchen, das sie als Kind so gerne gewesen wäre. Sie war eine nichtswürdige Sklavin, die selbst anderen ehemaligen Sklavinnen nicht gut genug war. Wie naiv war sie gewesen, als sie dachte, der Mut zum Weglaufen würde schon ausreichen, um frei zu sein. Sie hätte weinen mögen. Doch diese ernsten, trockenen Gesichter um sie herum, Ausdruck einer jahrelangen Dürre inmitten von üppigem Grün, würden auch von Tränen nicht zu erweichen sein.
»Ich kann den härtesten Boden aufhacken«, sagte Ife, »ich kann Bäder, Umschläge und Tees gegen die häufigsten Wunden und Krankheiten herstellen. Amulette darf ich leider noch nicht machen.«
Die Mundwinkel der Alten zogen sich immer verächtlicher nach unten.
Entschuldigend fuhr Ife fort: »Meine Lehrerin, die Coba, hat immer gesagt, dass ich noch Geduld haben müsse. Ich sei eine gelehrige Schülerin. Aber ich habe es nicht länger in Sugar Creek ausgehalten.«
In die dunklen Augen der Alten zog ein seltsames Licht ein, während ihr Mund sich entspannte.
»Die Coba? Ist sie in Sugar Creek?«
Ife nickte.
»Ja, hätte ich mir denken können.« Sie sagte etwas zu der Frau neben ihr. Die stand auf und kam kurz darauf mit einer gefüllten Schüssel zurück, die sie Ife reichte. Darin war ein violetter, körniger Brei. Anscheinend hatte sie mit der Erwähnung von Coba eine unbekannte Prüfung bestanden. Da sie keinen Löffel hatte, tunkte sie den Zeigefinger ein und leckte den Brei ab, der daran kleben blieb. Die Masse war etwas süßlich, mehlig und zugleich fruchtig. Nach dem Schlucken blieb eine klebrige Schicht auf der Zunge zurück. Ife leckte den gesamten Brei auf ohne aufzusehen. Die Frauen um sie herum ließen währenddessen keinen Mucks vernehmen.
Als sie aufgegessen hatte, nahm man ihr die Schüssel aus der Hand. Ife hatte sie so blankgeleckt, dass Waschen nicht mehr nötig war.
»Du sollst eine Weile bei uns bleiben«, verkündete nun die Alte und Ife entfuhr ein Seufzer der Erleichterung. »Wir werden sehen, wofür du zu gebrauchen bist. Du musst uns genau beobachten und du musst mir Auskunft geben, wenn ich dich frage. Die anderen sprechen deine Sprache nicht, aber du wirst die unsere schon aufschnappen. Wer hat dein Amulett gemacht?«
»Coba.«
»Natürlich Coba. Die alte Zauberin.« Die Frau kicherte. »Sie war immer so ahnungslos.« Dann wandte sie sich jäh ab, ein kleines Mädchen mit dichtgelocktem Haar folgte ihr. Die anderen Frauen waren schon wieder in ihre Arbeiten vertieft. Ife blieb sitzen und beobachtete das Geschehen um sie herum. Sie verspürte nach den langen Märschen der letzten Tage keinen Drang irgendetwas zu tun. Die Alte hatte ihr ja nur gesagt, dass sie die anderen beobachten sollte. Da niemand länger Notiz von ihr nahm, fühlte sie die Anspannung von sich abfallen. Auch die Stille tat ihr nicht mehr in den Ohren weh. War dies die Freiheit? Bei Tageslicht dazusitzen und die Hände in den Schoß zu legen? Waren die Winti des Waldes zu ihr gekommen, sodass sie sich nicht mehr so einsam zwischen den gleichgültigen Bäumen und Menschen fühlte?
Eine Dreiergruppe Frauen brach mit geflochtenen Kiepen und Buschmessern in den Wald auf. Andere zerkleinerten Kakao und wiederum andere Früchte, die Ife noch nie gesehen hatte. Zwei etwa sechsjährige Mädchen zersplissen Stöcke in ihre Fasern. Sie schienen die ältesten Kinder in der Gruppe zu sein. Waren sie die ersten Kinder, die in dieser Gruppe von Freien zur Welt gekommen waren? Die Alte, die Ife ausgefragt hatte, schnitzte Pfeilspitzen. Sie saß alleine, konzentriert, und doch sah man ihr an, dass sie jedes feinste Detail des Geschehens um sie herum wahrnahm, dass sie eine Tausendäugige mit dem Gehör einer Schlange war.
Am Abend machten sie kein Feuer. Um die Mücken abzuwehren, rieben sie sich mit einer roten Paste ein. Ihre Stimmen waren ein leises Blätterrascheln im Wind. Ife genoss das abendliche Leben des Waldes, nichts erschien ihr mehr bedrohlich, sie alle waren Wiedergänger wilder Tiere und niemand konnte ihnen etwas anhaben. Nur die Stimme der Alten, die sich in der Dunkelheit von links in ihr Ohr schob, war nicht Tier, sondern Richterin. Doch eine milde Richterin, die vor dem Urteil nach der Wahrheit suchte. »Sprich von Kukua«, forderte die Stimme.
»Kukua?« Sie drehte sich nicht um, sondern fragte die Luft vor ihrem Gesicht.
»Coba haben sie sie genannt, weil ihr Name falsch auf dem Papier stand.«
»Du kennst sie gut, nicht wahr?«
»Ich habe dich gebeten zu reden. Ob ich dir meine Geschichte, Kukuas Geschichte, erzählen werde, werden wir sehen.«
Wenn die Alte Coba so gut kannte, wieso hatte Coba nie von ihr gesprochen?
»Ihr Rücken ist so krumm, als hätte ein stolzer Baum genug von der Welt gesehen und wollte zurück in die Erde wachsen. Sie ist sehr weise, aber der Mut hat sich von ihr abgewandt. Vor ein paar Tagen hat die Peitsche eines seltsamen Fremden sie getroffen, und es mag sein, dass ich Schuld daran trage. Nachdem sie sie geprügelt hatten, haben sie sie zurück in ihre Hundehütte getragen und sie hat mein Essen nicht angenommen. Ich habe ihr nicht gesagt, dass ich am nächsten Abend gehen würde, und ich habe sie nicht mehr gesehen. Sie hätte sofort gewusst, dass ich käme, um Abschied zu nehmen.«
»Wie lange ist sie schon in Sugar Creek?«
»Seit ich denken kann. Aber ihr Rücken wächst erst seit der letzten Regenzeit nach unten.«
»Bist du in Sugar Creek geboren? Wie ist dein Name, Kind?«
»Meine Mutter hat mich Ife genannt. Die Herrschaften nennen mich anders, doch ich will diesen Namen vergessen. Meine Mutter war darauf bedacht, dass ich fleißig und ohne zu murren meine Aufgaben verrichte und dass ich den Herrschaften niemals ins Gesicht schaue. ›Sie haben böse Augen wie die Ziegen‹, hat sie gesagt. Ich habe ihr nicht geglaubt und doch hochgeschielt. Und sieh, was aus mir geworden ist. Aber du interessierst dich sicher nicht für mich, ich bin als Sklavin geboren und ich habe auf einer einzigen Plantage das Arbeiten gelernt. Es gibt nichts über mich zu erzählen.«
»Kukua war also schon dort, als du geboren wurdest.«
»Ja, und als Kind hatte ich Angst vor ihr. Aber an dem Tag, als sie Mutter fortgebracht haben, hat sie mich zu sich genommen und mir meine erste Lektion erteilt.«
»Sie muss damals noch stark gewesen sein.«
»Oh ja, sie konnte alleine mit zehn Wintis tanzen, ohne dass ihr schwindelig wurde. Und arbeiten konnte sie auch, obwohl sie so klein war, schon als Mädchen war ich größer als sie.«
»Am Mittwoch waren die Dyodyo müde. Sieh, mich haben sie noch groß und kräftig geschaffen, bei ihr mussten sie sich ausruhen. Abena war unsere Mitte. In Kukua ist dafür ein zähes Kra eingezogen.«
»Ihr seid drei Schwestern?«
»Sieben, eine für jeden Tag der Woche. Esi, Adjoa – das bin ich –, Abena, Kukua, Ya, Efia, Kwame. Ich habe sie alle verloren. Jetzt erfahre ich von dir, dass Kukua noch da draußen ist.«
»Coba hat nie von dir gesprochen.«
»Wieso auch? Ich habe vor vielen Jahren aufgehört zu existieren. Ich existiere nur hier allein, frag die Schwestern, ob sie jemals von mir haben reden hören, bevor sie in den Wald kamen.«
»Auch von den anderen Schwestern hat sie nie gesprochen. Würdest du nicht Cobas Schmerz lindern, wenn sie wüsste, dass du frei und am Leben bist?«
»Tief in ihrem Inneren wird sie es wissen, Ife, Kind der Liebe. Für die Liebe haben sie uns nur wenig Platz gelassen zwischen ihren Feldern und den Bretterhütten, die wir uns selbst bauen sollten, dort, wo es anfangs nur Sumpf gab.« Sie schwieg einen Moment lang. »Sie haben Coba also nicht als Zauberin fortgejagt?«
»Die Blicke der Weißen sind voller Zweifel, wenn Coba ihre Medizin aufträgt. Und dennoch müssen sie sich ihrer Kunst ergeben. Seit sie Coba gewähren lassen, verabschieden sich weit weniger von uns in das Reich der Geister. Nicht alle finden, dass ihnen Coba damit einen Dienst erweist. Die Weißen glauben nur an Ergebnisse, gegen ein gutes Ergebnis kann niemand etwas sagen.
Coba ist eine schlaue Sklavin, sonst hätte sie niemals so alt werden können. Sie hat eine weiße und eine schwarze Heilkunst erdacht. Die weiße Heilkunst ist die, die sie an den Herrschaften und vor ihren Augen vollführt. In dieser Medizin gibt es Tinkturen, Tees und Massagen, aber es ist eine klanglose Kunst. Kein Gebet und kein Lied verlässt derweil Cobas Lippen. Manchmal holt sie das später nach. Und wir wissen, dass auch die Weißen danach heimlich zu ihrem Gott beten.«
»Haben die Winti sie niemals wegen ihrer doppelten Zunge bestraft?«
»Sie ist nicht doppelzüngig!«
»Du sollst einer alten Frau wie mir nicht widersprechen, hat man dir das nicht beigebracht? Schweigen und sich seinen Teil denken ist auch eine Sprache, mein Kind. Aber da ihr Sklaven seid, sei euch zumindest von meiner Seite verziehen, ihr könntet anders nicht überleben. Ob die Winti verzeihen, ist eine andere Sache.«
»Wir können nichts dafür, dass wir so leben müssen, und die Winti wissen das. Aber zum Glück habe ich dieses Leben jetzt hinter mir gelassen.«
»Glaub nicht, dass du bei uns im Paradies bist. Bleib nur ein paar Tage, und du wirst schon sehen. Nun sag mir noch eins: Wieso haben sie Coba geprügelt, und wieso bist du fortgelaufen?«
»Das sind schwierige Fragen. Ich weiß nicht, ob ich sie beantworten kann.«
»Du musst reden, mein Kind, ob du mir vertraust oder nicht. Wenn ich nicht weiß, warum du zu uns gekommen bist, kann ich nichts über deine Zukunft sagen.«
Die alte Adjoa wollte also mit ihr Gericht halten, jetzt und hier.
»Ich wollte seit einiger Zeit schon fortgehen. Ich hatte das Amulett schon fertig neben dem Bett liegen, ich hoffte, es hätte seine Kraft noch nicht verloren. Was mich gehalten hat, war Coba. Es gab noch so viel zu lernen, und ich wollte sie dort nicht alleine lassen.«
»Hat nicht Coba schon immer bewiesen, dass sie es alleine schafft? Hat dich nicht deine eigene Angst zurückgehalten?«
»Natürlich hatte ich Angst, aber was dort geschehen ist, hat mir noch mehr Angst gemacht. Dieser Fremde mit der runzligen Haut eines Neugeborenen und dem Stroh auf dem Kopf. Er ließ Coba schlagen, und niemand hat seine Reden verstanden. Es wohnt etwas Fremdes in ihm. Ich weiß nicht, was es ist, aber es hat etwas mit den Pflanzen zu tun.«
»Auch wir leben inmitten von Pflanzen, sie sind das einzige Haus, das wir haben. Wie kann dich das beunruhigen?«
»Er hat eine Beziehung zu ihnen, die nicht natürlich ist. Er nennt sie mit seltsamen Namen und er hat ihre Bilder in Büchern. Er hat Coba schlagen lassen, weil sie seine Fragen nach den Pflanzen nicht beantworten wollte.«
»Hattest du Angst, dass er auch dich fragen und bestrafen würde? Ist das der Grund, warum du weggelaufen bist?«
»Nein. Es war noch etwas anderes. Ich hatte den Samen eines Mannes in mir, aber es wäre kein Kind der Liebe geworden. Ich habe es zurückgeschickt und mich bei meinen Vorfahren entschuldigt.«
»Dein Mister?«
»Nein, nein. Er ist ein Sklave wie ich. Er hat mir kein Leid zugefügt. Aber wie du schon sagtest: für die Liebe haben sie uns keinen Platz gelassen.«
»Die Winti und die Vorfahren werden deine Entscheidung respektieren. Wovor hast du also wirklich Angst?«
»Coba ist, bevor der Fremde dazu kam, auch von unserem Mister bestraft worden. Eine Sklavin ist gestorben, die das Gleiche getan hat wie ich. Er hat Coba die Schuld gegeben. Die Dinge beginnen, sich zu verändern. Früher haben sich die Herrschaften nicht für schwangere Sklavinnen interessiert. Sie haben sie so hart weiterarbeiten lassen wie zuvor, und viele haben niemals ein lebendiges Kind geboren. Nun lassen sie die Schwangeren etwas weniger arbeiten. Sie haben verstanden, dass die Sklavinnen neue Sklaven gebären. Du musst wissen, dass in letzter Zeit immer weniger neue Sklaven ankamen.«
»Wissen sie, dass die Sklavinnen die Geister ihrer Kinder absichtlich fortschicken?«
»Ich glaube nicht, und wenn, dann haben sie keine Ahnung, wie wir es tun. Unsere Missus hat die Ayoowiiri im Garten stehen, weil sie den Anblick der Blüten so liebt. Ich konnte die Samen einfach im Garten unserer Herrschaften pflücken. Aber der Fremde scheint mehr zu wissen, er hat Coba über die Blüten und die Samen ausgefragt, er nannte die Pflanze Flos Pavonis, und niemand hat ihn verstanden. Aber er brauchte ja nur auf die Exemplare der Missus zeigen.«
»Ayoowiiri ist gut gegen Fieber und heilt Wunden, könnte es nicht das sein, was ihn interessiert? Und selbst wenn er auch das andere erfährt, nur die gute alte Kukua könnte die Hand des Schicksals treffen. Ich sehe deswegen keine Gefahr für dich.«
»Heißt das, dass du mich zurückschicken willst?«
Noch bevor Ife die Antwort hören konnte, füllte ein ohrenbetäubendes Rauschen ihre Gehörgänge aus, als sie von einem harten, eiskalten Wasserfall getroffen wurde. Sie konnte nur sehen, wie Adjoa die Lippen bewegte und dabei den Kopf schüttelte.