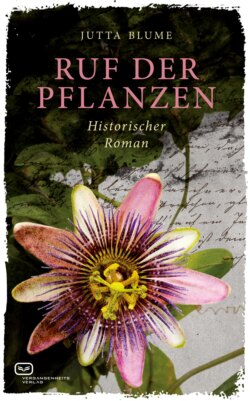Читать книгу Ruf der Pflanzen - Jutta Blume - Страница 8
Оглавление5
Der Rotgesichtige sagte etwas zu seinem Sklaven, was Ife nicht verstand. Sofort ging dieser auf Ife zu, umklammerte ihre freie Hand und näherte sein Buschmesser ihrem Hals, ohne dabei aber besonders überzeugend zu wirken. Mit dem freien Arm drückte Ife ihre Palmblätter an die Brust. Nun kam auch der Rotgesichtige näher, fixierte Ife weiter mit seinen blauen Augen. Sein Blick verriet deutlich, dass er darauf brannte, Ife ihr Bündel zu entreißen.
Eine Frage kam aus seinem Mund auf Ife zugeschossen, doch Ife konnte seine Worte nicht verstehen. Sie klangen nur entfernt wie Englisch.
»Was hast du da?«, sprang der Sklave ein.
»Blätter.«
»Was hast du damit vor?« Der Sklave übersetzte weiter die Worte des Fremden.
»Medizin.«
»Für wen ist die Medizin?« War es besser zu behaupten, dass sie von Sugar Creek kam oder im Gegenteil, dass sie sich nur zufällig hierher verlaufen hatte?
»Meine Leute«, antwortete sie ausweichend.
»Wer sind deine Leute?«
»Wir sind nur unbedeutende Neger, was spielt das denn für eine Rolle?«
»Gib mir das Bündel«, übersetzte der Sklave weiter.
Ife drückte die piekenden Palmblätter noch fester an sich. Es war Adjoas geheime Botschaft der Liebe. Sie durfte sie nicht verlieren, so kurz vor dem Ziel.
»Sie sagt nicht die ganze Wahrheit«, mischte sich Coba mit heiserer Stimme ein. »Sie kommt von Sugar Creek. Wir waren zusammen im Wald, um Kräuter zu suchen. Plötzlich war sie verschwunden. Ich habe sie gerufen, konnte sie aber nirgends mehr entdecken. Die Herrschaften haben behauptet, sie wäre fortgelaufen, aber bedenken Sie, wer möchte schon dort draußen alleine überleben? Sehen Sie, dieses Mädchen weiß zwar ein wenig über Medizin, aber sie weiß nicht, wie sie sich alleine Nahrung beschafft. Sie hat sich verlaufen, sie wäre niemals freiwillig in den Wald gegangen. Sie war eine gute Sklavin, sie hat mir in der Krankenbaracke geholfen. Die Herrschaften haben ihr viel Vertrauen geschenkt.«
Der Sklave übersetzte nicht mehr. Der Fremde schien zu verstehen. Er stellte Coba eine Frage und Coba nickte langsam. Demnach verstand sie das Kauderwelsch des Fremden, das bei genauem Hinhören doch ein wenig nach Englisch klang, nur so, als würde er ein bekanntes Lied zu einer völlig falschen Melodie anstimmen. Ife konzentrierte sich auf die Worte, und glaubte in der nächsten Frage die Worte »Wie« und »überlebt« zu erkennen.
»Das weiß ich nicht. Fragen Sie sie selbst, aber lassen Sie George das Messer von ihrem Hals wegnehmen, das lähmt die Zunge. Margaret heißt sie.«
»Margaret, stimmt das, was die Alte sagt?«
Margaret, wie lange war sie nicht mehr mit diesem Namen angesprochen worden. Dem Namen, den der Mister in seinen Büchern vermerkt hatte, weil Ife für ihn kein Name war. Doch ihre Mutter hatte den Namen nie in den Mund genommen, und auch die anderen Sklaven hatten sie stets Ife gerufen. Ife brauchte immer einen Moment, um zu reagieren, wenn sie jemand Margaret nannte.
Sie nickte beflissentlich.
Der Rotgesichtige kniff das Gesicht zusammen, und das Rot ging in Purpur über. Die folgenden Sätze spuckte er so sehr aus, dass ein paar Fetzen Speichel mit hinausflogen. Ife starrte fasziniert in das verzerrte Gesicht, was es ihr unmöglich machte, sich auf die Worte zu konzentrieren. Erst nachdem die Worte aus dem Gesicht des Fremden geflogen waren, machte sich der Sklave schüchtern an die Übersetzung. Der Junge ließ die Sätze so monoton verlauten, dass sie fast ihren Sinn verloren.
»Hat dir niemand beigebracht, in ganzen Sätzen zu antworten. Gib mir gefälligst eine vernünftige Antwort, wenn ich mit dir rede. Weißt du denn nicht, wer vor dir steht. Ich bin ein Gesandter des Königs und Mitglied der Königlichen Societät der Wissenschaften. Erzähl jetzt sofort, was du im Wald gemacht hast, oder ich werde dich auspeitschen lassen, dass dir hören und sehen vergeht.« Ife hörte mit gesenktem Blick zu. Jetzt bloß keine falsche Reaktion zeigen. Wenn Coba für sie in die Bresche gesprungen war, hatte sie eine Chance.
Ein brüllender Tiger reißt keine Beute, beruhigte sich Ife.
»Verzeihen Eure Hoheit.« Eure Hoheit sagte man doch zu Königen? Ife hatte trotz der Hilfe des Sklaven nicht verstanden, was der Fremde nun mit einem König zu tun hatte. Ife sprach sanft, wie um ein Kind zu besänftigen. »Ich werde versuchen, alle Eure Fragen zu Eurer Zufriedenheit zu beantworten. Es stimmt, dass ich mit meiner Lehrerin Coba im Wald war. Sie sehen, Coba ist nicht mehr so gut zu Fuß, und ich bin vorgelaufen, wir brauchten die Rinde von Quina, denn das Fieber verbreitet sich gerade wieder. Ich lief in die Richtung, wo die Bäume gestanden hatten, doch ich konnte sie nicht mehr finden. Plötzlich war alles fremd und ich rief nach Coba, aber ich bekam keine Antwort. Da bekam ich es mit der Angst, und ich begann zurück zur Plantage zu laufen, aber ich muss wohl in die falsche Richtung gegangen sein, denn nach Stunden hatte ich die Plantage immer noch nicht erreicht. Die Dunkelheit brach herein und ich musste dort auf der Stelle auf dem Boden zusammengerollt übernachten. Was glauben Sie, was ich für eine Angst vor den wilden Tieren hatte! Aber es half ja nichts, ich musste nun mutterseelenallein dort draußen im Wald schlafen. Auch am nächsten Tag fand ich den Weg nicht. So ging das Tag um Tag, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich dort draußen herumgeirrt bin.«
Mitleid zeigte sich nicht auf dem Gesicht der fremden Hoheit, eher eine Spur von Ungeduld.
»Wovon hast du dich ernährt?«
»Von Früchten und Wurzeln, Eure Hoheit. Einmal habe ich mir auch gehörig den Magen verdorben, mir war zwei Tage lang übel und ich konnte keinen Schritt mehr gehen. Es hätte nicht viel gefehlt und ich wäre dort draußen verreckt.«
Er musterte sie, sein Blick verriet, dass er nicht gerade erpicht auf Schilderungen ihres Elends war. Dann spürte Ife, wie sein Blick auf den Rundungen ihrer Brüste hängenblieb. »So schlecht siehst du eigentlich gar nicht aus«, murmelte er. »Hast du dort draußen Menschen getroffen? Indianer? Entlaufene Sklaven?«
Ife schüttelte langsam und nachdrücklich den Kopf.
Wieder lief der Fremde rot an und brüllte diesmal Coba an. Der Junge, der nicht genau wusste, wem die Rede galt, übersetzte weiter.
»Recht hast du, die Wahrheit sagt deine junge Freundin nicht. Schamlose Lügengeschichten sind das. Ihr steckt doch alle unter einer Decke! Will da draußen alleine überlebt haben, ohne einer Menschenseele begegnet zu sein! Das glaubt doch kein Mensch. Die Plantagenaufseher werden schon wissen, was mit ihr zu tun ist, ich will mich jedenfalls nicht länger mit ihr befassen.«
»Mister, Sie wollten doch das Bündel sehen, das die Sklavin bei sich hat?«, meldete sich Coba ungefragt zu Wort.
Mürrisch streckte der Fremde die Hand aus. Nichts half, sie musste ihm die zusammengebundenen Blätter überlassen.
Der Fremde legte das Bündel auf den Waldboden und entknotete es mit der größten Vorsicht. Seine Finger, unglaublich lang und schmal mit knubbeligen Gelenken, beschäftigten sich ruhig mit den faserigen Schnüren, die mit der Machete viel leichter zu durchtrennen gewesen wären. Dann löste er die Blätter sorgfältig voneinander und breitete sie vor sich auf dem Boden aus. Die beiden Palmwedel von Prasara und Awarra hatten zwei große, glatte und herzförmige Blätter freigegeben, dazwischen wiederum hatte sich ein Mimosenzweig zu einem nahezu unkenntlichen Häufchen gefaltet. Der Stock, den Ife im Inneren des Bündels gespürt hatte, war ein Stück vertrocknete Liane, genauer betrachtet drei Lianen, die sich kunstvoll umeinander geschlungen hatten und eins geworden waren. Der Fremde stand etwas ratlos vor dieser Sammlung und schüttelte unwillig den Kopf. Etwas schien ihm an den Pflanzen zu missfallen.
»Willst du mir nun erklären, was es mit diesen Pflanzen auf sich hat?«, ließ er Ife fragen.
Ife war froh, dass sie, abgesehen von dem Lianenstück, die mitgebrachten Pflanzen erkannte.
»Die da nennen wir Awarra. Aus ihren Blättern lassen sich sehr gute und feste Schnüre machen. Außerdem hat sie recht nahrhafte Früchte.«
»Aber du hast nur ein Blatt bei dir? Außerdem hast du gesagt, du brächtest Medizin.«
Ife dachte nach. Sie wusste beim besten Willen nicht, welchen weiteren Nutzen das Blatt haben sollte. Sie hatte schon die Wurzeln und die schwarzen Samen im Inneren der orangefarbenen Früchte benutzt, aber niemals die Blätter. Der Mann hat keine Ahnung, erzähl ihm irgendwas, rüttelte sie eine innere Stimme wach.
»Wir machen ein Bad daraus, mit dem wir die neugeborenen Kinder abreiben, damit sie keine offenen Wunden auf der Haut kriegen«, behauptete sie.
»Hm. Und weiter? Was ist mit der anderen Spezies der Palmaceae?«
Der Übersetzer stolperte fast über die Worte, und auch Ife wusste nicht, wovon der Weiße redete.
Sie starrte ihn verständnislos an.
»Die andere Palme!«, rief er ungeduldig.
»Ach so. Sie heißt Prasara. Man kann sie für sehr viele Sachen verwenden. Ihre Früchte essen wir auch manchmal. Man kann auch ihr Herz essen.« Wenn man auf die gefällte Palme pinkelte und dann einige Tage wartete, kamen schmackhafte dicke Maden, dachte Ife noch, aber sie wusste schon, dass die Leute auf der Plantage nichts mit dem Genuss von Maden anfangen konnten. Für Prasara fielen ihr noch mehr Verwendungen ein als für Awarra, doch wieder keine einzige, bei der die Blätter gebraucht wurden. Sie hatte auch gehört, dass sich mit einem kalten Aufguss aus der Rinde ein ungewolltes Kind in die Welt der Yorka schicken ließ. Aber das würde sie dem Weißen bestimmt nicht verraten.
»Und? Du hast wieder nur ein Blatt mitgebracht. Wirst du jetzt endlich aufhören, mich zum Besten zu halten!«
Er sprach jetzt schneller und lauter, wobei seine Stimme am Ende der Sätze fast kippte.
»Ich hatte sie geschickt, Mister«, ging Coba dazwischen. »Ich hatte ihr aufgetragen, diese Pflanzen zu bringen. Dieses Blatt hier ist überhaupt keine Medizin. Sie hätte es auch nicht die ganze Zeit mit sich herumtragen müssen, es zeigt nur, was sie für eine gehorsame Schülerin ist. Ich wollte es nur haben, um daraus einen Besen zu machen, um die Krankenbaracke zu fegen. Sie hätte es einfach auf dem Rückweg mitbringen können.«
Dem fremden Mister war anzusehen, dass er ihr nicht glaubte. Trotzdem beruhigte er sich nun etwas und forderte Coba auf, ihm die restlichen Pflanzen zu erklären.
»Aya tete wird gekocht, und man trinkt den Tee gegen Wunden im Mund«, erklärte Coba die herzförmigen Blätter. Wie fahl ihr Gesicht ist, dachte Ife. Seltsamerweise wurde ihr Gesicht bei der Betrachtung der Pflanzen immer blasser. Irgendetwas beunruhigte sie. Ob sie wusste, von wem sie kommen?
»Ein Tee aus Mimosenblättern bringt die Patienten zum Schwitzen«, kommentierte Coba weiter. »Manche Krankheiten verlassen mit dem Schweiß den Körper.«
»Und was soll das da?« Der Mister deutete auf die ineinander verschlungenen Lianen.
»Ich weiß es nicht«, entgegnete Coba mit tonloser Stimme.
Ife konnte sich nicht vorstellen, dass Coba es wirklich nicht wusste. Aber wenn sie es ihm nicht sagen wollte, warum dachte sie sich nicht einfach etwas aus?
»Eure Pflanzen sind komplett nutzlos! Ohne Blüten lassen sie sich nicht klassifizieren. Und ein Stück Holz ohne Blätter, von dem ihr selber nicht wisst, wozu es gut ist, dass ich nicht lache! Und da soll eine tagelang durch den Wald geirrt sein, um diesen Plunder zu sammeln.«
»Mister, ich weiß, ich bin nur eine kleine Sklavin, aber vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein. Sehen Sie, Coba war mir stets eine gute Lehrerin, und ich sehe, dass sie Ihnen den Weg weist zu den Quellen unserer Medizin. Coba ist alt und nicht mehr gut zu Fuß. Ich könnte Ihnen viel schneller und einfacher die Pflanzen bringen, die Sie benötigen, dort stehen sie mit Blättern und Blüten und Wurzeln, was auch immer Sie für Ihre eigene Medizin benötigen.«
Der Fremde rümpfte die Nase. »Medizin würde ich die Tätigkeit von euch Kräuterweiblein nicht gerade nennen. Außerdem geht es nicht um die Medizin, es geht um reine Wissenschaft.«
»Sie dürfen nicht so hart zu ihr sein«, mischte sich nun wieder Coba ein, »sie ist nur eine junge Sklavin. Niemand hat sie je zur Schule geschickt, von Wissenschaft hat sie nie etwas gehört.«
»Für ihr bescheidenes Dasein erscheint sie mir aber ganz schön dreist zu lügen. Wenn sie sich halb so gut auskennen würde, wie sie behauptet, hätte sie sich wohl kaum im Wald verlaufen und giftige Wurzeln genossen.«
»Sie urteilen zu schnell. Haben Sie schon einmal versucht, alleine in den Tiefen dieses Waldes zu überleben? Margaret steht hier lebendig vor Ihnen, ist das kein Zeugnis ihres scharfen Verstandes?«
»Wir müssen sie trotzdem auf der Plantage abliefern«, entschied der Mister. »Ich kann nicht weiterarbeiten, solange George mit ihr die Hände gebunden sind. George, pass du auf sie auf, dass sie nicht wieder in den Wald entwischt.«
Die alte Coba musste vorausgehen, die anderen folgten im Gänsemarsch. Zuerst der Weiße, dem die alte Frau nur bis kurz über den Bauch reichte, dann Ife, die froh war, dass so niemand die Ängste in ihrem Gesicht lesen konnte, und zuletzt George, der ihr zusätzlich einen Schauer in den Rücken jagte. Wenn sie nur ein paar Worte mit Coba im Vertrauen wechseln könnte.
Bald schon hörten sie den Bach, der die Grenze zwischen Wald und Ackerland markierte. Beim Anblick des Wassers, auf dem die Sonne unruhige Muster zeichnete, musste Ife an das Yorka ihres Kindes denken, das sie hier vor gar nicht langer Zeit verlassen hatte. Ob es noch manchmal hierher kam, um sich den Platz anzusehen, an dem es nie leben sollte? Ob es dann froh war, dass Ife es zurück in die Arme seiner Dyodyo geschickt hatte? Ob die Dyodyo einen besseren Ort finden würden, wohin sie es wieder als Kra schicken konnten?
Über dem Wasser spielten zwei blaue Schmetterlinge, als wäre seit jenem Tag keine Zeit vergangen, als wäre Ife nie fortgewesen. Das Lichtspiel auf dem Wasser wurde von einem pferdeförmigen Schatten unterbrochen.
Der Reiter grüßte den Weißen, den man eigentlich Roten nennen sollte, mit einem Handzeichen und nahm keine weitere Notiz von seiner Begleitung.
Sie wateten durch das knietiefe Wasser und bald schon sah Ife die Wellenbewegung der Frauenrücken auf dem abgeernteten Feld, wie sie ihre Hacken hoch in die Luft schwangen und auf den lehmigen Boden herabsausen ließen. Der Wind trug leise Fetzen ihres Gesangs heran, der von ihrem schweren Atem zerstückelt wurde. Auch wenn Ife wusste, wie hart es war, wochenlang Löcher für die frischen Zuckerrohrsetzlinge aufzureißen, wo der Regen den Boden fest verbacken hatte, weckte der Anblick der Frauen in Ife doch für einen Moment den Wunsch, eine von ihnen zu sein.
Eine Taube umkreiste das Türmchen des zweistöckigen weißen Holzhauses, in dem der Mister und die Missus wohnten, um dann in seiner Fensteröffnung zu landen und einsam Wache über die Anlage zu halten. Der Wachturm schien für niemanden gebaut zu sein außer die Vögel, die sich dort gerne zu einer kleinen Pause niederließen. Die weißen Fensterläden im ersten Stock waren verschlossen. Zum Haus hinauf führte eine fünfstufige Treppe, die auf eine Veranda mündete. An der Treppe und dem Geländer der Veranda blätterte schon die Farbe ab, das Holz färbte sich grau bis grün, der Moder kroch von unten in das Gebäude. Die Treppe hatte Ife nie betreten, niemals hatte sie den verschnörkelten Giebel passiert, der die Verandatür schmückte. Dies war der Eingang für den Mister und die Missus und ihre Gäste. Doch benutzten selbst die Herrschaften diesen Eingang nur, wenn sie ihre guten Kleider trugen, die Missus die Röcke angelegt hatte, die ihre zierliche Hüfte auf ihre dreifache Breite anwachsen ließen. Ein verwaister Schaukelstuhl auf der Veranda vermoderte in der feuchten Luft. Auf der schmucklosen Rückseite gab es einen weiteren Eingang für die Sklaven. Ife war als Kind regelmäßig durch diese Tür gegangen, beladen mit schweren Wäschekörben, die in ihrer Erinnerung so groß waren wie sie selbst, mit Wassereimern für die Küche und für den Hausputz, mit verführerisch rauchigem Speck aus der Vorratskammer, mit einem Krug Melasse oder Rum, kurzum mit allem, worum man ein Kind schicken konnte.
Die Missus hatte sich eine Zeit lang in den Kopf gesetzt, Ife zur Haussklavin heranzuziehen, aber sei es ihr Gang, wenn Ife heimlich Indianerin spielte, sei es das Muskelspiel ihrer immer drahtiger werdenden Arme, irgendetwas hatte am Ende den Mister bewogen, Ife aus dem Haus zu verbannen und zu den Feldgangs zu schicken.
Während das weiße Haus sich totenstill der Welt verschloss, feierten die knallroten Blüten der Drillingsblumen vor dem Haus, umschwirrt von dicken Hummeln und Fliegen, ein Fest des Lebens. Doch bei genauerem Hinsehen waren sie merkwürdig in Reih und Glied gepfercht, standen Spalier hinter einer niedrigen Hecke, die den Hauptweg zum Haus begrenzte. Ife scheute diesen Weg wie die Treppe, derer ihrer Füße nicht würdig waren, aber der Fremde schien genau darauf zuzusteuern. Ife hatte Angst, dass sich plötzlich die Tür unter dem Schnörkelgiebel öffnen könnte und die Gestalt des Mister oder der Missus hinaustreten könnte. Wahrscheinlicher war es, dass die Missus durch die Lamellen der Fensterläden im ersten Stock hinaus in die Welt spähte, während sie ihrem Mann und ihren Sklavinnen gegenüber eine Migräne vorschützte. Ob sie die Welt wahrnahm, wenn sie von ihrem einsamen Reich den Blick ins Grün der Plantage schweifen ließ, konnte man nicht sagen. Vielleicht träumte sie sich auch fort, in eine Heimat, von der sie Ife als Kind oft hatte schwärmen hören, die sich Ife jedoch nie hatte vorstellen können.
Der fremde Mister tat ihnen den Gefallen, nicht in den Hauptweg zum Haus zu einzubiegen, stattdessen näherten sie sich nun dem Wirtschaftskomplex, in dessen Mitte die Siederei und das Lagerhaus zum Trocknen des Zuckers standen. Direkt neben dem Lagerhaus wohnte der Aufseher Pieter, der streng über den Reichtum der Plantage wachte. Einmal mehr stockte Ife das Herz im Hals. Wollte der Fremde sie nun nicht der Gerichtsbarkeit des Misters überantworten, sondern sie gleich dem schlimmsten Folterknecht überlassen?
Umso mehr staunte Ife, als sie die Hütte betraten. Es war ein einfaches Holzhaus, kleiner als die Sklavenunterkünfte, aber solider gebaut. Auf der einen Seite stand ein Tisch, auf dem eine Reihe merkwürdiger Gegenstände lagen, Werkzeuge, die viel zu filigran wirkten, um damit auf dem Feld zu arbeiten oder ein Haus zu errichten. Der Platz unter dem Dach war vollgestellt mit Körben und Kisten, Bücher türmten sich zu einem riesigen Stapel, doch das Seltsamste waren die Gläser, in denen Schlangen reglos im Wasser lagen. Ife hatte das Gefühl, die Hütte eines Schamanen zu betreten. Was hatte dieser hässliche Mann mit ihnen vor? Konnten ihre Winti sie gegen seine unbekannte Magie beschützen?
Der fremde Mister legte Ifes unfreiwillige Gaben auf den Tisch neben die glänzenden Utensilien. Dann zog er ein dickes, ledergebundenes Buch aus dem Stapel hervor. Er blätterte durch die Seiten, auf denen Blätter, Blüten und ganze Pflanzen aufgemalt waren. An den Seitenrändern lehnten sich spitze, handgeschriebene Buchstaben gleichmäßig zur rechten Seite. Ife hatte noch nie ein solches Buch gesehen.
Sie hatte die Missus manchmal in einem Buch lesen sehen. Meistens in einem schweren und in dunkles Leder gebundenen, auf dessen Vorderseite ein goldenes Kreuz prangte. »Die heilige Bibel«, hieß es, in dem es nur eine dichte Folge schnörkeliger Buchstaben, aber keine Bilder gab. Die Bibel, das hatte die Missus ihr erklärt, war die Geschichte von ihrem Gott und seinem Sohn, der in die Welt kam und von den bösen Menschen ermordet wurde. Aber nicht nur das, es war die Geschichte der ganzen Menschheit, wie Gott sie geschaffen und aus dem Paradies vertrieben hatte. Ife hatte sie gefragt, ob es in dem Paradies auch Sklaven gegeben habe. Die Missus war bei der Frage erschrocken. Natürlich konnte es im Paradies, dort, wo es kein Leiden gab, auch keine Sklaven geben. Aber sie musste in dem Moment bemerkt haben, dass es in ihrem Paradies auch keine Neger gab.
Die Missus las nicht nur in ihrer heiligen Bibel, sie liebte auch die Geschichten anderer Menschen, und wenn sie gut gelaunt war, las sie Ife etwas vor. Sie las wahllos die Stelle, an der sie selbst gerade war, ohne zu erklären, was vorher geschehen war. Da gab es die Geschichte eines gewissen Robinson, der alleine auf einer Insel in der Mündung des Orinoko lebte und sich gegen Kannibalen verteidigen musste. Außerdem liebte die Missus die Geschichte eines einfachen Dienstmädchens, das Pamela hieß und in einem englischen Haushalt lebte. Wenn die Missus in dem Buch las, rollten ihr manchmal Tränen über die Wangen. Ife konnte nie verstehen, warum die Missus mit dem Dienstmädchen, das in der Geschichte schlecht behandelt wurde, mitfühlte, schließlich würde sie selbst niemals so leben müssen. Es wunderte Ife noch mehr, dass ein schriftkundiger Engländer sich die Mühe gemacht hatte, diese unbedeutende Geschichte mit so vielen Worten niederzuschreiben.
Der Fremde hatte Ifes Pflanzen auf dem Tisch ausgebreitet und verglich sie mit den Bildern in seinem Buch. Ganz so nutzlos konnten sie also nicht sein. Er zupfte ein Blatt von der Mimose und legte es unter eine goldschimmernde Röhre. Dann hielt er sein rechtes Auge an das obere Ende, während er das linke Auge angestrengt zusammenkniff. Seine Hand drehte dabei an einem Rad an der Seite der goldenen Röhre. Beim besten Willen konnte sich Ife nicht vorstellen, was dieser Apparat mit dem Blatt machte. Als der Fremde das Blatt wieder hervorzog, sah es genauso aus wie vorher. Auch er schien mit dem Ergebnis nicht zufrieden zu sein. Er blätterte weiter in seinem Buch und winkte Ife, die ihm ohnehin gebannt über die Schulter schaute, zu sich heran. »Sieht die Blüte ungefähr so aus?« Er zeigte auf ein Bild, auf dem, nicht miteinander verbunden, die zart gefiederten Blätter der Mimose und ihre kugeligen Blüten gemalt waren. Jedenfalls glaubte Ife, dass es sich um eine Mimose handeln sollte.
»Ich glaube ja. Sie hat nicht geblüht, als ich den Zweig gepflückt habe.«
»Aber du hast zuvor schon Mimosen blühen sehen. Und sahen die dann so aus?«
Ife nickte. Sie sahen nicht so aus. Ihre Blüten waren von leuchtendem oder blassem Rosa. Wenn sie von der Mittagshitze müde waren, sahen sie ganz zerzaust aus. Das dort waren nur ein paar Striche auf einem Blatt Papier.
»Ich gehe davon aus, dass es Mimosa pudica ist, die Linnaeus ja schon beschrieben hat. Ich werde gleich vermerken, dass sie auch in Guyana vorkommt.« Er sprach wohl zu sich selbst, aber sein Sklave übersetzte wie ein zuverlässiger Papagei.
»Diese Palme, wie sagst du, nennt ihr sie?«, wandte er sich wieder an Ife.
»Prasara.«
Er zeigte auf ein Bild in seinem Buch. »Ist es die hier?«
Ife fand, dass die Zeichnung noch weniger mit Prasara zu tun hatte, als die vorherige mit der Mimose. Es gab so viele Palmen, wie sollte sie sagen, ob es Prasara war, wenn sie nicht gegen den Stamm klopfen konnte, wenn sie das Rascheln der Blätter nicht hörte, das Grün sich nicht auf der Zunge zergehen lassen konnte? Instinktiv wusste Ife, dass er mit ihrer Antwort nicht zufrieden sein würde, dass sie den Baum im Wald vor sich haben musste. Sie wollte ihn aber zufriedenstellen, also sagte sie einfach: »Ja.«
»Nun, wir werden wohl ihre Blüten in Augenschein nehmen müssen. Kannst du mir ihre Blüte beschreiben?«
»Nein Mister, sie sind wohl recht klein. Wir sammeln wie gesagt alles Mögliche, die Früchte, die Blätter, die Rinde, wir essen auch manchmal ihr Herz, aber mit den Blüten kann niemand etwas anfangen.«
»Gut, du wirst mich dahin führen, wo diese Palme steht, und du wirst mir noch viele andere Dinge zeigen. Quina, sagtest du, hättest du gesucht. Wieso hast du keines mitgebracht? Ist es in dieser Gegend so selten?«
»Wir müssen immer tiefer in den Wald gehen. Es ist, als wollten sich die Bäume vor uns verstecken. Die, deren Rinde wir letztes Jahr geschnitten haben, sind verschwunden. Dabei haben wir immer nur ein Stück von einer Seite genommen, damit der Baum nicht an seiner Verletzung stirbt. Es ist als würden sie sich vor den Plantagen erschrecken, als würde der Anblick des Zuckerrohrs ihnen sagen, dass sie längst nicht mehr im Wald stünden.«
»Wenn es nur gelänge, ihre Sämlinge zu finden und sicher über den Ozean zu bringen …« Der Europäer murmelte mehr vor sich hin, als dass er zu den Anwesenden sprach. »Vielleicht könnten sie in einer Orangerie gedeihen. Die Apotheker würden mir die Quinarinde aus den Händen reißen. Ja, es wäre etwas, was die Leute vom Sinn der Expedition überzeugen würde. Auch wenn sie keine Ahnung haben.«
George übersetzte zwar die Worte des Mannes, doch so recht begreifen wollte Ife nicht.
Coba, die die ganze Zeit über geschwiegen hatte, bedachte ihn mit einem halb missbilligenden, halb erstaunten Blick. »Man kann einen Baum des Waldes nicht verpflanzen, Mister, er kann nur dort wachsen, wo sein Same zu Boden fällt. Der Kräuter und des Zuckerrohrs, derer nimmt sich die fremde Erde an, aber ein Baum will sich von anderen Bäumen umschmeichelt wissen. Aber ich bitte Sie, mir eine Sache zu sagen: Werden die Menschen in Ihrer Heimat nicht vom wechselhaften Fieber gequält?«
»Doch, das Fieber steigt auch in Europa aus manch fauligem Sumpf auf. Aber in den Tropen ist es weit verbreiteter als in den nordischen Lüften. Aber wer es einmal in sich trägt, bringt es mit von seiner Reise. Das Verpflanzen der Bäume lass getrost meine Sache sein, es ist schon anderen, weniger geschickten Botanikern gelungen. Aber ob sie mir den Export von Quina genehmigen würden?« Den letzten Satz sprach er wieder zu sich, warf dann einen sehnsüchtigen Blick hinaus.
»Wir müssen von dieser Plantage weg, sie birgt nur Monotonie und Dummheit. Da draußen liegt ein Reichtum an Pflanzen, der nur auf den ersten Blick unbeschreibbar ist. Wir müssen nun bald die Expedition zusammenstellen. Wir brauchen Indios, die uns über die Flüsse navigieren und uns den Weg durch den Wald weisen. Oder wir brauchen ein paar Mann von diesen Entlaufenen, diesen Buschnegern, die zwar ungebildet sind, aber sich doch in dieser Wildnis nach den Indios am besten auskennen. Wie gerne möchte ich in dieses Gebirge vordringen, diese unglaublichen Plateaus sehen, von denen La Condamine berichtet hat.« Die drei Sklaven standen etwas ratlos um seinen Tisch herum. Wen mochte er nur mit »wir« meinen?
Alle vier harrten eine ganze Weile schweigend aus. Ife schickte hilfesuchende Blicke zu Coba, deren Gesicht jedoch eine geschnitzte Maske war, die keinen Gedanken an die Oberfläche ließ. Coba, bitte erklär mir, was hier los ist, Coba, bitte führe mich an einen Ort, wo wir alleine sein können und ich dir von Adjoa und den anderen Waldleuten erzählen kann. Lass mich dir Adjoas Botschaft verkünden, auf dass ich wieder in diesem Wald verschwinden kann, für immer diesmal, solange immer auch währen mag.
»Wir müssen sie abliefern«, sagte der Mister schließlich zu George. Dann wandte er sich an Coba: »Ich brauche dich heute nicht mehr. Du kannst gehen.«
Nein, schrie Ife innerlich auf, du kannst sie nicht fortschicken, meine einzige Beschützerin, nicht bei dem, was mich erwartet.
Coba sagte nichts, sondern ging ohne einen Blick zurück langsamen Schritts aus der Hütte. Ife war erstaunt, wie sehr ihre Beine über den Boden schleiften. Ob es an dem lag, was sie Coba angetan hatten?
Wieder umklammerte George Ifes Arm, wieder gingen sie auf das weiße Herrenhaus zu, doch diesmal tat ihr der Mister nicht den Gefallen, daran vorbei zu laufen. Stattdessen nahm er die Treppe auf die hölzerne Veranda, die unter den ungewohnten Tritten ein hohes Quietschen von sich gab. Er bedeutete George, mit Ife am Fuß der Treppe zu warten. Ein schwarzes Mädchen öffnete die Tür einen Spalt breit, sah den Rotgesichtigen und winkte ihn ins Haus.
War nun nicht die Gelegenheit, sich mit George zu verbünden und zu laufen, so schnell die Beine sie tragen konnten? Komm, würde Ife ihm sagen, ich weiß, wo wir in Freiheit leben können, komm, diese Gelegenheit bietet sich nicht wieder. Doch sie vertraute George nicht, sein Klammergriff war auch in der Abwesenheit des Misters zu fest, seine Augen waren mitleidlos geblieben, seit sie ihm über den Weg gelaufen war. Ife beschloss zu schweigen und auf ihr Schicksal zu warten.
Stimmen drangen aus dem geöffneten Fenster, die des Misters, des fremden Misters und später noch eine dritte, die Ife als Pieters erkannte, und ihr Magen zog sich krampfartig zusammen.
»Ich kann sie nicht ungestraft lassen«, hörte sie den Mister sagen, »schon allein aus Prinzip. Wenn die anderen mitbekommen, dass sie zurückgekehrt ist, und es ihr gutgeht, kommen sie auf dumme Ideen. Schlimmer noch, wenn sie ihnen den Weg zu den Cimarrones verrät.«
»Einen guten Preis zahlen«, glaubte Ife aus den Worten des anderen auszumachen. Es wurden Zahlen ausgetauscht, dann beendete der Mister den Handel mit: »Gut, so soll es sein. Sie können sie morgen haben. Doch nur unter zwei Bedingungen: Sie muss öffentlich bestraft werden und sie darf kein Wort mehr mit den anderen Sklaven reden. Auch nicht mit der Alten. Sollte sie reden, muss ich ihr die Zunge herausschneiden.«
Der fremde Mister protestierte, sagte etwas von »brauchbar bleiben« und »sonst kein Geld«.
»Pieter, hast du verstanden, was zu tun ist?«, fragte der Mister in den Raum.
Mochten ihre Winti ihr beistehen.
Alles schmerzte. Sie konnte nicht stehen, aber auch auf keiner Seite ihres Körpers liegen, als ihr Peiniger sie zu Füßen des Misters warf. In ihren Ohren war nichts als Rauschen, der Mister und Pieter bewegten dazu stumm die Lippen. Sie schloss die Augen, denn sie mochte nicht länger die Stiefel des Misters betrachten.
Dann drang auf einmal die wütende Stimme des Fremden an ihr Ohr. Er beugte sich über sie, hob einen ihrer Arme an und ließ ihn wieder fallen. Der Arm war ein lebloser Gegenstand, der nicht zu Ife gehörte. Er schimpfte weiter, sagte wohl, dass er betrogen worden war. Dann hob jemand Ife auf seine Schultern und trug sie unter heftigem Schnaufen fort. Es war George, der Sklave des Fremden. Er brachte sie zu der Hütte mit den seltsamen Gerätschaften und den schweren Büchern. Jemand hatte eine Strohmatte zwischen die Utensilien gelegt, auf die der Junge Ife nun ablegte.
»Coba wird gleich kommen und dich versorgen«, sagte er nur. Es waren die ersten Worte, die er direkt an Ife richtete. Coba, aber ich darf doch nicht mit ihr reden, dachte Ife noch, dann versank sie in den Schlaf, die einzige Flucht, die ihr blieb.
Sie erwachte von einer feuchten Berührung. Coba war im Schein eines Talglichts über sie gebeugt und versorgte die schlimmsten Wunden mit Umschlägen aus feuchten Blättern.
»Coba, ich muss fantasieren«, flüsterte Ife, »eine Leiche ist es nicht wert, ihre Wunden zu versorgen.« Sie stöhnte und schloss die Augen, doch aus dem Dunkel kam Cobas raue Stimme.
»Der Schwede hat dich retten lassen. Er war sehr böse über deinen Zustand. Du sollst ihn auf seiner Expedition in den Wald begleiten, es hat ihn beeindruckt, dass du dort drei Wochen überlebt hast. Er möchte bald losgehen, deswegen soll ich dich so schnell wie möglich wiederherstellen, obwohl der Mister verboten hat, dass wir miteinander reden. Aber der Schwede hat gesagt, wenn ich dich nicht behandeln dürfte, dann würde er den vereinbarten Preis nicht zahlen. Der Mister hat eingewilligt, denn er hat Angst, du würdest die anderen aufwiegeln, wenn du hierbleibst.«
»Ich habe im Wald eine Frau getroffen, die Adjoa heißt«, sagte Ife. »Sie ist sehr stark und sieht jünger aus als du. Ihr Gesicht ist wie poliertes Holz. Sie war es, die mich mit den Blättern zu dir geschickt hat.«
Coba legte schweigend weitere Umschläge auf Ifes Körper. Sie presste fest die Lippen aufeinander, doch sie konnte nicht verhindern, dass es um ihren ganzen Mund zuckte.
»Was ist? Freust du dich nicht, dass deine Schwester am Leben ist?«
»Das Miststück! Nur um mir ein paar Pflanzen zu schicken, bringt sie dein Leben in Gefahr? Wenn sie mir etwas zu sagen hat, hätte sie selber kommen müssen.«
»Sie hat mich nicht nur deswegen geschickt, ich sollte auch herausfinden, ob Sugar Creek in den Wald hinein wächst, und ob Soldaten hier Quartier bezogen haben. Die Freien sagen, dass es Krieg geben wird.«
»Auch das ist kein Grund, die Unerfahrenste zu schicken.«
»Ich habe ihr gesagt, dass du bestimmt froh wärst, von ihr zu hören.«
»Damit sie mir sagt, dass sie nie wieder etwas mit mir zu tun haben will? Es ging mir besser, als ich sie für tot hielt. Sie hat mir nie verziehen, dass ich nicht mit ihr fortgegangen bin. Dabei bin ich hiergeblieben, um nicht in ihrer Nähe leben zu müssen. Ich bin hier auf der Plantage freier als in ihrer Nähe. Wäre ich bei ihr geblieben, hätten wir unser ganzes Leben miteinander kämpfen müssen. Und nun das.«
»Nun was?«
»Das Rezept, das sie mir schickt. Hat sie dir nicht gesagt, wofür es gut ist?«
»Nein, sie sagte, das wäre etwas zwischen euch. Ich dachte, es wäre eine Art geheime Botschaft.«
»Ja«, Coba lachte kurz und trocken, »es ist die Aufforderung, unsere Familienbande für immer zu lösen. Als wären wir nicht zusammen übers Meer hierher gekommen, als hätten wir nicht zusammen um die Schwestern getrauert. Habe ich dir wirklich nie von Daai tete erzählt?«
Ife schüttelte den Kopf.
»Daai tete ist dazu da, die Verbindung zwischen zwei Menschen zu lösen. Aus den Blättern bereitet man ein Bad. Nach dem Bad muss die Person, die sich lösen will, die Daai tete aus ihrer Verflechtung lösen.«
»Aber dann hätte sie doch die Daai tete entflechten müssen.«
»Anscheinend war sie nicht stark genug. Jetzt soll ich ihr helfen, weil ihr Gewissen zurückgekommen ist, um sie zu quälen. Und weil sie weiß, dass sie mir damit wehtun kann.«
»Warum hast du nie von ihr und den anderen Schwestern erzählt?«
Coba drehte ihre Augen zur Seite, sodass Ife nur das Weiß in dem schwachen Licht schimmern sah.
»Es gibt Dinge, über die ist es besser nicht zu sprechen. Adjoa hat dir also nicht mehr erzählt. Nur Adjoa und ich sind hierher verschleppt worden. Die anderen Schwestern habe ich nie wieder gesehen. Wir beide haben es nicht geschafft, uns gegenseitig Trost zu geben. Wir waren verzweifelt und wütend, aber Adjoa wollte bis zum Äußersten kämpfen und ich wollte überleben und auf eine bessere Gelegenheit warten. Obwohl wir das gleiche Wissen teilten, konnten wir uns nicht einigen, was wir in dieser neuen Welt mit unserem Wissen tun sollten. Adjoa war dafür, alle zu vergiften, auch uns selbst. Aber ich wollte noch leben. Ich fing an, Angst vor ihr zu haben. Jedenfalls konnten wir nicht zusammen leben. Ich war so froh, als sie mir von ihrem Fluchtplan erzählte.«
»Warum wollte sie dann, dass du mit ihr gehst?«
»Hast du nicht gemerkt, dass Adjoa die absolute Macht haben muss?«
Sie hatte die Blicke bemerkt, mit denen Juba und Adjoa sich maßen. Die Strenge, mit der Juba beobachtete, wie Adjoa mit Ife umging. Adjoas Art, diejenigen warten zu lassen, die etwas von ihr wollten. Auch Juba, die Königin. Eigentlich war sie die Prinzessin, die auf den Tod der Königin wartete. Aber Adjoa wollte nicht loslassen.
»Sandquist, dein neuer Mister, ahnt, dass du im Wald nicht alleine gelebt hast. Er wird von dir erwarten, dass du ihm auf seiner Expedition dort Verbündete suchst. Doch die Waldleute verbünden sich nicht gerne mit jemandem, schon gar nicht mit dahergelaufenen Weißen. Das Beste wird daher sein, du gehst den Freien aus dem Weg«, wechselte Coba das Thema. Sie war fertig mit den Umschlägen, kurz drückte sie ihre spröden Lippen auf Ifes Stirn.
»Wenn du Adjoa noch einmal siehst, dann sag ihr, dass sie aufhören soll, auf mich zu warten, die Winti haben nicht gewollt, dass wir Schwestern sind«, flüsterte sie noch, dann löschte sie das Talglicht und verschwand in der Dunkelheit.
Während Ife auf ihrem Lager ihre Wunden verheilen ließ, war ihr neuer Herr mit Vorbereitungen beschäftigt. Es waren die sonderbarsten Reisevorbereitungen, die Ife jemals gesehen hatte. Da stapelte er neben Maniokmehl und Dörrfleisch auch Tee und Zucker, der nur die Ameisen anlocken würde. Neben dem Proviant trug der Herr allerlei Gerätschaften zusammen, Macheten, eine Flinte und jede Menge Röhrchen und Netze, seltsame Apparaturen aus Metall, die außer dem Herrn niemand zu bedienen verstand. Außerdem verbrachte der Herr viele Stunden am Tisch über seine Karten und Bücher gebeugt, machte Notizen, strich ungeduldig aus, schrieb hastig etwas Neues. Er saß häufig bis tief in die Nacht im Schein einer Talglampe. Manchmal starrte er nur auf das Papier vor ihm, ohne sich zu regen, manchmal raufte er sich die strohartigen Haare. Mit Ife sprach er nie. Nachts blieb sie alleine in der Hütte, und sobald sie nicht mehr ganz wie eine unbewegliche Mumie erschien, ließ der Herr sie von seinem anderen Sklaven mit den Füßen an einen Pfosten ketten. Sie ließ es über sich ergehen, wie sie derzeit ihre ganze seltsame Existenz über sich ergehen ließ.
Wo der andere Sklave schlief, wussten die Götter, und auch tagsüber war er zumeist mit Botengängen beschäftigt. Wieso sich der Europäer bei ihm keine Sorgen machte, dass er heimlich das Weite suchte, blieb Ife ein Rätsel. Umso mehr der Herr ihm vertraute, umso weniger konnte Ife ihm Vertrauen schenken. Doch er war der einzige, der ihr Informationen geben konnte. Wie gerne hätte sie ihn über den Fremden und sein Vorhaben ausgefragt, doch sie erwischte ihn nie alleine. Das Gespräch zwischen George und Ife beschränkte sich auf ein »Iss« und »Danke«, wenn er ihr eine Schale mit gekochtem Maniok oder Bananen hinstellte. Ihre Verpflegung war besser als im Sklavenquartier, und sie brauchte zum ersten Mal in ihrem Leben den ganzen Tag gar nichts tun. Sie hätte es genießen können, doch sie fühlte weder Freude darüber noch Ärger über den Verlust ihrer Freiheit.
Nach fünf Tagen richtete Sandquist erstmals das Wort an Ife. Sie fühlte sich erst gar nicht angesprochen, so sehr hatte sie sich daran gewöhnt, ein Stück sprachloses Inventar seiner Hütte zu sein. Noch immer fiel es ihr schwer, die Worte Sandquists zu verstehen, auch wenn sie wusste, dass sie Englisch sein sollten. Die Melodie stimmte einfach nicht. Ihre Stimme war Ife vom Schweigen ganz fremd geworden, als sie den Herrn bat, seine Worte zu wiederholen.
»Bist du jemals flussaufwärts gereist?«
»Nein Herr, ich kenne nur diesen Bach, der auf der anderen Seite der Plantage liegt.«
»Komm her!«, forderte er sie auf, an seinen Schreibtisch zu treten, auf dem ein großes Papier ausgebreitet lag. Dann bemerkte er, dass sie noch immer nicht aufstehen konnte, und kniete sich zu ihr auf den Boden. Auf dem Papier waren verschieden dicke, geschlängelte Linien gezogen, dazwischen verschieden große und in unterschiedlicher Richtung verlaufende Schriftzüge.
»Hier ist Sugar Creek«, sagte Sandquist und deutete mit seinem Finger auf einen leeren Fleck zwischen einer doppelten und einer einfachen Schlangenlinie. »Auf dieser Seite der Plantage liegt der Fluss. Hier legen die Boote an, die den Zucker zum Hafen bringen. Du wirst die Stelle wohl kennen. Wenn wir dieser Linie folgen, kommen wir hinauf in die Berge, zur Quelle. Bist du dir sicher, dass du niemals in diese Richtung gegangen bist?«
Ife schüttelte den Kopf. Die Landkarte verwirrte sie, die Entfernungen, die auf ein paar Fingerlängen schrumpften.
»Weißt du denn, wo das nächste Indianerdorf liegt?«, fragte Sandquist weiter.
»Es sind zwei Tagesreisen den Fluss hinauf. Wir haben manchmal den Medizinmann von dort gerufen. Ich bin aber nie dort gewesen.«
»Gut.« Sandquist machte ein zufriedenes Gesicht. »Wir werden dort Indianer für unsere Expedition finden.« Er rollte das Papier zusammen und setzte sich wortlos zurück an seinen Schreibtisch.
An dem Morgen, an dem Ife ihre Verbände ablegte, merkte sie, dass sie nicht nur eine Gefangene ihrer Wunden, sondern eine Gefangene dieser Hütte war. »Ich muss zum Bach, um die Salbe abzuwaschen«, flüsterte sie dem Sklaven zu. Er brachte ihr kurz darauf eine Schüssel mit sauberem Wasser. Der Herr kam nicht zurück, und so nutzte Ife die Gelegenheit, das Wort an ihn zu richten.
»Du heißt George, nicht wahr?«
»Ja.«
»Du bist nicht von hier, stimmt’s?«
»Nein, ich bin mit Sir Sandquist gekommen. Der Pater hat mich mit ihm mitgeschickt, weil er keine Indios hatte. Sir Sandquist wollte Indios für seine Expedition, aber die Indios waren alle wieder fortgelaufen. Jetzt ist er wieder losgeritten, um doch noch einen oder zwei von ihnen aufzutreiben.«
»Hat er dich gekauft?«
»Nein, ich gehöre nur Gott allein, hat mir der Pater gesagt.«
»Aber wieso bist du dann mitgegangen?«
»Der Pater sagte, ich könnte Gott einen Gefallen tun.«
»Welchem Gott?«
»Es gibt nur einen Gott, den Gott der Christen. Die heidnischen Götter sind nur falsche Götzenbilder.«
»Gehöre ich jetzt dem Mister Sandquist?«
»Ja. Er wollte dich erst leihen, immerhin ist er ja im Auftrag der Krone unterwegs, und, so denkt er, die Untertanen sind dem König einen Tribut schuldig. Also könntest du der Tribut deines alten Herrn vor dem König sein.«
»Aber der Mister hat das nicht eingesehen, nicht wahr?«
»Er hat gesagt, er ist Geschäftsmann, was die Könige im alten Europa trieben, würde ihn einen Dreck interessieren. Ja, genauso hat er es gesagt. Außerdem sollte ihm der werte Herr erst mal erklären, was ein Engländer in einer niederländischen Kolonie mit dem schwedischen König zu tun hätte. Die Wahrheit ist aber, dass er dich sowieso loswerden wollte. Du weißt, dass dir dein Herr sonst die Sehnen am Fuß zerschnitten hätte, damit du nicht mehr richtig laufen kannst?«
»Ich hatte gedacht, er würde mich aufhängen lassen. Du denkst also, ich habe Glück gehabt?«
»Sir Sandquist wird sehr schnell wütend, aber er will uns nichts Böses. Er interessiert sich nur für seine Pflanzen.«
»Mein Mister interessiert sich nur für seinen Zucker und sein Geld. Wir könnten auch sagen, er will uns nichts Böses.«
»Was bist du für ein besserwisserisches Weib! Du denkst, alle Weißen sind deine Feinde, nicht wahr? Überall gibt es Gute und Böse.«
»Ja, nur Sklaven sind schon böse, wenn sie nur eine Stange Zuckerrohr stehlen, und die Plantagenbesitzer sind immer noch nicht böse, wenn sie uns halb zu Tode prügeln lassen.«
»Ach, ich sollte mich gar nicht mit dir abgeben. Diese alte Hexe hat dir komische Sachen in den Kopf gesetzt. Du musst das Schicksal annehmen, das Gott dir beschieden hat, wie unser Herr Jesus es getan hat.«
»Den Herrn kenn ich nicht. Und nenn Coba nicht alte Hexe. Sie ist die weiseste Frau, die du auf dieser Plantage finden kannst.«
»Ich muss zurück an meine Arbeit«, sagte der Junge und drehte Ife den Rücken zu.
»Warte, noch eine Frage: Darf ich diese Hütte nicht mehr verlassen?«
»Erst wenn unsere Expedition losgeht. Sir Sandquist ist für einige Tage in die Stadt gefahren, um Besorgungen zu machen. So lange rührst du dich nicht vom Fleck. Dein alter Mister hat streng verboten, dass du mit den anderen Sklaven redest.«
Ife kauerte auf dem Boden und betrachtete die Risse im gestampften Lehm. Seltsam, sie war gefangen und privilegiert zugleich. Sollte sie nun nicht mal mehr ihre alte Freundin Coba zu Gesicht bekommen, weil sie dem Mister und Ife dem Sandquist gehörte? Und John? Niemals. Wahrscheinlich wusste er gar nicht, dass Ife hier war. Andererseits machten Gerüchte schnell die Runde.
Wenn Johanna hörte, dass Ife zurückgekehrt war, würde sie sich das Maul darüber zerreißen und dann wüsste es wirklich jeder auf der Plantage. Wie mochte es Azuka und Elisa gehen? Gehörten sie am Ende zu denen, die auch den Weg in die Wälder gewagt hatten? Diese quälende Ungewissheit, diese Trennung von der Welt, die direkt hinter den Brettern dieser Hütte lag. Ife spürte, wie das Gift des Selbstmitleids in ihre Glieder sickerte, sie wieder schwer machte. Sie streckte sich auf ihrer Strohmatte aus. Wenn doch wenigstens der Fremde zurückkommen würde. Ife hatte Gefallen daran gefunden, ihn an seinem Schreibtisch zu beobachten, so wie ein fremdes, aber wenig bedrohliches Tier im Wald.
Die Bücher. Wenn sie den Sandquist nicht beobachten konnte, konnte sie zumindest seine Bücher angucken. Sehen, ob sie zwischen den schweren Deckeln dieselben Geheimnisse fand wie er. Sie konnte zwar nicht lesen, aber es gab immerhin Zeichnungen.
Was würde ihr geschehen, wenn er sie dabei erwischte? Bücher, Porzellan und edle Stoffe waren nichts für ihre groben Sklavenfinger. Ife blieb liegen und blickte die Buchrücken an, die zu ihrer Linken zu einem ordentlichen Turm gestapelt waren. Sie waren aus braunem glattem Leder ohne Schrift, gleich gepressten Kakaotafeln. Es waren zehn Stück. Wie viel sie wohl auf die Waage brachten und in wie viel Zucker man sie aufwiegen konnte?
Ife näherte ihre Nase den ledernen Rücken. Sie wusste nicht, wie Bücher rochen. Ihr Duft war sanft und verwegen. Sie rochen nach keinem Tier und keinem Lebensmittel, nicht nach Schweiß und Arbeit. Der Geruch war leichter als der von Erde und dennoch entsprang er dem feuchten Element. Das Leder erinnerte nur vage an Sattelzeug. Ife ließ ihren Kopf auf der Erde neben den Büchern liegen, schnupperte an ihnen wie an einer fremden Pflanze, die sie auf ihre Genießbarkeit testen wollte. Sie schloss die Augen und witterte so eine ganze Weile, bis sie überzeugt war, dass ihr die Bücher kein Leid zufügen konnten.
Sie nahm das oberste vorsichtig mit beiden Händen vom Stapel und trug es in sicherem Abstand vom Körper zum Studiertisch Sandquists. Behutsam und fast ohne Gewicht setzte sie sich auf die Stuhlkante. Sie hatte auch nicht gelernt, ein Buch zu öffnen. Bei der Missus hatte sie es schon gesehen. Die Missus legte die Bücher vor dem Öffnen nicht auf eine Tischplatte. Sie setzte sich mit ihnen in einen Sessel und während eine Hand das Buch stützte, bewegte die zweite die Seiten darin. Ife wollte es aber machen wie Sandquist, weil es ja auch seine Bücher waren.
Sie atmete tief durch. Der Buchdeckel war glatt und namenlos wie der Rücken. Sie ließ ihre Finger an seinen Rand gleiten und hob ihn vorsichtig an. Das Papier darunter knackte leise. Die erste Seite war gelbbräunlich und enttäuschend leer. Ihr Rand war weitaus schwerer zu greifen als der lederne Einband. Ife wagte sich nur mit äußerster Vorsicht auf die nächste Seite vor. In deren Mitte stand eine Reihe großer geschwungener Buchstaben in schwarzer Tinte. Kein Bild. Ife war ein wenig enttäuscht, wollte aber so schnell nicht aufgeben. Ihre Finger tasteten nach der nächsten Seite. Auf dem Hintergrund des nächsten Papiers gab es schwarze Buchstaben, die Skizze eines Baumes und echte Blätter, mit kleinen Papierstreifen auf den Untergrund geheftet, damit sie nicht verrutschten.
War sie zunächst noch hellhörig wie im Wald, bereit, das Buch beim leisesten Geräusch zuzuklappen und zurück in ihre Ecke zu hasten, vertiefte sie sich mit der Zeit immer mehr in die Sammlung von Schrift, Zeichnungen und Gegenständen aus der Natur. Sie war fasziniert, wie die Blätter und Blüten, die sich draußen im Wind bewegten, hier auf dem Papier in flacher Gestalt erstarrt waren, die Blüten sich nicht mehr der Sonne und den Schmetterlingen öffnen konnten, sondern in der Dunkelheit zwischen den Buchdeckeln auf die Morgendämmerung der Betrachtung warteten. Sie fand auf den Seiten des Buches Bekannte und Unbekannte. Sie fand nicht heraus, warum gerade diese, unter den Tausenden, die dort draußen wuchsen, in einem Buch vereinigt waren. Vielleicht hätte sie es verstehen können, hätte sie die Zeichen dazu zu Worten verwandeln können. Ife blätterte das Buch von vorne nach hinten, dann von hinten nach vorne durch, als hätte sie das Geheimnis irgendwo zwischen den Seiten übersehen. Aber sie kam dem Sinn der Sammlung nicht näher.
Sie nahm schließlich ihren rechten Zeigefinger und fuhr den geschwungenen Linien der Buchstaben nach, verirrte sich in deren Kurven, nahm mal naheliegende Abzweige, mal verwegene Umwege. Wie wäre es, wenn diese Kurven aus dem eigenen Finger flössen, verlängert durch das Gerät, das die Missus Füllfederhalter nannte? Würde sie den seltsamen Sandquist fragen können, ob er sie das Lesen und Schreiben lehrte? Ife hatte nur selten von Sklaven gehört, die lesen und schreiben konnten. In Sugar Creek verstand es Pieter Zahlen zu schreiben. Er notierte jeden Tag in einem dicken Buch, wie viele Oxhofte Zucker von der Siederei zum Trocknen ins Lagerhaus gebracht wurden. Ife glaubte nicht, dass er nur ein einziges Wort schreiben konnte. Mutlos geworden ließ sie den Buchdeckel zuklappen und starrte in die Luft, wie es auch Sandquist an dieser Stelle manchmal zu tun pflegte.
Sie war so sehr versunken, dass sie George nicht kommen hörte. »Was machst du denn da?«, fuhr er sie mehr erstaunt als verärgert an. »Das ist der Arbeitstisch von Herrn Sandquist!«
»Ja, ich weiß.« Nur langsam stand sie von dem Stuhl auf und stellte sich George gegenüber. Er war nur einen Kopf größer als sie und ein wenig kräftiger. Wenn sie ihn überraschte, hätte sie vielleicht sogar die Möglichkeit, sich ihm zu entwinden. Aber da draußen waren die Wachen und, wenn George laut um Hilfe rief, sicherlich auch bald die Hunde.
»Kannst du lesen und schreiben?«, fragte sie ihn stattdessen.
»Der Pater hat gesagt, ich könnte es lernen. Dann könnte ich die Bibel selber lesen und mich an Gottes Worten erbauen. Aber wir haben dann doch nie damit angefangen. Und, um ehrlich zu sein, ich finde es einfacher, wenn mir der Pater die Dinge erklärt.«
»Diese Bücher hier – könnte die dein Pater auch erklären?«
»Es sind die Angelegenheiten des Herrn Sandquist. Sie gehen mich nichts an. Ich versuche nur, Gott zu Gefallen zu sein, indem ich ihn bei einfachen Arbeiten unterstütze.«
Ach, was war dieser Junge doch für ein beschränktes Wesen! Wieso hatte man ausgerechnet ihm, der nichts damit anfangen konnte, das Gut der Freiheit geschenkt?
»Wenn ich nicht hier sitzen und studieren darf, was soll ich dann tun?« Das Wort studieren musste Ife bei Sandquist aufgeschnappt haben. »Ich komme allmählich zu Kräften, und der Herr hat mir vor seiner Abreise keine Aufgabe gegeben. Meinst du, es ist eine gute Idee, wenn ich diese Hütte in Ordnung bringe?«
»Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe einmal versucht bei ihm zu putzen, und er hat es mir sehr übel genommen.«
George konnte Ife nicht lange von den Büchern des Herrn fernhalten, und sie wusste, sie würde nicht eher Ruhe geben, bevor sie ein jedes von vorne bis hinten durchgeblättert hatte. Ihre Finger bekamen die Seiten immer geschickter zu fassen. Den Buchstaben Bedeutung zuzuordnen, gelang ihr jedoch nicht. Sie konnte aber sehen, dass sich die Buchstaben voneinander unterschieden. Mal waren sie verschlungen und vornüber geneigt wie in dem ersten Buch, mal waren sie gleichmäßig und perfekt auf einer Linie angeordnet. Ife konnte nicht sagen, ob es sich bei ihnen vielleicht um eine ganz andere Buchstabenfamilie handelte. Die Bilder waren einfacher zu verstehen, manchmal glaubte Ife sogar, einen Baum oder eine Blüte aus ihrer Umgebung wiederzuerkennen. Aber die Bilder ähnelten einander sehr, machten das zu Brüdern und Schwestern, was draußen unverwechselbar war. Trotzdem zogen die Bilder Ife an, und, da sie nicht das Papier ihres Herrn beschmutzen konnte, malte sie ihre Konturen nach, indem sie sie mit einem Stock in den Lehmboden der Hütte ritzte. Ihre Zeichnungen blieben jedoch gegenüber ihren Vorbildern unkenntlich, sei es wegen der Härte des Bodens, sei es wegen ihrer ungeschickten Hände. Es gab durchaus solche unter den Sklaven, die es verstanden, die Kalebassen mit einer Mischung aus Schlangen und Ranken zu verzieren, aber das war Männerkunst.
Die Kinder ritzten bestenfalls die Grenzen ihrer Spielreiche in die Erde, wenn sie ihre Ländereien und Sklaven untereinander aufteilten. Aber Blumen?
Sie verstand nicht, warum sie die Blumen abzeichnete, es war als könnten sie ihr erklären, was dieser fremde Mister, der kaum mit ihr redete, hier wollte. An dem Tag, wenn es ihr gelang, die Blumenbilder genau zu imitieren, dann würde sie den Mister verstanden haben, da war Ife sich sicher.
Schließlich blätterte sie sogar vor Georges Augen in den Büchern. Sein Gezeter war das Gebell eines zahnlosen Hundes. Sandquist hatte ihm befohlen, sie in der Hütte und die Leute von ihr fernzuhalten, sonst nichts. So mochte er grummeln, dass das Lesen und Schreiben nichts für eine dumme Sklavin wie Ife sei und dass sie es noch dazu niemals lernen würde, er konnte doch nichts dagegen ausrichten. So blieb ihm nichts als abzuwarten, dass Sandquist zurückkam und ihm dann über das absonderliche Verhalten seiner neuen Sklavin zu berichten, damit er die entsprechende Strafe aussprechen könne.
Als Sandquist nach sieben Tagen tatsächlich zurückkam, hatte Ife bereits alle seine Bücher auf ihre Art studiert und sie danach wieder fein säuberlich übereinander geschichtet. Ife saß auf dem Boden der Hütte und ritzte ihre Zeichnungen in den Lehm, doch Sandquist nahm sie gar nicht wahr. Seine Stirn lag in Falten und im Schlepptau brachte er einen Indio mit einem verkürzten Bein und einem von Trübnis verschleierten Auge. Wenn er der einzige war, den Sandquist in der Stadt hatte auftreiben können, dann war sein besorgtes Gesicht nicht verwunderlich. Der Indio war undefinierbaren Alters, nicht jugendlich wie George, aber auch nicht alt wie Coba.
George war auf Sandquist losgestürmt und redete eifrig auf ihn ein, doch der Herr hatte kein Ohr dafür, was sich in seiner Abwesenheit zugetragen hatte. »Das ist Wawaiko«, unterbrach er George. »Er spricht kein Englisch. Ich weiß nicht genau, wo er herkommt, ich habe ihn aus dem Gefängnis freigekauft. Aber er wird sich schon im Wald auskennen. Wir müssen ihn nur zum Reden bringen. Vor allem brauchen wir ihn, um mit den Indianern zu verhandeln, damit sie uns geeignete Begleiter für unsere Expedition mitgeben. Zwei Burschen brauchen wir, die es verstehen, ein Kanu zu steuern. Na, er wird schon den Mund aufmachen, wenn es an der Zeit ist.«
George interessierte nur, warum man Wawaiko ins Gefängnis geworfen hatte. Ihm wurde Kannibalismus vorgeworfen, war die Antwort. Es sei ein verbreiteter Aberglaube, dass die Kariben Menschen fräßen, meinte der schwedische Mister, und daher ein willkommener Vorwand, unliebsame Leute ins Gefängnis zu bringen. Aber Wawaiko hier wäre ja gar kein Karibe, die Kariben wären ja längst alle an Seuchen zugrunde gegangen.
George war misstrauisch und bei dem Wort Kannibalismus gleich einen Meter zurückgewichen.
»Wenn wir übermorgen aufbrechen, wird mir Mister Murray noch zwei starke Sklaven als Träger zur Seite stellen«, erklärte Sandquist weiter.
Ife sah, wie George zusammenschreckte. Auch sie fühlte sich noch nicht bereit, in den Wald zurückzugehen, trotz der ungewohnt reichhaltigen Kost der letzten Tage. Vor allem hätte sie Coba gern um ein neues Amulett gebeten, eines, das sie vor sieben fremden Männern beschützen konnte. Ife betrachtete die unerschütterliche Miene von Wawaiko, dessen sehendes Auge genauso ausdruckslos blieb wie das trübe. George wirkte mehr denn je wie ein kleiner verängstigter Junge. Seine Augen waren groß und rund unter der gewölbten Stirn, seine Nasenlöcher ängstlich geweitet. Gerade die Angst war es, die diesen Jungen so wenig vertrauenswürdig machte.
Sandquist selbst sah entschlossen aus, das musste er auch sein, wenn er sich mit dieser Truppe Fremder, die sich nicht einmal gegenseitig vertrauten, auf den Weg in die Wildnis machen wollte. Ihn machte nicht Angst, sondern seine Entschlossenheit unberechenbar. Schon allein, dass sie mitten in der Regenzeit aufbrechen würden, verhieß nichts Gutes.
Ife erinnerte sich an den Blick, mit dem der Weiße ihren Körper vermessen hatte, bevor man sie so zugerichtet hatte. Auch wenn Sandquist sie in den letzten Tagen wie Luft behandelt hatte, durfte sie niemals diesen Blick vergessen. Sie musste sich vor ihm in Acht nehmen, vor allem, da er jetzt ihr Herr war und sie sein Stück Fleisch.
»Es ist Regenzeit, Herr«, sagte Ife. Sie musste irgendetwas sagen, um diese Expedition aufzuhalten, wenigstens für ein paar Tage aufzuschieben. »Es ist nicht weise, zu dieser Jahreszeit zu reisen. Zwar sind die Flüsse gut befahrbar, aber sobald wir zu Fuß gehen müssen, werden wir im Morast versinken und die Mücken werden uns keine Ruhe lassen.«
»Wer hat dich denn gefragt«, brauste Sandquist auf und wedelte mit der Hand durch die Luft, als wollte er eine lästige Fliege verscheuchen. »Natürlich müssen wir zu Fuß gehen, wenn wir in die Berge wollen. Dort werden wir die Flora finden, die in der Systematik fehlt.«
Wenn Ife auch nicht verstand, was er meinte, bekam sie es erneut mit der Angst. »Keiner von uns ist jemals in den Bergen gewesen«, murmelte sie.
»Deswegen suchen wir uns einen indianischen Führer, du Dumme. Genug geredet, es wird übermorgen losgehen, egal bei welchem Wetter. Ich kann nicht länger auf dieser tristen Plantage sitzen und warten.«
Damit wandte er sich ab und öffnete einen Brief, den er aus der Stadt mitgebracht hatte. Es war, als ob er ein Gespräch mit diesem Brief führte, mal nickte er zustimmend, mal schüttelte er den Kopf, ein paar Mal rutschten ihm auch einige Widerworte heraus.
Der Indio Wawaiko hockte sich neben Ife auf den Boden. Er hatte bislang noch kein Wort gesagt. Er richtete den Blick seines gesunden Auges auf Ifes Kratzspuren auf dem Fußboden. Er wirkte duldsam und abwesend, als würde er noch immer in seinem Kerker sitzen und seines Schicksals harren.
Am nächsten Tag brachte Sandquist statt zwei Trägern nur einen. Ife kannte den Sklaven vom Sehen. Sein Name war Edward. Er war groß und kräftig, mit einem starken kurzen Nacken und einem platten Schädel, ideal, um Lasten darauf abzustellen. Sein Körper wies keinen offensichtlichen Makel auf, doch war es schwer zu glauben, dass dieser Mister jemanden ausgesucht hatte, der noch voll und ganz zu gebrauchen war. So war es bei diesem nur eine Frage der Zeit, bis er seinen Mangel offenbaren würde.