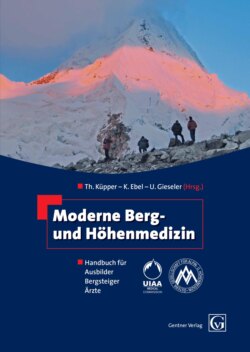Читать книгу Moderne Berg- und Höhenmedizin - K. Ebel - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2 Physiologie des Aufenthaltes in mittlerer, großer und extremer Höhe
K. Ebel, W. Domej, U. Gieseler, A. Morrison, R. Waanders, N. Netzer, M. Faulhaber, B. Jelk, T. Küpper
Die Physiologie der mittleren und großen Höhen ist aus medizinischer Sicht ein spannendes Kapitel, obwohl viele Details bis heute nicht ausreichend geklärt sind. Die Reaktionen des menschlichen Körpers betreffen alle Organsysteme, von der einzelnen Zelle bis hin zu den großen Organen wie Herz und Lunge.
Das Verständnis der physiologischen, chemischen Prozesse ist jedoch zu fundamental, um zu verstehen, was sich im Körper eines Einzelnen in großen Höhen ereignet. Erst daraus können die praktischen Konsequenzen für die Akklimatisation in der Höhe sowie der Diagnose und Therapie von Höhenerkrankungen entwickelt werden.
Leider gehört das Wissen um die Veränderungen und Anpassungen des Körpers in der Höhe bis zum heutigen Tage nicht zur Ausbildung eines künftigen Arztes, allenfalls werden einige wenige Grundlagen im Studium vermittelt. So ist es nicht verwunderlich, dass genaue Kenntnisse über die Höhenphysiologie unter Ärzten weitgehend nicht vorhanden sind.
Umso wichtiger ist es, dass jeder, der einen längeren Höhenaufenthalt plant, sich zumindest mit den Grundlagen vertraut macht, um zu verstehen, worauf er während des Aufenthaltes besonders achten muss.
2.1 Einige physikalische Größen
K. Ebel
Ohne die Gesetze der Physik wäre Leben nicht entstanden. Ohne die Gravitation würden die Berge nicht existieren.
In den Bergen ist das Leben ein intensiveres. Alles scheint anstrengender, wärmer, kälter, langsamer, aber auch klarer, einfacher, ehrlicher. Betrachtet man die Bergwelt aus dem Blickwinkel der Physik, so ist sie eine wahre Spielwiese der Mechanik und der Thermodynamik. Bei der Orientierung wird auch die Elektrodynamik (Kompass, GPS) bemüht. Die Festkörperphysik begegnet uns, wenn wir uns Gesteine oder Schnee anschauen. In diesem kurzen Kapitel wird versucht, ein grundsätzliches, gebrauchsorientiertes, Verständnis für die „Physik der Berge“ zu entwickeln.
2.1.1 Temperatur und Wind
Temperatur ist eine gemeinsame intrinsische Eigenschaft der Systeme, die sich miteinander im thermischen Gleichgewicht befinden. Stehen Systeme nicht miteinander im thermischen Gleichgewicht, können sie verschiedene Temperaturen haben.
Über die Temperatur lässt sich ein Zusammenhang zur mittleren Bewegungsenergie der einzelnen Teilchen herstellen, wobei zwei Systeme mit verschiedenen Temperaturen immer bestrebt sind, den Temperaturunterschied auszugleichen.
Der Temperaturausgleich geschieht immer, indem Wärme vom wärmeren Körper zum kälteren fließt. Es gibt verschiedene Formen des Wärmeflusses: Strahlung, Materialtransport oder Konvektion und direkter Wärmefluss.
Während die Strahlung kein Medium benötigt, also eigentlich immer aktiv ist, so braucht man für die Konvektion den Materialtransport. Dieser Materialtransport kann auch in Form von Gasen oder Flüssigkeiten (Regen, Schnee, Graupel, Luft) vorhanden sein, die den Wärmetransport übernehmen. Beim Wärmefluss direkt von einem Festkörper in einen anderen bedarf es des Kontakts zwischen beiden. Dieser Transport ist umso effektiver, je besser der Kontakt ist (nasse Hose auf Schnee gegenüber trockener Hose auf gleich warmem Fels: Was ist wohl wärmer am Gesäß?).
Hinweis. Ein in eine Rettungsdecke eingewickelter Körper ist nur vor Wärmeverlust durch Strahlung und Konvektion geschützt, die Wärmeleitung ist immer noch aktiv.
Die Wärmestrahlung und die direkte Wärmeleitung lassen sich in der Praxis recht gut durch isolierende Kleidung eindämmen. Größere Probleme bereitet hier die Konvektion vor allem bei Wind oder anderen Wettereinflüssen wie Regen oder Schnee an den nicht oder nur dünn geschützten Extremitäten. Der Materialtransport und damit die Wärmeabfuhr sind in etwa proportional zur Windgeschwindigkeit, womit sich ein grober Zusammenhang zwischen Windgeschwindigkeit und auf der Haut erlebter Temperatur herstellen lässt (Tabelle 2.1).
Hinweis. Es ist zu beachten, dass die erlebte Temperatur durchaus auch zu erlebbaren Konsequenzen wie Erfrierungen und Ähnlichem führt. Haut gefriert unterhalb von –30 °C Chill-Temperatur (gelber Bereich) nach ca. zwei Minuten, unter –45 °C (roter Bereich) nach 30 Sekunden. Windschutz ist daher neben der Isolation essenziell. Ist der Windschutz gegeben, so gilt wieder die absolute Temperatur.
Tabelle 2.1: Zusammenhang zwischen Windstärke/Windgeschwindigkeit und gefühlter Temperatur („Chill-Temperatur“ oder „Windchill“ (Quelle: Siple PA, Passel CF. Measurements of dry athmospheric cooling in subfreezing temperature. Proc Am Philosoph Soc 1945; 89: 177–199)
Auch Höhe steht in einem Zusammenhang mit Temperatur; so sinkt die Lufttemperatur um 0,5 bis 1 Grad pro 100 m Aufstieg. Dies geschieht, weil ein Großteil der Infrarotstrahlung der Sonne den Erdboden erreicht. Der so aufgewärmte Boden heizt die Luftschichten direkt darüber teilweise durch Konvektion, am meisten aber durch Strahlung. Die durch Strahlung aufgeheizten Kohlendioxid- und Wassermoleküle reflektieren nun ihrerseits die Wärmestrahlung, teils in Richtung Boden, teils in höhere Luftschichten. Das generelle Ergebnis dieses Prozesses ist hinlänglich als Treibhauseffekt bekannt.
Das Aufheizen der Erdoberfläche ruft Konvektionsströmungen in den unteren Atmosphärenschichten hervor. Diese sind für Wetter- und Klimabildung verantwortlich. Normalerweise sinkt also die Temperatur mit ansteigender Höhe, es kommen aber auch Inversionslagen vor, bei denen es in der Höhe wärmer ist als am Boden (Abb. 2.1). Dies ist dann der Fall, wenn sich Bodennebel oder Wolken im Tal nicht auflösen.
Abb. 2.1: Inversionslage – die Wolken füllen das Tal förmlich auf (Foto: K. Ebel)
Durch die Anomalie des Wassers, das sich bei zunehmender Kälte weiter ausdehnt, wurden da, wo sich das Wasser in Ritzen gesetzt hat, vom Frost die Felsen gesprengt. Auch das Aufheizen durch die Sonne tagsüber und das Herunterkühlen in der Nacht haben zur Erosion geführt und die Felsmonolithen zerbröckelt.
2.1.2 Gravitation und Mechanik
Durch die Anwesenheit der Gravitation fallen das Geröll und der Schnee nach unten und werden mehr oder weniger gut am Ort gehalten. So etwa sind unsere geliebten Gipfel und Pulverhänge entstanden.
Die Gravitation zieht aber nicht nur Feststoffe an. Auch Gase und Flüssigkeiten werden zum Mittelpunkt der Erde gezogen. Auch ist die Gravitation nicht an allen Orten der Erde gleich. Die Form der Erde, etwas dicker am Äquator, also etwas abgeflacht an den Polen, sorgt für eine stärkere Gravitation am Äquator als an den Polen, so dass der Luftdruck und damit die Luftprobleme, die wir in der Höhe haben, am Äquator geringer sind. Es gibt daher Berge wie den Chimborazo (6310 m), dessen Gipfel weiter vom Erdmittelpunkt entfernt liegt als der des Mount Everest (8850 m). Trotzdem ersteigt er sich erheblich einfacher als so mancher Sechs- oder Achttausender im Himalaya.
Klettern ist geschicktes Ausnutzen von Hebel und Reibung. Sei es, dass wir zum Sportklettern extrem kleine Schuhe anziehen, um den Hebel am Fuß zu verkürzen, oder wir merken beim Eisklettern die Wirkung des gleichen Hebels an dauermüden Waden.
2.1.3 Klima
Auch die klimatischen Einflüsse sind nicht zu unterschätzen. Hierbei ist es egal, ob es sich um hohe Temperaturen beim Sportklettern oder extrem tiefe am Denali handelt. Die Leistungsfähigkeit leidet und die Gesundheit wird bei Nichtbeachtung entweder durch Sonnenbrand, Hitzschlag oder Erfrierungen und Unterkühlung in Mitleidenschaft gezogen.
Die klimatischen Bedingungen entstehen aus verschiedensten thermodynamischen Zusammenhängen, die an den verschiedenen Breitengraden unterschiedliche Auswirkungen haben.
Fallbeispiel. Beste Eiskletterbedingungen bestehen in Island von Mitte Oktober bis Mitte Dezember. Ende Dezember kommt ein vom Golfstrom „mitgebrachter“ Orkan auf und die Temperaturen steigen. Sämtliches Eis und fast der ganze Schnee fallen den hohen Temperaturen zum Opfer. Und das am Polarkreis.
Auch im Hochsommer, wenn in der gesamten Umgebung eine stabile Hochdruckwetterlage vorherrschend ist, kann sich in bestimmten Lagen ein sog. Mikroklima ausbilden. Dies lässt sich im Kleinen, in unkritischen Situationen, jeden Abend bei Talwinden auf der Hütte oder im Lager beobachten, kann aber, bei verschiedenen Unternehmungen, auch ernstere Auswirkungen haben.
Fallbeispiel. An manchen Bergen gibt es ein Mikroklima. Eines der besten Beispiele hierfür ist der Eiger in den Berner Alpen. Auf der Sonnenterasse der kleinen Scheidegg genießen die Touristen bei Sonnenschein Dramen, die sich gleichzeitig bei Schneetreiben und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt in der Nordwand abspielen.
Heutzutage, da man weltweit den Wetterbericht im Internet abfragen kann, hat die Vorbereitung auf die zu erwartenden Bedingungen nicht an Bedeutung verloren. Oder mit den Worten von Jerry Moffat ausgedrückt: „Failure needs no preparation“.
Den Auswirkungen von kaltem und trockenem Klima lässt sich gut mit erhöhter Kalorien- und Flüssigkeitsaufnahme (keine verstärkte Elektrolytaufnahme nötig) und angepasster Kleidung begegnen. Bei heißem Klima ist neben der angepassten Kleidung auch auf den Elektrolythaushalt zu achten. In beiden Klimata macht es Sinn, sich in den ersten Tagen nicht zu viel vorzunehmen, um dem Organismus die Anpassung zu erleichtern.
2.1.4 Atmosphäre
Einige Zusammenhänge in der Physik der Atmosphäre sind für uns Bergsteiger essenziell. Hier soll kurz auf die wichtigsten eingegangen werden. Die Atmosphäre erstreckt sich von der Oberfläche unserer Erde bis zu einer sich ständig bewegenden äußeren Grenze. Die beiden Faktoren, die diese Grenze bestimmen, sind einerseits die Gravitation, die die Gasmoleküle und damit die atmosphärische Hülle verdichtet und verkleinert, andererseits die Wärmestrahlung der Sonne, die die Gashülle der Erde aufheizt und damit zu einer Ausdehnung derselben führt.
Die damit schwankende Dichte (Masse pro Volumen) der Luft ändert also innerhalb bestimmter Grenzen ihren Wert. So wie sich die Dichte ändert, so ändert sich auch der Luftdruck (Kraft pro Fläche) innerhalb gewisser Grenzen auch ohne Standortänderung. Ändert man seinen Standort jedoch von der Erde weg in Richtung Weltall, so fällt der Druck kontinuierlich mit steigendem Abstand zur Erdoberfläche, im weiteren Höhe genannt, ab. Abgesehen von temperaturbedingten Abweichungen zeigt der Abfall einen exponentiellen Charakter (Abb. 2.2).
Der auf Meereshöhe gemessene Druck ist so groß, dass er in einem U-Rohr (erste Barometer) eine Quecksilbersäule von 760 mm (Torr) zu unterstützen vermag. Dieser Druck, der in der Medizin immer noch so gemessen wird, entspricht den 1013,25 hPa bei Normalbedingungen (Temperatur 273,15 K = 0 °C auf Höhe des mittleren Meeresspiegels).
Die Umrechnungen können folgenden Gleichungen entnommen werden.
Abb. 2.2: Vergleich verschiedener Höhen von Zivilisation und Bergen
■ 1 atm = 760 Torr = 101325 Pa
■ 1 Torr = 133,32 Pa ~ 1 mmHg
■ 1 bar = 0,987 atm = 750,6 Torr
Auf einer Höhe von ca. 5500 m halbiert sich der gemessene Druck, während er aufeiner Höhe von ca. 10 000 m nur noch ca. einem Viertel dem auf Meereshöhe entspricht.
Strahlung
Die Atmosphäre übernimmt für uns Menschen eine sehr wichtige Schutzfunktion: Sie hilft uns mit der Strahlung aus dem Weltall. Die langwellige Infrarotstrahlung, auch Wärmestrahlung genannt, wird teilweise absorbiert, so dass die Wärme uns zugute kommt. Sie schützt uns aber auch vor der kurzwelligen Ultraviolettstrahlung. Diese Strahlung ist es, die Sonnenbrand und Schneeblindheit hervorruft. Die Wirkung der Strahlung ist von verschiedenen Faktoren abhängig:
1 Sonnenstand: 2/3 der täglichen UV-Strahlung konzentrieren sich über 4 Stunden zur Mittagszeit;
2 Bestrahlungsdauer;
3 Meereshöhe: Zunahme von 10–20 % pro 1000 hm und Zunahme des UV-Anteils um 5–6 %;
4 Reflexion: Zunahme auf Schnee bis zu 90 %;
5 Streuung: Nebel +40 %;
6 individuelle Empfindlichkeit: Rothaarige sind empfindlicher als z. B. Blonde oder gar Schwarzhaarige.
2.2 Lunge und Höhe
W. Domej
2.2.1 Atemsteuerung, periphere und zentrale Chemorezeptoren
Zellen und Gewebe des Körpers sind in ihrer Funktion eng an eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung gebunden. In Abhängigkeit von ihrer Stoffwechselaktivität können Organe einen akuten Sauerstoffmangel bzw. Perfusionsstopp nur für kurze Zeit tolerieren (Tabelle 2.2). Sensoren auf zellulärer Basis messen laufend den aktuellen Sauerstoffgehalt im arteriellen Blut sowie in der Einatemluft und passen die Atemtätigkeit entsprechend an. Der überwiegende Atemantrieb in der Höhe resultiert aus Änderungen des arteriellen Sauerstoffpartialdruckes (paO2), die von sauerstoffsensitiven Zellen peripherer Chemorezeptoren an der Aufteilungsstelle der beidseitigen Halsschlagader (Glomus caroticum in der Karotisgabel) und im Bereiche des Aortenbogens (Glomus aorticum) registriert werden. Dabei ist das Glomus caroticum beim Menschen wie auch bei Säugetieren der wichtigste Sauerstoffsensor, der neben paO2 und paCO2 auch Glukose und pH-Wert zu messen und in afferente Signale umzusetzen vermag. Die eigentlichen Sensorzellen sind dabei sog. Typ-I-Zellen (Hauptzellen), die in engem Kontakt zu Dendriten des IX. Hirnnerven stehen (Karotissinus-Nerv).
Wie der Sauerstoff von den Sensorzellen gemessen wird, ist letztlich nicht vollständig geklärt. Möglicherweise fungiert eine bestimmte Hämoxygenase zusammen mit kalziumabhängigen Kaliumkanälen als molekularer Sensor. Ein Abfall des paO2 führt im Glomus caroticum durch Hemmung von Kaliumkanälen innerhalb kürzester Zeit zu einer Depolarisation, in deren Folge es zur Öffnung spannungsabhängiger Kalziumkanäle, Anstieg des intrazellulären Kalziums sowie Freisetzung gespeicherter Neurotransmitter (Dopamin, ATP, Acetylcholin) kommt, die letztlich ein elektrisches Signal im afferenten Karotissinusnerv hervorrufen. Über eine gesteigerte afferente Impulsrate an das bulbäre Atemzentrum wird die Atemtätigkeit geregelt, wobei die resultierende efferente motorische Stimulation zu einer Verstärkung des Atemantriebes mit vertiefter und beschleunigter Atmung führt (Hyperventilation).
Schädigungen dieser sauerstoffsensitiven Zellverbände oder des nervalen Übertragungsmechanismus, beispielsweise im Rahmen operativer Eingriffe an den Karotiden (Endarteriektomie/bilaterale Resektion des Glomus caroticum), eventuell auch nach Bestrahlung der Halsregion, können die hypoxiegetriggerte Atemregulation (HVR) seitens peripherer Chemorezeptoren deutlich einschränken, was zu respiratorischen Anpassungsproblemen in der Höhe führen und die respiratorische Sofortreaktion mehr oder weniger einschränken kann. Unter chronischer Hypoxämie, aber auch bei systemischer Blutdruckerhöhung, kommt es darüber hinaus zu zellulären Veränderungen der Karotiskörperchen sowie zu deren Vergrößerung, wobei sich Letztere bei Hochlandbewohnern, beispielsweise den Quechua-Indianern, während des gesamten Lebens fortsetzt. Offensichtlich sind die Glomera nicht imstande, zwischen Reizen chronischer Hypoxämie und erhöhtem intravasalem Druck zu differenzieren. Das ist der Grund, warum eine systemische Bluthochdruckerhöhung ebenfalls zu einer Engstellung der Glomusarterien und zur Glomusischämie führt.
Tabelle 2.2: Wiederbelebungszeit (WBZ) von Organen unter Normoxie bei 37 °C
| Organ | Zeitdauer in Minuten |
| Gehirn | 3- 5 |
| Herz | 15- 30 |
| Leber | 180–240 |
| Niere | 60–180 |
Die Hyperventilation unter hypobarer Hypoxie (HVR bzw. hypoxische Atemantwort, „hypoxic ventilatory drive“) bedingt eine respiratorische Alkalose (paCO2-Abfall → pH-Wert-Anstieg), wobei sich die Alkalose per se wiederum hemmend auf das Atemzentrum in der Medulla oblongata auswirkt. Atemtiefe und Atemfrequenz pendeln sich in der Folge auf einem der Höhenhypoxie angepassten Niveau ein. Allerdings wird die Atemregulation auch durch Faktoren wie dem aktuellen Hormonstatus (Katecholamine, Schilddrüsenhormone, Progesteron), Temperatur, Schmerz, Stress, Emotionen und pulmonalen Dehnungsrezeptoren (Hering-Breuer-Reflex) beeinflusst.
Hinweis. Eine zusätzliche Sauerstoffapplikation, sedierende Medikamente wie Hustenmittel, Schlafmittel, Antidepressiva, Schmerzmittel oder Alkohol wirken dämpfend auf den zentralen Atemantrieb und sollten daher in der Höhe obsolet sein.
Zentrale Chemorezeptoren sind im Bereiche des bulbären Atemzentrums lokalisiert und reagieren auf arterielle bzw. zerebrospinale Änderungen des pH-Werts sowie des paCO2. Sowohl eine akute Zunahme der H+-Ionenkonzentration (Azidose) als auch ein Anstieg des paCO2 (Hyperkapnie) führen zu einer Steigerung des Atemantriebes und der Atmung. Zentrale Chemorezeptoren sind im Rahmen akut-respiratorischer Änderungen für die Atemregulation auf Normalhöhe von Bedeutung, während bei respiratorischen Störungen, die mit chronischer Hyperkapnie einhergehen, der zentrale Atemantrieb durch Adaptations- und renale Kompensationsmechanismen abgeschwächt wird. So kommt es bei chronisch respiratorischer Insuffizienz häufig dazu, dass der Atemantrieb allein durch die Hypoxämie über periphere Chemorezeptoren aufrechterhalten wird, da sich die Sensitivität der zentralen Chemorezeptoren auf den paCO2 bei chronischer Hyperkapnie abschwächt.
Tabelle 2.3: Inspiratorischer Sauerstoffpartialdruck in 8850 m Höhe ohne supplementären Sauerstoff
| Durchschnittlicher Gesamtluftdruck am Mt. Everest (pB) | 251 mmHg (FiO2 0,209) |
| piO2 trocken (STPD) | 251 × 0,209 = 52,4 mmHg |
| piO2 wasserdampfgesättigt (BTPS) | (251–47) × 0,209 = 42,6 mmHg |
| piO2 abzüglich des pACO2 unter extremer Hyperventilation | [(251–47) × 0,209] – 10 = 32,6 mmHg |
| piO2: inspiratorischer Sauerstoffpartialdruck, pAO2: alveolärer Sauerstoffpartialdruck, BTPS: Body Temperature Pressure Saturated |
2.2.2 Atmung in Ruhe und Belastung in der Höhe
Ein Aufenthalt in großen und extremen Höhen wird erst durch die Fähigkeit zu intensiver Hyperventilation ermöglicht. Voraussetzung dafür ist eine einwandfreie respiratorische Funktion in allen Teilbereichen der Atmung (Ventilation, Diffusion, Perfusion). Tabelle 2.3 bezieht sich auf den durchschnittlichen inspiratorischen Sauerstoffpartialdruck (piO2) am Gipfel des Mt. Everest (8850 m) unter Berücksichtigung der Konditionierung des Atemgases (Wasserdampfsättigung, Erwärmung, Filtrierung) und der erforderlichen extremen Hyperventilation.
Tabelle 2.4: Positive und negative Einflüsse auf die Atmung unter Höhenbedingungen
| Negative (bronchokonstriktorische) Einflüsse | Positive (bronchodilatatorische) Einflüsse | |
| ■ Verminderte Luftfeuchtigkeit■ Kaltlufthyperventilation■ Mechanische Belastung (Rucksack)■ Lang andauernde Hyperventilation■ Muskuläre Erschöpfung■ Photooxidanzien (Ozon)■ Exsikkose | ■ Verminderte Outdoor-Allergenbelastung■ Verminderte Luftdichte■ Verminderte aerogene Partikelbelastung■ Optimale Akklimatisation■ Adrenerger Hypoxiestress |
Die sich mit zunehmender Höhe vermindernde Luftdichte führt über eine Abnahme der dynamischen Viskosität und des Atemwegswiderstandes zu verbesserter Konvektion der Atemluft in den Atemwegen; auch eine in der Regel geringere Partikel- und Allergenbelastung wirkt sich in der Höhe positiv auf die Ventilation aus (Tabelle 2.4). Dem steht ein mit zunehmender Höhe sich verstärkender pulmonalarterieller Druckanstieg gegenüber, der sich bei zusätzlich körperlicher Belastung weiter erhöht.
2.2.3 Hypobarie und Konsequenzen
Nach dem Boyle-Mariotte‘schen-Gesetz ist das Produkt aus Druck und Volumen eines Gases unter gleichbleibender Temperatur konstant; das bedeutet, dass sich bei rasch fallendem Luftdruck (Seilbahnfahrten, nicht druckkompensierte Luftfahrzeuge wie Hubschrauber oder Segelflieger) unter Umständen Gasausdehnungsbeschwerden in Form von Schmerzen im Bereiche der Zähne, der Nasennebenhöhlen, des Innenohrs oder des Verdauungstrakts einstellen können. In diesem Zusammenhang sind vor allem blähende Speisen sowie kohlensäurehältige Getränke besonders vor kurzfristigen passiven Höhenaufstiegen zu meiden. Auch bei hochgradigem Lungenemphysem sollte Vorsicht geboten sein: Ein extrem rascher atmosphärischer Druckabfall könnte unter Umständen zu einem Pneumothorax führen, insbesondere bei gegebener Neigung zu Spontanpneumothorax.
2.2.4 Gasaustausch in der Höhe
In großer Höhe ist nicht die zirkulatorische Kapazität leistungsbegrenzend, sondern allein der Diffusionsvorgang als Teilfunktion der Atmung. In extremer Höhe kann auch durch intensivste Hyperventilation der alveoläre Sauerstoffpartialdruck (pAO2) nicht mehr ausreichend hoch gehalten werden, so dass die alveoloarterielle Sauerstoffpartialdruckdifferenz (AaDO2) mit der Höhe abnimmt und eine progressive Hypoxämie die Folge ist. Die Verminderung des paO2 sowie die sich zunehmend verkürzende Kontaktzeit des kapillären Blutstromes an den Alveolen führen zu einer mit der Höhe abnehmenden O2-Diffusion. Die zunehmende Diffusionslimitierung wird in extremen Höhen bereits bei geringen Belastungen relevant. Der niedrigste jemals am Menschen arteriell gemessene Sauerstoffpartialdruck betrug bei gegebenem barometrischen Luftdruck von 272 mmHg unglaubliche 19,1 mmHg. Dabei handelte es sich um eine Blutgasprobe aus der Femoralarterie eines Teilnehmers der Caudwell Xtreme Everest Expedition, die knapp unterhalb des Everestgipfels in 8400 m Höhe gewonnen wurde. Der Proband war ohne supplementären Sauerstoff unterwegs.
Hinweis. Die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max) als Maß der maximalen aeroben Leistungsfähigkeit nimmt ab 1500 m um rund 10 % pro 1000 Höhenmeter ab.
Mit zunehmender Höhe wird ein und dieselbe Belastung daher immer anstrengender empfunden, da ein immer höherer Anteil der abnehmenden VO2max in Anspruch genommen werden muss.
Fallbeispiel. Von einem untrainierten jungen Mann werden beispielsweise auf Meeresspiegelniveau für eine Ergometerleistung von 100 Watt ca. 50 % (1,55 l O2/min) der VO2max (3,1 l/min) beansprucht, in 4500 m Höhe und bei um 30 % verminderter VO2max (2,17 l/min) ist bereits ein Anteil von 71 % erforderlich. Bei einem trainierten Bergsteiger hingegen (VO2max z. B. 5,0 l/min) beträgt die Sauerstoffaufnahme bei 100 W auf Meereshöhe nur 31 % und in 4500 m Höhe immerhin noch 44 % seiner VO2max. Aus diesem Beispiel wird auch der Vorteil eines guten Trainingszustandes in der Höhe unmittelbar quantitativ erkennbar.
2.2.5 Hypoxische pulmonale Vasokonstriktion
Die in der Höhe generalisiert auftretende hypoxisch-pulmonale Vasokonstriktion (HPV) ist bis zu einem bestimmten Grad sinnvoll, da sie zu einer Abnahme funktioneller Shunts, Homogenisierung der Perfusion und Angleichung des Ventilations-Perfusions-Verhältnisses (V/Q) führt.
Infolge des Anstiegs des pulmonal-vaskulären Widerstands unter Hypoxiebedingungen erhöht sich der pulmonal-arterielle Druck proportional zur geografischen Höhe. Es kommt quasi zu einer „dosisabhängigen“ hypoxiebedingten Verschiebung des Gleichgewichtes zur vasokonstriktorischen Seite. Basis des pulmonal-arteriellen Druckanstiegs ist der in der Höhe generalisiert auftretende alveolovaskuläre Reflex (Euler-Liljestrand), wobei die Hypoxie von glatten Muskelzellen in den Wänden kleiner Gefäße (SPASM-Zellen/“small pulmonary artery smooth muscle cells“) der pulmonalarteriellen Strombahn, vermutlich aber auch im Alveolarbereich registriert wird. Die hypoxische pulmonal-arterielle Vaskonstriktion läuft vom vegetativen Nervensystem völlig unbeeinflusst ab und stellt damit eine autonome Leistung der Lungenstrombahn dar, die auch noch an der isolierten Lunge nachweisbar ist. Akute normobare sowie hypobare Hypoxie führen zu einem Anstieg der pulmonal-vaskulären Resistance (PVR) besonders im Arteriolenbereich mit einem Wirkungsmaximum innerhalb von 5 Minuten.
Bei hochgradiger hypoxisch bedingter pulmonal-arterieller Hypertonie (HAPH) in großen und extremen Höhen verkürzt sich durch Zunahme der Strömungsgeschwindigkeit die Kontaktzeit des Blutes an den Alveolen, wodurch die Diffusionskapazität für Sauerstoff weiter eingeschränkt und die Hypoxämie verstärkt wird. Ab einer kritischen Verkürzung der Kontaktzeit des Blutes an den Alveolen unter 0,25 Sekunden verschlechtert sich per se die Aufsättigung des Hämoglobins. Dazu kommt, dass aufgrund höhenatmosphärischer Bedingungen und konsekutiver alveolärer Hypoxie der alveolokapilläre Druckgradient (AaDO2) als treibende Kraft der Sauerstoffaufnahme abnimmt. Die HAPH (höhenassoziierte pulmonal-arterielle Hypertonie) stellt somit eine nicht kardial bedingte präkapilläre, reversible Drucksteigerung im Lungenkreislauf dar und ist mit eine Ursache dafür, dass der Diffusionsvorgang in großer Höhe zum allein leistungsbegrenzenden Faktor wird, ganz im Gegensatz zur Normalhöhe, wo die Perfusion letztlich die maximale Leistungsfähigkeit determiniert.
Der Mechanismus der HPV basiert auf einer Hemmung O2-sensitiver Kaliumkanäle mit nachfolgender Depolarisation glatter Muskelzellen in der Wand pulmonal-arterieller Gefäße und Aktivierung spannungsabhängiger Ca2+-Kanäle. Ein Ca2+-Einstrom und die Vasokonstriktion (HPV) sind die Folge. Die Vasokonstriktorenantwort unterliegt einer großen Variabilität. So ist die HPV von Spezies zu Spezies sehr unterschiedlich, was zum Großteil als Folge genetischer Determination zu werten ist. Bestimmte Rinderarten zeigen eine besonders große vaskuläre Hypoxiesensitivität (Hyperresponder), während das Gefäßsystem des Yaks oder Lamas nur sehr gering auf Hypoxie reagiert.
So wie eine überschießende HPV beim Menschen ein HAPE auslösen kann, kann diese beispielsweise beim Rind zur „Brisket Disease“ führen. Diese bei Rinderzüchtern der Rocky Mountains gefürchtete Höhenunverträglichkeitsreaktion tritt bei bestimmten Rinderrassen in Höhen über 2500 m auf und unterliegt einem Vererbungsmodus von 40–70 %. Auf Basis einer erhöhten HPV und erhöhter pulmonal-arterieller Druckwerte kommt es dabei zu thorakaler und abdomineller Flüssigkeitsansammlung und Rechtsherzdekompensation. So wie beim HAPE bessert sich die Symptomatik auch bei den Tieren im Falle einer Verlegung in tiefer gelegene Regionen.
Selbst innerhalb der menschlichen Spezies gibt es eine große Breite pulmonal-vaskulärer Aktivitätsmuster, die von Respondern bis zu Non-Respondern reichen. Von allen Hochlandbewohnern leben Tibeter am längsten in großen Höhen und zeigen als Ausdruck ihrer perfekten Anpassung die geringste HPV aller Gebirgsvölker. Gesunde Menschen der weißen Rasse weisen in etwa eine 30- bis 50%ige pulmonal-arterielle Drucksteigerung in 4000 m Höhe auf. Es ist verständlich, dass Personen mit vorweg erhöhten pulmonal-arteriellen Druckwerten auf Normalhöhe (> 25 mmHg in Ruhe, > 30 mmHg unter Belastung, pulmonaler Verschlussdruck [„wedge pressure“, PAWP] < 15 mmHg) auch höhere pulmonalarterielle Druckwerte in entsprechender Höhe generieren. Im Extremfall kann aus der resultierenden Rechtsherzbelastung eine akute Rechtsherzinsuffizienz entstehen.
2.2.6 Respiratorische Langzeitfolgen des Höhenaufenthaltes
Höhenaufenthalte in mittleren Höhen werden auch zu therapeutischen Zwecken genutzt. Man spricht auch von sog. therapeutischen Höhen. Positive Langzeiteffekte der Höhe sind vor allem bei Asthmatikern seit langem bekannt und werden im Rahmen von Kuraufenthalten genutzt (z. B. Hochgebirgskliniken Davos). Der Benefit einer langfristigen Höhenanpassung (Akklimatisation) kann auch nach Rückkehr in tiefe Lagen bzw. auf Normalhöhe bis zu 10 Tage lang beibehalten werden.
Hinweis. In großen und extremen Höhen ist nicht die Herzleistung, sondern die pulmonale Diffusion allein leistungslimitierend. Personen, die unfähig sind, ihre Atmung entsprechend dem Grad der Höhenhypoxie zu steigern, sind für große und extreme Höhen nicht geeignet.
Weiterführende Literatur
Cogo A, Fischer R, Schoene R: Respiratory disease and high altitude. High Alt Med Biol 2004; 5: 435–444.
Domej W, Schwaberger G: Die Entstehung des Höhenhustens (ARC) – eigene Entität oder nur Ausdruck gesteigerter bronchialer Reaktivität? JB OEGAHM 1999; 10: 127–135.
Gong H Jr, Tashkin DP, Lee EY, Simmons MS: Hypoxia-altitude simulation test. Evaluation of patients with chronic airway obstruction. Am Rev Respir Dis 1984; 130: 980–986.
Grocott MP, Martin DS, Levett DZ, McMorrow R, Windsor J, Montgomery HE, Caudwell Xtreme Everest Research Group. Arterial blood gases and oxygen content in climbers on Mount Everest. N Engl J Med 2009; 360: 140–149.
Luks AM, Swenson ER: Travel to high altitude with pre-existing lung disease. Eur Respir J 2007; 29: 770-792.
Smith CA, Dempsey JA, Hornbein TF: Control of breathing at altitude. In: TF Hornbein, RB Schoene (eds.): High Altitude, an exploration of human adaptation. London: Informa Healthcare, 2001, pp. 139–173
2.3 Höhenphysiologie
U. Gieseler
2.3.1 Veränderungen bei akuter Höhenexposition
Als Reinhold Messner und Peter Habeler 1978 erstmals den Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff bestiegen, wurde auch der breiten Öffentlichkeit schlagartig die Bedeutung der Zusammenhänge zwischen Sauerstoff und zunehmender Höhe bewusst. Die überwiegende Mehrzahl von Ärzten und Physiologen war damals allerdings noch der Meinung, dass eine Besteigung des Mount Everst ohne Sauerstoffzusatz nicht möglich sei und wenn überhaupt, dann nur mit in Folge irreparablen Gehirnschäden. Inzwischen wissen wir jedoch, die Physiologen irrten – und glücklicherweise glaubten Messner und Habeler ihnen nicht. Und bis heute wurden aus ihnen auch nicht die von Ärzten damals prophezeiten Idioten.
Höhenstufen (Tabelle. 2.5)
Nach dem Gasgesetz von Dalton entsprechen die einzelnen Gasdrücke ihrem Volumenanteil. Mit zunehmender Höhe hat man also nicht weniger O2 zum Atmen, sondern der Partialdruck nimmt in der Höhe ab, die 21 % O2 bleiben jedoch konstant.
Hinweis. Die 21 Vol% O2 bleiben in unserer wetterbestimmenden Troposphäre bis über 10000 m weitgehend konstant. Mit zunehmender Höhe sinkt der Sauerstoffpartialdruck (pO2) proportional zur Abnahme des Luftdrucks.
Abb. 2.3: Die Postkarte von Messner und Habeler nach erfolgreicher Besteigung des Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff
Abb. 2.4: Unsere Atmosphäre besteht zu 21 Vol% aus Sauerstoff (O2), 78 % Stickstoff (CO2) sowie 1 % Restgase
Der Abnahme des Luftdrucks wird mit Hilfe einer Exponentialfunktion berechnet, bekannt als barometrische Höhenformel. Die Höhenmesser, wie sie heute entweder noch analog oder aber digital in Uhren zu finden sind, arbeiten in vereinfachter Form anhand dieser Formel.
Der Luftdruck auf Meereshöhe beträgt 1013 hPa, in ca. 5500 m aber nur noch etwa 50 % und auf Höhe des Mount Everest etwa ein Drittel des Wertes auf Meereshöhe.
Tabelle 2.5: Einteilung der Höhenstufen
| Höhe[m] | Höhenstufe |
| 500–1500 | Niedrigen Höhen |
| 1500–3500 | Mittlere Höhen |
| 3500–5300 | Große Höhen |
| 5300–8850 | Extreme Höhen |
Um nicht nur pauschal von der Höhe sprechen zu müssen, hat sich in Literatur und Praxis eine Einteilung in verschiedene Höhenstufen etabliert. Die physiologischen Veränderungen sowie sonstige Auswirkungen auf den menschlichen Körper sollten immer in Bezug zur jeweiligen Höhenstufe angegeben werden (Tabelle 2.5).
2.3.2 Veränderungen im Verlauf der Akklimatisation
Wie reagiert nun aber der menschliche Körper in Hypoxie? Bereits ab 1500 m kann es bei schnellem Aufstieg mit Hilfe eines PKW oder einer Seilbahn zu leichteren Funktionseinschränkungen kommen wie z. B. beim Nachtsehen.
Als Sofortreaktion steigert der Körper bei akuter Hypoxie die Atmung, es muss also mehr Atemarbeit geleistet werden, um in der Höhe dieselbe Menge O2 aufzunehmen wie in der Ebene und dies jede Minute! Diese Hyperventilation in der Höhe ist der schnellste Anpassungsvorgang. Der verminderte O2-Partialdruck der eingeatmeten Luft kann nur über eine gemeinsame Zunahme von alveolärer Ventilation und O2-Partialdruck kompensiert werden. In Folge resultiert ein Anstieg des arteriellen pO2 und der Sauerstoffsättigung (SaO2) im Blut. Verantwortlich dafür sind sowohl die auf Sauerstoff sehr empfindlichen reagierenden Chemorezeptoren am Glomus caroticum im Bereich beider Halsarterien als auch das Atemzentrum im Gehirn.
Dies sind jedoch nur diejenigen Reaktionen des Körpers, die in akuter hypoxischer Umwelt von unserem Gehirn registriert werden. Völlig unbemerkt verlaufen jedoch dazu parallel Reaktionen auf zellulärer Ebene ab, die die Voraussetzung für die Anpassung des Körpers an die Höhe und an ein sog. Erinnerungsvermögen an die Hypoxie sind. Wer sich häufig in hypoxischer Umgebung aufhält, wird sich besser an die Höhe anpassen, als jemand, der dies nur alle paar Jahre einmal macht.
Diese Reaktionen beginnen binnen weniger Sekunden auf folgenden Ebenen:
1 Genetische Ebene:Als Reaktion auf die Hypoxie wird von der Zelle HIF-1 alpha aktiviert, dem hypoxieinduzierenden Faktor. Daraus ergibt sich die Bildung hochspezifischer Proteine, die für die Anpassung und das Gedächtnis an die Hypoxie essentiell sind. Über DNA und RNA wird die Proteinsynthese angekurbelt.
2 Zelluläre Ebene:Es kommt auf zellulärer Ebene zur Veränderung und Neubildung von Mitochondrien, den Kraftwerken der Zellen, sowie von Rezeptoren.
3 Biochemische EbeneEs entwickeln sich Anpassungsvorgänge durch die ATP-Synthese, die für die Energieversorgung des Körpers entscheidend ist, sowie bestimmte hormonelle Regulationen, aber auch die in der Hypoxie so wichtige NO-Synthese. NO wirkt gefäßerweiternd, ein Mangel in den Zellen findet sich bei bestimmten Individuen, die mit einen überschießenden Druckanstieg im Lungenkreislauf reagieren, der Ursache des Höhenlungensystems.
4 Organische EbeneErst hier kommt es zu den weiter unten beschriebenen Veränderungen im Bereich von Atmung, Herz-Kreislauf, Blut und Nieren.
5 Zentral-nervale EbeneAuf dieser Ebene laufen die Anpassungen über Nerven- und Gliazellen unseres Gehirns ab. Für eine effektive und dauerhafte Anpassung an die Hypoxie ist dies eine wesentliche Voraussetzung.
Wahrend die Veränderungen unter Punkt 1 binnen Sekunden anlaufen, dauert es bei Punkt 2 und 3 Minuten bis Stunden, unter Punkt 4 und 5 aber Tage bis Wochen.
Akute Veränderungen des Herzens
Nahezu parallel zur Hyperventilation erhöht sich die Herzfrequenz sehr schnell über eine sympathikusgesteuerte Aktivierung des vegetativen Nervensystems. Daraus resultiert eine Zunahme des Herzminutenvolumens (HMV), wobei in mittleren Höhen das Schlagvolumen (SV) weitgehend konstant bleibt.
In größeren Höhen oberhalb von 4000 m nimmt es allerdings durch eine Reduktion des Plasmavolumens mit zunehmender Höhe ab. Hyperventilation und körperliche Belastung allein können dies jedoch nicht erklären. Schlagsowie Herzminutenvolumen reduzieren sich mit zunehmender Höhe bei maximaler Belastung, da die linke Herzkammer nicht mehr optimal gefüllt wird, denn sowohl Plasma- wie auch Blutvolumen sind in der Akklimatisationsphase vermindert.
Die Veränderungen am Herzen sind also in erster Linie über eine Zunahme der Herzfrequenz und der verminderten Füllung des linken Ventrikels charakterisiert. Bei einem Verbleib auf gleicher Höhe nähert sich der Ruhepuls in den folgenden
3 bis 5 Tagen langsam wieder dem Ausgangsruhewert an. Allerdings gilt dies nur für mittlere Höhen, in den Regionen oberhalb von 7000 m ist eine völlige Normalisierung der Herzfrequenz in Ruhe nicht mehr möglich.
Hinweis: In der Höhe ist die Herzfrequenz nicht beliebig steigerbar. Ihre maximal mögliche Zunahme unter Belastung korreliert mit der Höhe. So hat ein 30-jähriger Mann auf Meereshöhe einen (altersabhängigen) Maximalpuls von etwa 190/min, entsprechend der nicht sehr exakten Formel: Maximalpuls = 220 – Lebensalter.
Auf Everestniveau beträgt der Maximalpuls hingegen nur noch etwa 120/min. Trotz der kontinuierlichen Zunahme der Sympathikusaktivität in der Höhe, reduziert sich die maximale Herzfrequenz bei weiterem Aufstieg. Als Ursache wird eine Downregulation der β-Rezeptoren des Herzen sowie ein Anstieg des Vagotonus, dem Gegenspieler des Sympathikus, diskutiert. Ein weiterer, gut nachvollziehbarer Grund könnte sein, dass eine niedrigere Herzfrequenz unter Belastung zu einem niedrigeren Blutfluss in der Lunge führt, wodurch sich längere Oxygenierungszeiten für die Erythrozyten ergeben, womit sich die O2-Versorgung der Zellen unter Hypoxiebedingungen verbessert.
Unbekannt ist allerdings, ab welcher Höhe die maximale Herzfrequenz abnimmt und wie viele Stunden in Hypoxie dafür erforderlich sind. Bei Untersuchungen auf 4000 m Höhe fand sich weder eine Abnahme der maximalen Herzfrequenz noch des Minutenvolumens. Gewisse Effekte in der Reduktion der maximalen Herzfrequenz ließen sich in einer Studie ab etwa 4–8 Stunden nachweisen, um in den nächsten Tagen weiter kontinuierlich abzunehmen.
Abb. 2.5: Bei Ankunft in der Höhe steigt die Herzfrequenz in der Akutphase an, um sich in den nächsten Tagen wieder langsam dem Ruheausgangswert zu nähern. Parallel dazu verläuft die Akklimatisation. Erst wenn der Puls wieder deutlich rückläufig ist, befindet sich der Körper im grünen Bereich und ein weiterer Aufstieg kann erfolgen
2.3.3 Chronische Höhenexposition
In fließendem Übergang geht die Akutphase in einen chronischen Verlauf der Akklimatisation über. Damit verbunden sind vielfältige Reaktionen und physiologische Abläufe im Körper, die aber in ihren Einzelheiten bis heute noch nicht alle erforscht und verstanden sind. Die wichtigsten Anpassungsvorgänge betreffen das
■ hämatologische,
■ pulmonal-ventilatorische und
■ kardiovaskuläre
System, was im Folgenden näher dargestellt wird.
Hämatologische Anpassungen
Der O2-Transport im Blut erfolgt durch eine Bindung des Sauerstoffmoleküls an das Hämoglobin in den roten Blutkörperchen. Bei Höhenaufenthalten müssen deshalb sowohl das Hämoglobin als auch Serumeisen im Normbereich liegen. Eine Blutarmut während eines Höhenaufenthalts geht zwangsläufig mit Leistungsverlust und Atemnot einher.
Hinweis. Schon in mittleren Höhen entwickelt sich in den ersten 2–4 Tagen eine inverse Relation zwischen der Hämoglobinkonzentration und dem Plasmavolumen. Das Hämoglobin erhöht sich durch eine Reduktion der Plasmaflüssigkeit, eine Eindickung des Blutes ist die Folge. Ausreichende Trinkmengen wirken dem entgegen ( s. Kap. Trinkmenge).
Die Zunahme des Hämoglobins in den ersten Tagen eines Höhenaufenthaltes hat also nichts zu tun mit einer gesteigerten Erythrozytenproduktion im Blut, wie Sportler dies für ihre Leistungssteigerung im Rahmen eines Höhentrainings ausnützen. Eine signifikante Zunahme der Masse an Erythrozyten ist frühestens nach 3 Wochen im Blut nachweisbar. Zu spät, um bei Trekkingtouren daraus noch einen Nutzen ziehen zu können.
Erythropoietin (EPO)
Nach den ersten 4–6 Tagen in der Höhe findet man im Blutbild jedoch eine Zunahme der Retikulozyten, die Vorstufen der roten Blutkörperchen. Die Hypoxie ist hierfür der entscheidende Stimulus, sie kurbelt die Erythropoese an. Hinzu kommt ein Anstieg des überwiegend in der Niere produzierten Hormons Erythropoietin (EPO). Nach kurzer Zeit erreicht es sein Maximum im Serum, um dann wieder kontinuierlich abzufallen, auch wenn der Aufenthalt in der Höhe weiter andauert. Seine Höhe ist abhängig vom Grad der Hypoxie.
Hinweis. Eine Substitution von EPO, um eine Leistungssteigerung beim Höhenbergsteigen zu erzielen, wäre nicht nur Doping, sondern ein äußerst riskantes und potenziell tödliches Experiment.
Wie schon ausgeführt, reduziert sich das Plasmavolumen in der Höhe, eine zusätzliche, schnelle Zunahme von roten Blutkörperchen würde die Fließeigenschaften des Blutes noch weiter verschlechtern. Erfrierungen und ein extrem hohes Risiko für Thrombosen und Lungenembolien wären unweigerlich die Folge!
Sauerstoffbindungskurve und 2,3-Diphosphoglyzeratspiegel
Zwei weitere Anpassungsmechanismen spielen sich im Erythrozyten selbst ab, dargestellt durch die Sauerstoffbindungskurve sowie eine Zunahme der Konzentration von 2,3-Diphosphoglyzerat (2,3-DPG) im Erythrozyten.
Abbildung 2.6 zeigt die charakteristische S-förmige Sauerstoffbindungskurve. Sie stellt den Zusammenhang her zwischen dem O2-Partialdruck in den Lungenbläschen und der Affinität des O2-Moleküls zum Hämoglobin.
Abb. 2.6: S-förmig gebogene Sauerstoffbindungskurve
Der rechte obere flache Anteil vermittelt die Bedeutung in den mittleren Höhen, er geht dann über in einen mittleren, steilem Verlauf, der sich wiederum abflacht und hier die Veränderungen in großen und extremen Höhen beschreibt.
Anhand dieser Kurve lässt sich die O2-Affinität während der akuten Anpassungsphase darstellen. Die Kurve wird durch Veränderungen des pH-Wertes, dem pCO2, 2,3-DPG und der Temperatur beeinflusst.
In den mittleren Höhen entwickelt sich schon nach wenigen Stunden eine über Tage fortbestehende Rechtsverschiebung der Kurve. Im flachen oberen Teil ist die arterielle O2-Sättigung fast normal. Durch Rechtsverschiebung wird im kapillaren Bereich der Gewebe die O2-Abgabe gesteigert. Diese Zunahme bedeutet eine bessere Versorgung der Zellen mit Sauerstoff in mittleren Höhen, durch eine leichtere Diffusion des Sauerstoffmoleküls ins Gewebe bei einem höheren O2-Druck (pO2) im Kapillargebiet. In Höhen von > 5000 m verschiebt sich unter dem Einfluss der respiratorischen Alkalose die Kurve nach links. Trotz kontinuierlich weiterer Abnahme des pO2 in den Lungenalveolen sorgt die Linksverschiebung für eine immer noch ausreichende Sauerstoffaufnahme.
Hinweis. Rechtsverschiebung bedeutet also verbesserte Abgabe von Sauerstoff in die Zellen, Linksverschiebung eine verbesserte Zufuhr von Sauerstoff trotz sich verschlechternder äußerer Bedingungen.
2,3-Diphosphoglyzerat (2,3-DPG) steigt schon in den mittleren Höhen schnell an und setzt die Affinität des O2 zum Hämoglobinmolekül herab, das heißt, das Sauerstoffmolekül kann leichter in die Zellen des Gewebes abgegeben werden. Es unterstützt damit die Wirkung der Rechtsverschiebung der O2-Bindungskurve.
pH-Veränderungen in der Höhe
In großen Höhen verschiebt sich der pH-Wert im Blut als Folge einer vermehrten Abatmung von CO2. Ursache ist die respiratorische Alkalose bei Hyperventilation. Die damit verbundene Linksverschiebung der Sauerstoffkurve erhöht zwar kurzzeitig die Affinität von O2 zum Hämoglobin, aber der 2,3-DPG-Anstieg kompensiert dies, wodurch O2 in der Höhe in der Folge besser abgegeben werden kann.
Die O2-Affinität ist in der Höhe gesteigert durch die Alkalose und Hypokapnie und wirkt so einer wesentlichen Abnahme der arteriellen Sauerstoffsättigung entgegen.
In großen und extremen Höhen führt neben der Abnahme des Plasmavolumens auch die langsame Zunahme der Erythrozyten zu einer besseren Sauerstofftransportkapazität.
2.3.4 Veränderungen im Flüssigkeitshaushalt
In mittleren, aber v. a. in den großen und extremen Höhen ist der menschliche Körper in einem hohen Maß äußeren Einflüssen ausgesetzt. Diese beeinflussen die Veränderungen im Flüssigkeitshaushalt des Körpers mit. In der Höhe reduzieren sich:
■ Sauerstoffpartialdruck,
■ Luftdichte,
■ Luftfeuchtigkeit,
■ Wasserdampfdruck,
■ Temperatur.
Die UV-Strahlung nimmt mit der Höhe aber zu. Diese äußeren Veränderungen und die körperlichen Anstrengungen eines Aufenthalts in der Höhe, ziehen Verschiebungen im Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt des Menschen nach sich.
Über die Atmung und Schweißdrüsen der Haut verliert der Körper in der extrem trockenen Luft großer Höhen Flüssigkeit und Elektrolyte. So reduziert sich in der Akutphase der Höhenanpassung das Plasmavolumen in Höhen zwischen 3000–4000 m innerhalb von 24–48 Stunden um 500–1000 ml, was zu einer Erhöhung des Hämatokrits führt. Die genaue Ursache der Abnahme des Plasmavolumens ist unklar, der Flüssigkeitsverlust allein kann dafür nicht verantwortlich sein. In der Literatur wird ursächlich auch eine Verminderung von Plasmaproteinen diskutiert.
Bedeutung der Höhendiurese und deren Auswirkung
Hinweis. Die Höhendiurese ist typisch und durchaus sinnvoll in der Anpassungsphase des Körpers an die Höhe. Schon ab mittleren Höhen stellt sich eine individuell unterschiedliche nächtliche Diurese ein, die zu einer Minderung der Schlafqualität führen kann. In großen Höhen ist es normal, nachts zwischen 1 und 1,5 Liter auszuscheiden. Die individuellen Mengen sind aber recht unterschiedlich.
Die Verminderung des Plasmavolumens erhöht den Hämatokrit, was zu einer Verbesserung der Sauerstofftransportkapazität und damit der Leistungsfähigkeit in der Höhe führt. Dies ist eine sinnvolle und normale physiologische Reaktion des menschlichen Körpers. Andererseits ist eine Urinausscheidung < 500 ml immer ein Warnsymptom für evtl. sich anbahnende Höhenerkrankungen (s. dort)!
Über die Niere verliert der Körper als Folge der zu kompensierenden respiratorischen Alkalose Bikarbonat. Aldosteron, ein Hormon, ist in Hypoxie vermindert. Dies führt zur Abnahme von NaCl und Wasser im Flüssigkeitshaushalt. Andererseits wirkt körperliche Belastung diesem Effekt entgegen. Dadurch erhöht sich der Aldosteronspiegel, so dass Natrium und Wasser wieder rückresorbiert werden.
Unter Hypoxie und körperlicher Belastung kommt es zu einer Natriumretention. Ursächlich wird ein Anstieg des atrialen, natiuretischen Peptids (ANP) angenommen, was sowohl eine Zunahme von interstitiellem als auch Plasmavolumen zur Folge hat. Ein nicht kompensierter Flüssigkeitsverlust in der Höhe geht mit einer Abnahme des Schlagvolumens sowie reflektorischem Anstieg der Herzfrequenz einher. Sie ist in der Akklimatisationsphase zwar immer erhöht, es würde jedoch ein überproportional hoher Puls resultieren.
Abb. 2.7: Urinflasche beim Trekking in Nepal (Foto: U. Gieseler)
Hinweis. Mangelnde Flüssigkeitszufuhr senkt die Leistungsfähigkeit. Bei allen körperlichen Belastungen müssen dem Körper ausreichende Trinkmengen zugeführt werden, um eine Leistung über viele Stunden erbringen zu können.
Für längere Höhenaufenthalte ist eine Urinflasche (2 l) hilfreich, um nächtliche Ausscheidung zu kontrollieren und nicht bei Wind und Wetter aus dem Zelt zu müssen. Eine Weithalsflasche schafft für Männer und Frauen gleichermaßen Abhilfe (Abb. 2.7).
Flüssigkeitszufuhr in der Höhe
Ab einem Verlust von 5 % Körperflüssigkeit entwickelt sich ein starker Leistungsabfall und Lethargie, ab 10 % Gangstörungen, eine noch stärkere Abnahme ist mit dem Leben nicht mehr vereinbar. Fehlendes Durstgefühl in großen und extremen Höhen ist kein guter und verlässlicher Parameter für einen Flüssigkeitsmangel. Sowohl Hunger als auch Durstgefühl sind oft stark vermindert bis aufgehoben. Man muss sich oft zwingen, etwas zu trinken und auch zu essen.
In einer Studie fand sich ein höhenbedingter Anstieg der Leptinspiegel im Blut, einem Hormon, das den Appetit unterdrückt. Dies könnte die bekannte Appetitlosigkeit bei Höhenbergsteigern erklären.
Hinweis. Eine regelmäßige, tägliche Kontrolle der 24-Stunden-Urinausscheidung mit Hilfe einer skalierten Urinflasche ist hilfreich. Ein stark konzentrierter Urin < 500 ml pro 24 Stunden ist entweder Hinweis für eine nicht ausreichende Flüssigkeitszufuhr oder Symptom einer sich entwickelnden Höhenerkrankung (s. Kap. Höhenerkrankungen). Die Farbe des Urins ist dagegen kein verlässlicher Parameter!
Der Flüssigkeitsverlust entwickelt sich schleichend über mehrere Tage, abhängig von täglicher Trinkmenge, Lufttemperatur, körperlicher Anstrengung und dem Volumen der nächtlichen Diurese.
Eine Darminfektion in der Höhe kann dies oft noch verstärken durch einen Verlust von mehreren Litern innerhalb kurzer Zeit. Wenn Brechreiz und Übelkeit das Trinken noch erschweren, kann sich in wenigen Stunden ein kritischer Zustand entwickeln.
Intravenöse Zufuhr von Kochsalz und Glukose sowie eines Breitbandantibiotikums sind dann indiziert. Ein weiterer Aufstieg vor einer völligen Genesung muss unter allen Umständen verhindert werden.
Aus diesem Grunde ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr für die Erhaltung von Gesundheit und körperlicher Leistungsfähigkeit unverzichtbar. Die erforderliche Trinkmenge hängt von den Außentemperaturen, der körperlichen Belastung, der Höhenstufe und der Höhendiurese ab.
Hinweis. In großen und extremen Höhen sind täglich 4–6 Liter pro 24 Stunden erforderlich, was für manche Menschen oft schwierig ist. Bei Durchfallerkrankungen ist der Bedarf oft deutlich höher.
Die Angaben zur Trinkmenge in der Literatur decken sich weitgehend mit den Angaben von Höhenbergsteigern bei einer persönlichen Umfrage. Ein Aufteilen der Trinkmenge über 24 Stunden ist sinnvoll. Bei mehrfachem nächtlichem Harndrang nutzt man das Wachsein, um über Nacht bis zu 500 ml zu trinken. Bis zum Aufstehen ist so der Flüssigkeitsverlust teilweise kompensiert. Den Rest verteilt man über den Tag.
Bedeutung peripherer Ödeme
Hinweis. Flüssigkeitsansammlungen machen sich durch ein Anschwellen der Haut bemerkbar. Die Oberfläche ist mit dem Finger eindrückbar und eine Delle bleibt bestehen. Diese Ödeme sind oft beginnende Warnsymptome von Höhenerkrankungen wie AMS oder HAPE. Typischerweise sind sie im Bereich der Augen, Handrücken, Knöchel oder Unterschenkel lokalisiert.
Es konnte gezeigt werden, dass Patienten mit beginnender AMS eine verringerte Urinausscheidung, eine Wasserretention sowie eine Zunahme von antidiuretischem Hormon (ADH) aufwiesen,
Hinweis. Frauen sind nach Literaturangaben etwa doppelt so häufig von Ödemen betroffen wie Männer. Diese sind für sich allein zunächst noch nicht beängstigend, jedoch als Warnzeichen zu werten und entsprechend zu beobachten. Ihr Auftreten korreliert mit einem HAPE und HACE in der Höhe. Als begleitender Arzt sollte man immer auf Ödeme bei den Teilnehmern achten. Problematisch sind diejenigen, die so ausgeprägt sind, dass entweder das Sehvermögen bei Lokalisation im Bereich der Augenlider eingeschränkt oder aber die Blutzirkulation der Füße im Schuh behindert ist. Es besteht dann die Gefahr von Erfrierungen der Zehen.
Pulmonale Adaptation
Die Atmung spielt bei den Anpassungsvorgängen in der Höhe und während der Akklimatisation eine entscheidende Rolle. Sie besteht aus vier verschiedenen Vorgängen:
■ Ventilation mit Belüftung der Lungenbläschen,
■ Gasaustausch mit Aufnahme von Sauerstoff (O2) und Abatmung von Kohlendioxid (CO2),
■ Transport von O2 und CO2 im Blut von und zur Lunge,
■ Regulation der Atmung.
Neben den hämatologischen Anpassungen sind die Veränderungen in der Lunge ein wesentlicher Bestandteil der Akklimatisationsphase. Wie schon unter den akuten Anpassungen ausgeführt, entwickelt sich unter Hypoxie eine Hyperventilation. Die Steigerung des Atemminutenvolumens führt zu einer Zunahme der CO2-Abatmung über die Lungen und Ausbildung einer respiratorischen Alkalose im Blut.
Da der menschliche Körper auf einen sehr engen Toleranzspielraum des Säure-Basen-Haushalts programmiert ist, versucht er, die Alkalose auszugleichen. Über die Niere wird dies durch eine vermehrte Bikarbonatausscheidung kompensiert und der Gesamtplasmagehalt an Bikarbonat vermindert. Die vermehrte Ausscheidung alkalischer Substanzen justiert den pH-Wert zunächst wieder im Normbereich.
Dieser Effekt ist jedoch nur in mittleren Höhen nachweisbar und nach etwa 24 Stunden komplett abgeschlossen. In großen Höhen sind Hypokapnie und respiratorische Alkalose so stark ausgeprägt, dass eine totale Kompensation über die Niere nicht mehr möglich ist und eine Alkalose über den gesamten Höhenaufenthalt nachweisbar bleibt.
Hypoxic Ventilatory Response (HVR)
Die HVR beschreibt das individuelle Ansprechen des Atemzentrums auf die Hypoxie in der Höhe. Sie ist in ihrer Bedeutung für Höhenerkrankungen bisher nicht in allen Einzelheiten geklärt.
Die durch Hypoxie gesteigerte Atmung ist eine Folge des abnehmenden Sauerstoffpartialdruck mit zunehmender Höhe. Das Ansprechen der HVR geschieht als Sofortreaktion über das Glomus caroticum der Halsschlagadern und dem Atemzentrum.
Die HVR lässt sich im Labor zwar messen, lässt aber leider keine individuelle Vorhersage zu, ob eine bestimmte Person ein erhöhtes Risiko hat, während eines Höhenaufenthaltes zu erkranken. Auch lassen sich die Werte im Labor und in der Höhe nicht wirklich vergleichen. Ein Labortest findet unter den Bedingungen einer normobaren Hypoxie statt, in der Natur besteht aber eine hypobare Hypoxie, wahrscheinlich sind die Testergebnisse unterschiedlich.
Man weiß jedoch, dass eine niedrige HVR mit einer vermehrten Anfälligkeit für eine Schlafapnoe in der Höhe assoziiert ist, also längeren Atempausen im Schlaf. Die HVR eines Menschen wird durch Alkohol, Schlafmittel und Codein (z. B. in Medikamenten gegen Husten) negativ beeinflusst. Während eines Höhenaufenthalts sollte deshalb auf Schlafmittel oder größere Alkoholmengen verzichtet werden, auch auf alpinen Berghütten!
Nach heutigem Wissen geht man davon aus, dass eine niedrige HVR sowohl mit einer erhöhten Anfälligkeit für ein HAPE als auch mit einer AMS assoziiert ist. Die Literaturangaben sind jedoch sehr widersprüchlich bezüglich der erhöhten Anfälligkeiten bei niedriger HVR, einige beziehen sie nur auf das HAPE, andere nur auf die AMS. Die HVR lässt sich zwar für jeden Menschen im Labor bestimmen, der Vorhersagewert von 64 % gestattet jedoch keine scharfe Trennung zwischen anfälligen und nicht anfälligen Individuen, denn der Wert liegt ja etwa in der Größenordnung von Wappen oder Zahl einer Münze. Sicherer und billiger ist ein langsamer Aufstieg zusammen mit einer Vorakklimatisation.
Bei extrem ausdauertrainierten Läufern findet sich nach übereinstimmenden Literaturangaben eine niedrige HVR als Folge eines intensiven und lange anhaltenden Ausdauertrainings, wie z. B. bei Marathonläufern. Dies erklärt die schlechte Höhenverträglichkeit von Ausdauersportlern. Sie müssen gerade in den ersten Tagen eines Höhenaufenthaltes ganz bewusst langsam aufsteigen und sollten sich nicht überfordern (s. Kap. Bergsport).
2.3.5 Langzeitfolgen des Höhenaufenthalts
Neben dem schon beschriebenen Anstieg der Herzfrequenz in der Höhe durch Sympathikusaktivierung finden noch weitere Anpassungsvorgänge statt.
Blutdruck und pulmonale Hypertonie
Der Blutdruck ist in der Regel in den mittleren Höhen nicht erhöht. Anders kann dies jedoch in großen und extremen Höhen sein, wo er gelegentlich schon ansteigt. Die Ursache ist das autonome Nervensystem mit einer Aktivierung des Sympathikus, was zur Widerstandserhöhung im großen Kreislauf führt. Auf die speziellen Probleme von Höhe und Blutdruck wird im Kapitel über Risikogruppen und Hypertonie näher eingegangen.
Aber nicht nur der systemische Blutdruck steigt in der Höhe an. Im Lungenkreislauf finden ebenfalls Anpassungsvorgänge statt. Ein überschießender pulmonaler Hochdruck kann zu einem Lungenödem (HAPE) führen. Insofern sind die im Folgenden beschriebenen Veränderungen des kleinen Kreislaufs für das Verständnis der Pathophysiologie des Höhenlungenödems (HAPE) von entscheidender Bedeutung.
Pulmonale Hypertonie
Unter Hypoxie steigt bei jedem Menschen der Widerstand in den Lungengefäßen an. Die Folge ist ein pulmonaler Hochdruck. Dies ein normaler physiologischer Vorgang, der lange bekannt ist und noch nichts mit einem Lungenödem zu tun hat.
Bereits 1946 fanden Euler und Liljestrand an Katzen, dass diese unter normobarer Hypoxie einen erhöhten Druck in ihren Lungengefäßen aufbauen. Ursache ist eine Vasokonstriktion, also Engstellung der Gefäßmuskulatur in den kleinen Lungengefäßen, Arterien von < 0,8 mm Durchmesser. Das Ausmaß der Vasokonstriktion war in diesem Versuch abhängig vom Restsauerstoff der zugeführten Luft. Diese Veränderungen sind unabhängig von der hypoxischen Sympathikusaktivität, sie entstehen allein unter Hypoxie durch die Gefäßmuskulatur der Lungengefäße.
Die Vasokonstriktion der Lungenarteriolen gleicht über einen erhöhten Druck die Perfusions-Ventilations-Verhältnisse in der Lunge aus, so dass eine gleichmäßigere Blutverteilung resultiert. Diese Umverteilung des Blutflusses vermindert zusätzlich funktionelle arteriovenöse Shunts. In ihrer Gesamtheit führen diese Veränderungen zu einer besseren O2-Aufnahme.
Andererseits entwickelt sich durch diese Umverteilung eine Überlastung von Arteriolen in manchen Lungenarealen. Nicht alle sind aber gleichermaßen davon betroffen, manche Abschnitte eben mehr, andere weniger. In überlasteten Gebieten entwickelt sich bei anhaltender pulmonaler Hypertonie ein Flüssigkeitsaustritt in die angrenzenden Alveolen oder in das umgebende Gewebe, so dass im weiteren Verlauf ein komplettes Ödem entsteht, das Höhenlungenödem (HAPE).
Zum Verständnis des HAPE sind die pathophysiologischen Zusammenhänge enorm wichtig, vor allem, dass es sich nicht um ein primär kardiales Problem handelt mit der Konsequenz, dass Diuretika kontraindiziert sind. Wenngleich es sich hierbei um ein multifaktorielles Geschehen handelt, die pulmonale Hypertonie ist nur einer von vielen Bausteinen, wenn auch aus therapeutischer Sicht sicherlich der Wichtigste, in einem komplexen System pathophysiologischer Abläufe, die in allen Einzelheiten bis heute noch nicht vollständig erforscht sind (Abb. 2.8). Viele Fragen zum Verständnis können daher noch nicht abschließend beantwortet werden.
Abb. 2.8: Schematische Darstellung der Entwicklung des Höhenlungenödems in vereinfachter Form
Die Zusammenhänge zwischen Hypoxie und pulmonaler Hypertonie wurden in den letzten Jahren sowohl im Labor und in größeren Höhen am Menschen direkt untersucht. Durch Messungen mittels Rechtsherzkatheter, Dopplerechokardiografie sowie nuklearmedizinische Untersuchungen, u.a. in der Schweiz auf der Cabana Margherita in 4600 m Höhe, konnten wesentliche Zusammenhänge über die pulmonale Hypertonie und das HAPE gewonnen werden. Die Echokardiografie als nichtinvasives Verfahren eignet sich zum Nachweis einer pulmonalen Hypertonie. Der erhöhte Druck im Lungenkreislauf kann über eine echokardiografisch nachweisbare Trikuspidalinsuffizienz gemessen werden, die abhängig vom Ausmaß der Druckerhöhung ist (Abb. 2.9).
Abb. 2.9: Pulmonale Hypertonie von 72 mmHg und Trikuspidalinsuffizienz im Farbdoppler bei einem Patienten mit pulmonaler Hypertonie (Foto: U. Gieseler)
Diese Untersuchungen haben nicht nur zum pathophysiologischen Verständnis beigetragen, sondern auch die Therapie des HAPE wesentlich beeinflusst. Dopplerechokardiografisch konnte gezeigt werden, dass eine bestimmte Gruppe von Medikamenten, sog. Kalziumantagonisten (Nifedipin) den erhöhten Druck in der Lungenstrombahn beim HAPE senken und sich somit nicht nur zur Therapie, sondern auch zur Prophylaxe eignen.
Hinweis. Körperliche Belastung, wie z. B. das Tragen schwerer Lasten (Rucksackgewicht!), Einatmen von kalter Luft sowie flaches Liegen in einer Hütte oder einem Zelt erhöhen den pulmonal-arteriellen Druck. Deshalb wirken Schlafen mit erhöhtem Oberkörper in großen und extremen Höhen oder ein nur leichter Rucksack einem HAPE entgegen.
Pulmonale Hypertonie bei Hochlandbewohnern
Bewohner großer Höhen, wie in den Anden oder Tibet, entwickeln im Laufe ihres Lebens ebenfalls eine pulmonale Hypertonie, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Während sich bei Tibetern, dem am längsten in der Höhe wohnenden Volk, kaum Veränderungen durch eine pulmonale Hypertonie nachweisen lassen, kommt es bei Andenbewohnern zu deutlichen Druckanstiegen und nach Jahrzehnten auch zu verdickten Gefäßwänden. Wahrscheinlich spielen hier genetische Unterschiede eine Rolle, wie dies auch in unseren Breiten von Bewohnern im Flachland vermutet wird.
Hinweis. Es ist immer noch unklar, warum manche Menschen in der Höhe eine überschießende pulmonale Hypertonie entwickeln und schon in Höhen unter 4000 m ein HAPE bekommen und somit anfällig sind für ein Lungenödem. Andere hingegen belasten sich in der Höhe extrem stark, tragen z. B. schwere Rucksäcke, ohne jemals ein HAPE bekommen zu haben. Vermutlich bestehen hier genetische Unterschiede für die Anfälligkeit eines Lungenödems.
Ein besonderes Risiko besteht für die Menschen, die schon mal einmal ein HAPE in der Vorgeschichte hatten, insbesondere, wenn es schon in Höhen unter 4000 m auftrat (s. Kap. Höhenerkrankungen).
Weiterführende Literatur
Bärtsch P, Saltin B: General introduction to altitude adaptation and mountain sickness. Scand J Med Sci Sports 2008; 18 (Suppl. 1): 1–10.
Kompaktinformation
Ein Höhenaufenthalt löst im menschlichen Körper verschiedene physiologische Reaktionen aus. Diese Veränderungen betreffen
■ das Herz-Kreislauf-System,
■ den Gasaustausch in den Lungen,
■ Veränderungen im Blut und den Erythrozyten,
■ den Flüssigkeitshaushalt,
■ die Nieren,
■ das Hormonsystem.
Zu unterscheiden ist zwischen akuten Veränderungen innerhalb der ersten Minuten in ungewohnter Höhe sowie chronischen Abläufen bei Aufenthalten über mehrere Wochen und Monate.
Diese Kenntnisse sind zur Akklimatisation während Höhenaufenthalten hilfreich, um nicht durch höhentaktische Fehler krank zu werden. Viele dieser physiologischen Abläufe im Körper bemerkt man als Bergsteiger nicht.
Zwei typische Veränderungen treten allerdings innerhalb von Minuten auf.
■ Anstieg der Herzfrequenz,
■ Zunahme der Atemfrequenz.
Berghold F (Hrsg.): Lehrskriptum der Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin, 2008.
Domej W, Schwaberger G: Repetitorium der Höhenphysiologie. Alpinmed Rdbr 2008; 39: 3–5.
Hornbein T, Schöne R: High altitude. New York: Marcel Dekker, 2001.
Hultgren H: High altitude medicine. Stanfort: Hultgren Publications, 1997.
Ward MP, Milledge JS, West JB: High altitude medicine and physiology, 3rd edn. London: Hodder Arnold, 2001.
2.4 Blutgase und Säure-Basen-Haushalt
W. Domej
2.4.1 Änderung bei akuter Höhenexposition
Eine kurzfristige Anpassung an die Höhe bedeutet Stress, bei der sowohl der Kreislauf als auch die Atmung gefordert werden.
Bei entsprechender Hyperventilation kann die Höhenhypoxie bis zu einem bestimmten Grad ausgeglichen werden, sie führt allerdings auch zu Änderungen des Säure-Basen-Haushalts im Sinne einer respiratorischen Alkalose (Höhenalkalose). Diese bedingt, dass die Affinität des Hämoglobins zum angebotenen alveolären Sauerstoff zunimmt. Andererseits kommt es im Rahmen der Alkalose auch zu einem weniger erwünschten Effekt: Die Sauerstoffabgabefähigkeit des Hämoglobins in peripheren Geweben nimmt dabei ab.
Die Beziehung zwischen arterieller Sauerstoffsättigung (SaO2) und dem arteriellen Sauerstoffpartialdruck (paO2) ist nicht linear (O2-Dissoziationskurve). Das bringt in Bezug auf akute Hypoxieeinwirkung den Vorteil, dass beispielsweise auf einen 50%igen Abfall des paO2 in 5500 m Höhe nicht gleich ein 50%iger Abfall der Sauerstoffsättigung des Hämoglobins folgt oder dass eine akut krankheitsbedingte Verminderung des paO2 beispielsweise im Rahmen eines Höhenlungenödems nicht zwangsläufig zu einer lebensbedrohlichen Sauerstoffentsättigung führt (s. Abb. 2.6). Als bedeutsame Einflussfaktoren auf die Beziehung von paO2 und SaO2 gelten bekannterweise die H+-Ionenkonzentration (pH-Wert), die Körpertemperatur, der paCO2 und der 2,3-DPG-Gehalt der Erythrozyten, wobei eine Rechtsverschiebung der Sauerstoffdissoziationskurve durch eine Erhöhung, eine Linksverschiebung durch einen Abfall obiger Parameter hervorgerufen wird.
Die initiale Höhenalkalose führt zu einer Linksverschiebung der Sauerstoffbindungskurve. Bereits nach einem wenige Stunden dauernden Höhenaufenthalt erfolgt eine Rechtsverschiebung der O2-Bindungskurve und Abnahme der O2-Affinität, wobei vor allem das erythrozytäre Glykolyseprodukt 2,3-Diphosphoglyzerat (2,3-DPG) eine maßgebende Rolle spielt. Durch Bindung vor allem an reduziertes Hämoglobin vermag 2,3-DPG die O2-Affinität im Bereiche der alveolokapillären Diffusionsstrecke herabzusetzen. Dabei verbessert sich die Abgabefähigkeit des Hämoglobins für O2 in den peripheren Geweben.
2.4.2 Respiratorische Veränderung im Laufe der Akklimatisation
Im Rahmen eines längeren Höhenaufenthaltes bildet sich die initiale Stresssituation zeitabhängig zurück, das heißt auch, dass sich die Atemsowie Herz-Kreislauf-Funktion auf einem deutlich niedrigeren Niveau einpendeln und sich die Alkalose durch verstärkte renale Bikarbonatausscheidung und tubuläre Rückresorption von H+-Ionen rückläufig verhält. Die Sauerstoffversorgung wird im Vergleich zur Ankunft in der Höhe im Verlauf von 2–3 Wochen auch durch eine Zunahme der Erythrozytenmasse erhöht. Damit verbessert sich auch die physische Leistungsfähigkeit, abzüglich des 10%igen Höhenleistungsverlusts (VO2max) pro 1000 Höhenmeter. In etwa dem gleichen Zeitraum tritt eine Verschiebung der HVR ein („ventilatorische Akklimatisation“). Diese führt zu einer Verbesserung der Sauerstoffsättigung um bis zu 10 %. Als ein weiteres erkennbares Zeichen der Akklimatisation gilt ein verbesserter Nachtschlaf sowie die Abnahme nächtlicher periodischer Atemmuster (Cheyne-Stokes-Respiration/CSR: kurze zentrale Apnoen < 10 sec sowie Hypopnoen), verbunden mit einer verbesserten Sauerstoffsättigung des Hämoglobins.
Abb. 2.10: Fingerpulsoximetrie zur perkutanen Messung der Sauerstoffsättigung (SaO2) und des peripher-arteriellen Pulses (Foto: W. Domej)
Heute ist es relativ leicht, die Sauerstoffsättigung transkutan zu messen und dabei den Akklimatisationseffekt nachzuvollziehen (Abb. 2.10).
Hinweis. Die nichtlineare Beziehung zwischen paO2 und SaO2 bildet die Grundlage, dass sich der Mensch akut in großen und extremen Höhen aufhalten kann. Mit zunehmendem Akklimatisationsgrad wird die respiratorische Alkalose durch die Niere (erhöhte Bikarbonatausscheidung) kompensiert. Die initial nach links verschobene Sauerstoffdissoziationskurve im Rahmen der Sofortreaktion bewegt sich durch die Erhöhung des 2,3-DPG in den Erythrozyten nach rechts. Die Sauerstoffsättigung (SaO2) nimmt mit zunehmender Höhe und Belastung ab.
Weiterführende Literatur
Smith CA, Dempsey JA, Hornbein TF: Control of breathing at altitude: In: Hornbein T, Schöne R (eds.): High altitude. New York: Marcel Dekker, 2001, pp. 139–173.
2.5 Ernährung und Verdauung in großen und extremen Höhen
A. Morrison
2.5.1 Gastrointestinale Funktion
Da jegliche Nahrung zunächst einmal den Mund passieren muss, sollte man daran denken, dass rechtzeitig vor Aufbruch zu einer Bergtour oder Expedition eine zahnärztliche Überprüfung durchgeführt und alle suspekten Befunde ausreichend behandelt wurden. Das sollte alle temperaturempfindlichen Zähne sowie das Zahnfleisch einschließen.
Zu achten ist auch darauf, dass alle Vorerkrankungen, die in irgendeiner Weise mit dem Verdauungstrakt in Verbindung stehen, wie beispielsweise chronisch entzündliche Darmerkrankungen (z. B. Morbus Crohn), sich in einem absolut stabilen Stadium befinden. In akuten Krankheitsphasen sollte man keinesfalls in große Höhe gehen, erst recht nicht auf Trekkingtouren oder Expeditionen.
Oberhalb von etwa 3000 m werden die Gase des Magen-Darm-Trakts durch den verminderten äußeren Luftdruck spürbar expandieren (sog. Dysbarie). Man wird sich gebläht fühlen und eventuell satt oder appetitlos. Es ist daher sinnvoll, blähende Speisen wie Bohnen oder eine sehr faserreiche Ernährung für zwei Tage vor dem Aufstieg über 3000 m Höhe zu vermeiden. Dies werden auch die Bergkameraden, mit denen man das Zelt teilt, zu schätzen wissen. Trockennahrung sollte immer ausreichend „eingeweicht“ werden, bevor sie gegessen wird, damit sie nicht Flüssigkeit aus dem Verdauungstrakt aufsaugt und so eventuell schmerzhafte Bauchkrämpfe verursacht.
Das Risiko, als Reisender in Entwicklungsländern eine Reisediarrhoe zu erleiden, liegt abhängig von der Region zwischen 20 und 80 %. Eine gute Nahrungsmittelhygiene vermindert dieses Risiko zwar, doch auch wenn man seine Hände regelmäßig wäscht, bevor man irgendwelche Nahrungsmittel berührt oder isst, muss außerdem darauf geachtet werden, dass diese Regel auch von denen befolgt wird, die den Reisenden die Nahrung zubereiten.
Einige Gedanken zum Magen-Darm-Trakt: Würde man seine Oberfläche flach ausbreiten, so würde sie etwa die Fläche eines Tennisplatzes einnehmen. Diese Oberfläche wird sowohl von nützlichen als auch von potenziell schädlichen Bakterien besiedelt, und das Verhältnis beider zueinander beeinflusst unmittelbar die Funktion des Magen-Darm-Traktes, und zwar in jeder Höhe. Im Idealfall überwiegen die nützlichen Keime und das Organsystem befindet sich in einem leistungsfähigen Gesundheitszustand. Man könnte auch sagen, dass die Oberfläche wie ein Golfplatz aussieht, mit dem grünen Gras als Symbol für die nützlichen Bakterien wie Bifidobacillus oder Lactobacillus und den Sandbunkern als Symbol für die Nester potenziell schädlicher Keime wie Escherichia coli (Abb. 2.11). Alle Bakterien können nebeneinander und ohne Probleme für den Menschen existieren, wenn Erstere in der weit überwiegenden Mehrzahl sind. Im Falle einer schweren Diarrhoe ist dann die Mehrzahl der Bakterien zerstört, was für jeden neu eindringenden Keim geradezu perfekte Lebensbedingungen bietet. Daher sollte man möglichst schnell reagieren, um weitere Gesundheitsbeeinträchtigung und möglicherweise zukünftig eintretende Nahrungsmittelintoleranz zu vermeiden. Es sollten Elektrolytlösungen getrunken werden, um den Flüssigkeitshaushalt im Gleichgewicht zu halten (Details hierzu im Kap. „Allgemeine und Trinkwasserhygiene“, insbesondere im Abschnitt „Reisedurchfall“) und – falls möglich – zusätzlich prä- oder probiotische Nahrung gegessen werden (z. B. Joghurt oder fermentierte Produkte).
Abb. 2.11: Ein Golfplatz als Symbol für die Verhältnisse im Verdauungstrakt: Solange die nützlichen Keime (grüner Rasen) weitaus in der Überzahl und die potenziell schädlichen als lokale Nester (Sandbunker) in der Minderheit sind, ist der Platz gut bespielbar bzw. das Verdauungssystem intakt (Foto: A. Morrison)
Jüngere Forschungsergebnisse mit probiotischer Nahrungsergänzung über 5 Tage vor und während der Expedition haben gezeigt, dass so die Reisediarrhoe entweder ganz verhindert oder in ihrem Ausmaß jedenfalls reduziert werden konnte. Dieser Effekt besteht auch bei extremen Umgebungsbedingungen. Ein Präbiotikum wirkt sozusagen wie Dünger für das Wachstum nützlicher Bakterien, während Probiotika konkret entsprechende Bakterienstämme enthalten. Wissenschaftlich gut untersuchte probiotische Kulturen, die effektiv das Wachstum und die Adhäsion potenziell schädlicher Keime an die Darmwand behindern, enthalten neben anderen Saccharomyces boulardii und Enterococcus faectum SF 68. Für beide ist belegt, dass sie auch einen durch Antibiotika verursachten Durchfall verhindern oder zumindest verkürzen.
2.5.2 Leber und metabolische Funktion
Das wohl wichtigste Schlagwort in diesem Zusammenhang ist Glukose oder Glykogen. Letzteres ist die Speicherform der Glukose und wird vor allem in der Leber und in Muskeln gefunden. Glukose ist einer von vielen Zuckern und kommt in verschiedenen Nahrungsmitteln in unterschiedlicher Menge vor, beispielsweise in Brot, Nudeln, Kartoffeln, Reis, Früchten, aber natürlich auch in Schokolade und Süßspeisen. Glukose wird als nahezu einziger Brennstoff von den Erythrozyten und den Hirnzellen akzeptiert. Aus diesem Grunde versucht der Körper, die Blutglukosekonzentration weitgehend konstant zu halten. Das Leberglykogen dient normalerweise als Reserve, um die Glukosekonzentration in Blut und Muskel aufrecht zu erhalten, aber in der Höhe findet im Gegensatz zum Tal zunehmend eine primäre Mobilisation des Leberglykogens (und weniger des Muskelglykogens) statt. Falls die Glykogenspeicher entleert sind, wird zwangsläufig ein Gefühl der Müdigkeit, Kraftlosigkeit und Übelkeit aufkommen (Abb. 2.12). Diese mit relativer Hypoglykämie assoziierten Symptome machen Betroffene auch anfälliger gegenüber allgemeiner Unterkühlung (Hypothermie).
Begrenzte Glykogenvorräte befinden sich auch in der Muskulatur, denn Glukose ist der bevorzugte Brennstoff sowohl für aerobe als auch anaerobe Leistungen, insbesondere bei hohen Belastungen. Ein 68 kg schwerer Mann hat insgesamt etwa 1800 kcal Energie in Form von Glykogen gespeichert. Außerdem verfügt er über 60 000 bis 100 000 kcal Brennwert in Form von Fett.
Abb. 2.12: Regelmäßige Kohlehydrataufnahme ist auf längeren Touren ein„Muss“ – und ein besonderer Genuss an derart aussichtsreichen Frühstücksplätzen wie hier in fast 4000 m Höhe am Dent du Géant (Montblanc-Massiv) (Foto: T. Küpper)
Trotz dieses großen Unterschieds wird für die meisten körperlichen Belastungen Glukose oder Glykogen als Energielieferant bevorzugt. Umgekehrt ist das Erschöpfen der Glykogenvorräte eine der Hauptursachen für muskuläre Ermüdung. Wenn beispielsweise ein Marathonläufer nach 25–35 km seine Glykogenvorräte vollständig verbrannt hat, fühlt er sich plötzlich müde, erschöpft, atemlos und die Hypoglykämie sorgt für weitere Symptome wie Übelkeit oder Schwindel. Da es nicht möglich ist, im erforderlichen Umfang die Energie direkt aus den Fetten zu mobilisieren, muss der Läufer nun abbrechen. Das System der Fettverbrennung kann zwar riesige Energiemengen frei setzen, jedoch nur langsam, unter anderem, weil der nötige Sauerstoffnachschub für dieses sehr sauerstoffbedürftige System nicht ausreichend nachgeliefert werden kann. Man bezeichnet diese lange, aber geringe Leistungsfähigkeit auch als „niedrige Energieflussrate“.
Durch Training können alle Energiespeicher des Körpers zwar in ihrer Effektivität gesteigert werden, jedoch bleibt Glukose für höhere Leistungen der primäre Energieträger. Dies gilt um so mehr in der Höhe, wo der Sauerstoffnachschub zusätzlich durch den verminderten Partialdruck reduziert ist. Körperliche Belastungen werden hier für jeden spürbar erheblich anstrengender als im Tal – oder sind sogar unmöglich.
Durch Training kann das Muskelvolumen und damit der Glykogengehalt erheblich zunehmen. So kann der Glykogengehalt um 20–50 % steigen, jedoch nur dann, wenn man auch genug und regelmäßig Kohlehydrate isst. Wie Muskelbiopsien vor und nach erschöpfender Belastung gezeigt haben, kann es 2–5 Tage dauern, bis die Glykogenspeicher wieder komplett aufgefüllt sind, natürlich abhängig davon, was man vor und nach einer derartigen Belastung isst. Isst man fett- oder proteinreich, so wird die Speicherfähigkeit sowohl vermindert als auch verzögert.
Daher sollte die Nahrung unbedingt kohlehydratreich sein, insbesondere vor und nach einer größeren Berg- oder Trekkingtour. Kohlehydrate sollten in der Höhe 50–65 % der täglichen Kalorienaufnahme ausmachen.
Hinweis: Ein untrainierter Muskel enthält 13 g Glykogen pro 100 g Muskelgewebe, ein trainierter dagegen 32 g. Durch „Carboloading“ (erschöpfende Belastung 4 Tage vor einer Wettkampfbelastung und maximal kohlehydratreiche Ernährung in den Folgetagen kann sogar ein Gehalt von 35–40 g erreicht werden.
2.5.3 Energiebedarf
Die erfolgreiche Planung einer Expedition oder gar das Überleben ist unmittelbar davon abhängig, ob man zum richtigen Zeitpunkt ausreichend Nahrung und Flüssigkeit zur Verfügung hat. Auch wenn komplexe physiologische Adaptationsmechanismen einen Einfluss auf die Entscheidung haben, in großer Höhe zu essen oder zu trinken und raue Umweltbedingungen dies zu einer echten Herausforderung werden lassen können, bleibt auch nach über 50 Jahren wissenschaftlicher Untersuchungen zum Thema „Ernährung in der Höhe“ eine banale Weisheit, die wir alle bereits aus Meereshöhe kennen: Wenn man nicht genug isst, um die verbrannten Nährstoffe zu ersetzen, dann wird man an Gewicht verlieren und falls man zu viel isst, wird man zunehmen. So einfach bleibt das auch in der Höhe. Da dort jedoch ein erhöhter Bedarf besteht, sollte man sich Gedanken zur Abschätzung eben dieses Bedarfs und wie man ihm gerecht wird machen. Jegliche Nahrung versorgt uns mit „Energie“ oder Kalorien (kcal). Gesundheit und gute Leistungsfähigkeit besteht dann, wenn genug von der richtigen Nahrung zum richtigen Zeitpunkt zugeführt wird. Allerdings bestehen bei der Organisation der Expeditionsernährung mehrere Probleme:
1 Viele Bergsteiger wissen schlicht nicht, ob sie sich gesund (bilanziert) ernähren.
2 Es besteht Unkenntnis, wie man die Ernährung an die Höhe anpasst.
3 Bergsteiger sind evtl. Personen, die noch nicht einmal in Meereshöhe in der Lage sind, sich aus Grundstoffen ein schmackhaftes Essen zusammenzustellen und sind mit einem Benzinkocher allein in der Höhe diesbezüglich erst recht hilflos!
Schaut man sich z.B die Internetseiten, die am Ende des Kapitels aufgeführt sind, an, kann man den ersten Punkt in den Griff bekommen und durch das Lesen dieses Kapitels den zweiten. Der dritte Punkt aber kann nur durch den Erwerb grundlegender Kochkenntnisse – rechtzeitig und in Meereshöhe – bewältigt werden. Man sollte testen, wie man ein kohlehydratreiches Nudel- oder Kartoffelgericht zubereitet und auf verschiedene Weise würzt.
Hinweis. Immer daran denken: In der Höhe sollten 50–65 % der täglichen Kalorien aus Kohlehydraten stammen!
Mit grundlegenden Kochkenntnissen ist man auch in der Lage, frische Nahrungsmittel auf örtlichen Märkten zu kaufen und variationsreich zuzubereiten, was unmittelbar die Erfordernisse und persönlichen Vorlieben befriedigt und von oft wenig schmackhaften und teuren Fertigprodukten unabhängig macht.
Die Zusammensetzung der Nahrung muss zwar sorgfältig geplant werden, dies allein macht jedoch noch keine exzellente Expeditionsplanung. Zu dieser gehört unbedingt, dass man darauf achtet, dass die Nahrung auch leicht zuzubereiten ist. Vom Militär ist bekannt, dass die Soldaten beim Öffnen einer Tagesration zuerst diejenigen Bestandteile verwerfen, die sie nicht mögen (10–30 %). Dies führt zwangsläufig zu einem Energiedefizit. Soldaten unterscheiden sich dabei nicht von irgendeinem anderen Menschen, der von Rationen leben muss, die er nicht für sich selbst zusammengestellt hat. In den meisten Fällen wird man nicht essen, was man nicht mag. Bei der Expeditionsplanung sollte also berücksichtigt werden, dass die Teilnehmer persönliche Vorlieben und Abneigungen haben. Außerdem können medizinische oder religiöse Gründe für das Meiden gewisser Nahrungsmittel vorliegen. Bei der Entscheidung des Nahrungsmittelkaufs für die Expedition sollte man solche bevorzugen, die von allen gemocht werden. Und auf keinen Fall sollte man nur eine Sorte einkaufen, denn Variabilität in der Nahrung ist ein wichtiger Faktor, sowohl für die Gesundheit als auch die Genießbarkeit und um Langeweile zu vermeiden.
Da Kohlehydrate 50–65 % der täglichen Energiezufuhr ausmachen sollten (deren Wichtigkeit wurde in den vorangegangenen Abschnitten ausführlich dargestellt), wäre es schlicht wahnsinnig, auf eine Expedition zu gehen, bei der die Hauptquelle für Kohlehydrate in Reis besteht, wenn man Reis hasst. Diese Situation wird zwangsläufig zu Gewichtsverlust, nicht optimaler Leistungsfähigkeit und vielleicht auch zum Fluchen während der Expedition führen. Es ist völlig witzlos, Essen mitzuführen, das nicht gegessen wird. Leider ist dies eine sehr häufige Situation auf Trekkingtouren oder Expeditionen. Wenn möglich, sollte jegliche Nahrung, die man unterwegs essen möchte, vor Aufbruch ausprobiert worden sein. Dabei lagere man sie auch bei Temperaturen, bei denen man unterwegs sein wird, um zu prüfen, ob sie genießbar bleibt. Sollte man Fertiggerichte, Kohlehydratgele oder andere Nahrungsmittel in Meereshöhe nicht mögen, wird sich das auch in der Höhe garantiert nicht ändern!
Hinweis. Zu beachten ist auch, dass sich ein Aufenthalt in extremer Höhe nicht dazu eignet, eine gewollte Gewichtsabnahme zu erreichen, denn die Gewichtsabnahme in großer Höhe betrifft überwiegend (bis 70 %) die fettfreie Körpermasse, also Muskeln und Wasser, und dann erst das Fett. Dies gilt zumindest für Kaukasier (Europäer, Amerikaner). Sherpas können dagegen auch in extremer Höhe sowohl Körperfett als auch Bauchumfang praktisch konstant halten.
Ein gewisser Gewichtsverlust ist in großer Höhe praktisch unvermeidlich. Ab etwa 3600 m zeigen einige, ab 5000 m praktisch alle Menschen eine „Höhenanorexie“, die zu einem Gewichtsverlust von 1–2 kg pro Woche führt. Dies liegt an komplexen physiologischen Vorgängen, z. B. an Veränderungen der Konzentration des Hormons Leptin, das den Appetit reguliert, und an anderen Vorgängen, die dazu führen, dass Geruchs- und Geschmackssinn beeinträchtigt werden. In großer Höhe fühlt man sich bereits nach kleinen Portionen vollständig gesättigt und man muss mehr trinken als das Durstgefühl einem signalisiert. Sollten in dieser Situation noch Symptome der Höhenkrankheit hinzu treten (Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen), so wird es ein echter Kampf werden, die Kalorien zu essen, die der Körper benötigt. Allerdings ist gut belegt, dass der Gewichtsverlust bei solchen Expeditionen besonders gering war, auf denen die Bergsteiger sich die Nahrung selbst aussuchen und in relativ komfortabler Umgebung und in Gesellschaft essen konnten. Dies ist leider nicht auf allen Expeditionen möglich. Es ist jedoch in jedem Falle im Sinne aller Beteiligten, wenn man darauf achtet, dass man nicht ausgerechnet dann, wenn man sie am meisten für die körperliche Belastung und den Wärmehaushalt braucht, seine Muskeln unnötig abbaut! Der Tagesplan sollte so ausgelegt sein, dass man regelmäßig Nährstoffe zuführen kann, denn man kann sich unterwegs keine Schwächephasen leisten.
Wie viele Kalorien werden nun pro Tag benötigt? Wenn man lediglich ruht oder schläft, werden 60–75 % der täglich aufgenommenen Nahrungsenergie dazu benötigt, die Körperfunktionen aufrecht zu halten, beispielsweise die Zellerneuerung, den Herzschlag, die Atmung und die Wärme. Die Energiemenge, die hierfür nötig ist, wird Grundumsatz genannt und wird in Kalorien (kcal) angegeben. Schätzungen dieses Grundumsatzes für unterschiedliches Körpergewicht gibt Tabelle 2.6. Personen, die regelmäßig Sport treiben oder systematisch trainieren, haben einen etwas höheren Grundumsatz, denn Muskelmasse setzt mehr Energie um als Fett. Da Frauen physiologisch einen höheren Anteil an Körperfett haben, haben sie bei gleichem Gewicht einen geringeren Grundumsatz als Männer. Der Grundumsatz kann sich um bis zu 15 % steigern, wenn man an die entsprechenden Umweltbedingungen akklimatisiert ist (Höhe, Kälte). Für einen kurzen Zeitraum kann der Grundumsatz sogar auf das 4- bis 7fache gesteigert werden.
Wenn man den Grundumsatz als Grundlage nimmt (Tabelle 2.6), kann jede körperliche Aktivität, angefangen beim Sitzen vor dem Computer bis hin zum Hochleistungssport, als ein Vielfaches des Grundumsatzes angegeben werden. Beispielsweise beträgt der Energiebedarf einer 35-jährigen Frau mit einem Körpergewicht von 60 kg, die das 1,5fache ihres Grundumsatzes umsetzt, einen Tagesbedarf von 1,5 × 1555 kcal Grundumsatz für 60 kg = 2333 kcal. Für sportlich aktive Personen multipliziere man den Grundumsatz mit dem Faktor 2,0. Energiemengen, die den Faktor 2,5 übersteigen (hoch intensiver Sport oder Schwerstarbeit), können ohne spezifische Zusatznahrung nicht bilanziert werden. Zum Vergleich: Auf einer Everestexpedition wurden mit 2,2 ± 0,3 Werte gemessen, die denen eines Ausdauerspitzenathleten sehr nahe kommen. Eine andere Untersuchung mit Aufstiegen über 6000 m berichtet von 3,0 ± 0,7. In beiden Fällen trat ein erheblicher Gewichtsverlust auf.
Tabelle 2.6: Schätzung des Kalorienbedarfs (kcal) für den Grundumsatz
| Alter [Jahre] | Grundumsatz [kcal] entsprechend Gewicht | ||||
| 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |
| Männlich | |||||
| 10–17 | 1360 | 1537 | 1712 | 1889 | 2065 |
| 18–29 | 1289 | 1439 | 1589 | 1739 | 1889 |
| 30–59 | 1326 | 1441 | 1555 | 1669 | 1784 |
| 60–74 | 1172 | 1291 | 1410 | 1529 | 1648 |
| Weiblich | |||||
| 10–17 | 1350 | 1484 | 1617 | 1750 | 1884 |
| 18–29 | 1075 | 1222 | 1370 | 1518 | 1665 |
| 30–59 | 1166 | 1247 | 1328 | 1409 | 1490 |
| 60–74 | 1052 | 1144 | 1235 | 1327 | 1419 |
Historisch ist bekannt, dass Tausende Soldaten während Militäroperationen vor allem an Kälte und in geringerem Ausmaß an Höhe gestorben sind. Daher sind die militärischen Erfahrungen und Untersuchungen für das Höhenbergsteigen besonders wertvoll. In jüngerer Zeit wurde eine Tagesration von 4540 kcal zusammengestellt, die mindestens 15 % Protein und außerdem Salz enthält, um den Wasserbedarf zu begrenzen. Ein Gehalt von 15 % Protein ist auch für die Höhe sinnvoll, da dies bedarfsdeckend ist. Mehr wäre kontraproduktiv, denn Protein wird unter anderem zu Harnstoff abgebaut, der mit dem Urin ausgeschieden werden muss. Und wer möchte in großer Höhe mehr Schnee schmelzen, nur um den Harnstoff eines proteinreichen Gerichtes ausscheiden zu können? Außerdem wird Protein vom Körper langsamer als Kohlehydrate aufgenommen. Allerdings ist der thermogene Effekt (Wärmeproduktion) von einmal aufgenommenem Protein mit 5–6 Stunden deutlich langwieriger als der von Kohlehydraten mit 2–3 Stunden. Daher empfehlen manche Wissenschaftler, vor dem Einschlafen einen proteinreichen Imbiss einzunehmen, um nachts weniger zu frieren.
Eine weitere Schlüsselfunktion hinsichtlich der Nahrungserfordernisse auf Expeditionen hat die Kleidung. So hat auf der ersten erfolgreichen Everestexpedition im Jahre 1953 ein Wissenschaftler, der die Nahrung zusammengestellt hat, auch die Kleidung ausgewählt, denn beide Faktoren beeinflussen sich massiv gegenseitig. Falls man keinerlei Einfluss auf die Zusammenstellung der Expeditionsnahrung haben sollte, so sollte man unbedingt dafür sorgen, dass die eigene Kleidung den Erfordernissen optimal gerecht wird, um den Wärmeverlust des Körpers und damit den Nährstoffbedarf zu minimieren. So steigert Zittern den Grundumsatz beispielsweise um das 5fache. Guter Schutz vor Windchill ist also extrem wichtig. Kleidung, die warm hält, während man stillsteht, oder die beengt, kann die Schweißproduktion und damit den Flüssigkeitsbedarf massiv steigern, sobald man sich körperlich belastet. Hierauf wird im folgenden Kapitel näher eingegangen. Als Konsequenz sollte die Kleidung im Mehrschichtprinzip („Zwiebelschalenprinzip“) aufgebaut sein, mit warmer Funktionsunterwäsche, die den Schweiß gut weitergibt, als innerste Schicht und mehreren Schichten Oberkleidung, die je nach Bedarf ausgezogen werden kann. So optimiert man den Nahrungs- und Flüssigkeitsbedarf. Gleiches gilt für Kopfbedeckung, Hand- und Fußkleidung.
Nachdem man den täglichen Energiebedarf in kcal für das Team abgeschätzt hat – zumeist 4000–5000 kcal/Tag und Person – multipliziert man dies mit der Zahl der Expeditionstage zuzüglich einiger Schlechtwettertage. Fragen sollte man nach individuell nötiger oder gewünschter Diät und insbesondere den individuellen Vorlieben und Abneigungen, beispielsweise welche Kohlehydrate, Proteine und Fette jeder am liebsten mag. Welche Finanzmittel stehen zur Verfügung? Wo soll die Nahrung eingekauft werden – daheim oder unterwegs? Wie soll die Nahrung gelagert werden, beispielsweise in bärensicheren oder wasserdichten Behältern? Sind die Nahrungsmittel verderblich? Verändern sich die Nahrungsmittel erheblich bei den zu erwartenden Temperaturen? Reichlich Gewürze sollten mitgenommen werden, um das Essen wohlschmeckend zu machen, denn sowohl Geschmack als auch Geruch sind in der Höhe beeinträchtigt! Auf einer Everestexpedition wurden mehrere Kilogramm Chilipulver verbraucht!
Wenn man den Gesamtbedarf errechnet und eine Liste der Hauptnahrungsmittel erstellt hat, teilt man die Nahrung in die Hauptgruppen gem. Tabelle 2.7 ein. Der Anteil eines Nahrungsbestandteiles an der Gesamtmenge ist ebenfalls angegeben. Wenn man mit 5000 kcal/Tag kalkuliert, dann sollten 15 %, also (15/100) × 5000 = 750 kcal als Proteine, 28 %, also (28/100) × 5000 = 1400 kcal, als Fett und 57 % bzw. (57/100) × 5000 = 2850 kcal als Kohlehydrate aufgenommen werden. Erfolgreiche Expeditionen haben sich die Nahrung weitgehend analog zu Tabelle 2.7 zusammengestellt.
2.5.4 Optimale Ernährung in großer und extremer Höhe
Alle oben genannten Ratschläge funktionieren prinzipiell in großer und extremer Höhe in gleicher Weise, jedoch wird es mit zunehmender Höhe immer schwieriger, sie umzusetzen. Die Bergsteiger müssen ständig daran erinnert werden, ausreichend zu essen oder zu trinken, denn die Mechanismen, die uns üblicherweise signalisieren, dass Bedarf besteht, funktionieren mit zunehmender Höhe immer weniger. Hinzu kommt, dass die Auswirkungen des reduzierten Sauerstoffpartialdruckes und evtl. der Höhenkrankheit dort oben stärker sind. Man benötigt viel mehr Zeit, einen Liter Schnee zu schmelzen als in mittlerer Höhe, was sowohl die Nahrungsaufnahme als auch das Trinken negativ beeinflusst. Manche Bergsteiger vermeiden auch abends das Trinken, weil sie möglichst nicht nachts zum Urinieren aufstehen wollen. Und das wirkt sich vor dem Hintergrund der höhenbedingt gesteigerten Diurese und dem Wasserverlust über die gesteigerte Atmung in sehr trockener Luft ganz erheblich im Sinne einer Dehydratation aus. Dies führt neben einem verminderten Blutvolumen auch zu einer Verminderung der Schweißproduktion. Beides schränkt den Wärmehaushalt des Körpers ein, denn im Körperkern entstehende Hitze kann durch das geringere Blutvolumen schlechter an die Oberfläche transportiert werden und die Wärme, die dort ankommt, wird durch verminderte Schweißproduktion schlechter an die Umwelt abgegeben. Aus diesen und vielen anderen Gründen ist eine diszipliniert eingehaltene Strategie zu regelmäßigem Essen und Trinken in der Höhe absolut notwendig. Kohlehydratreiche Nahrung produziert über den Stoffwechsel außerdem Wasser, wodurch das Defizit ebenfalls begrenzt wird.
Tabelle 2.7: Beispiel für die Nahrungszusammenstellung erfolgreicher Expeditionen
| Kohlehydrate | Protein | Fette | |
| Tägl. Energiebedarf | 50–65% (etwa 57%) | 15% | 20–35% (etwa 28%) |
| Energie (kcal) in 1 g. | 4 | 4 | 9 |
| Funktion | Stabilisiert die Blutglukosekonzentration und Glykogenspeicher. Bevorzugter Energieträger für mittlere und hohe körperliche Belastung. Benötigt am wenigsten Sauerstoff zur Verbrennung. | Nötig zum Aufbau und Regeneration von Muskel- und Stützgewebe. | Notwendig zur Aufnahme essentieller fettlöslicher Vitamine und Fettsäuren (z. B. Omega 3), für die Hirnfunktion und für Zellmembranen. |
| Beispiele für Nahrungsmittel | Reis, Pasta, Nudeln, Cereals, Kartoffeln, Brot, Zucker, Crackers, Biscuits, Getränke mit komplexen Kohlehydraten, Trockenfrüchte, Zucker, Energieriegel | Käse, Würstchen, Trockenfleisch, Fischkonserven, Eier, Hülsenfrüchte, Linsen | Öle wie Olivenöl, Leinsamen, Pflanzenöl, Butter, Margarine, Konserven in Öl, Erdnußbutter, Nüsse |
| Anmerkungen | Begrenzte Vorräte im Blut bzw. als Glykogen, etwa 1800 kcal bei einem 68 kg schweren Mann. Speicher müssen regelmäßig aufgefüllt werden, insbesondere vor und nach körperlicher Belastung. Ansonsten kann es bis zu 5Tagen dauern, bis völlig entleerte Glykogenspeicher wieder gefüllt sind. Mindest bedarf 400g/Tag. | Wenn man nicht genug Kalorien pro Tag zuführt, werden (Muskel-) Proteine zur Energiegewinnung abgebaut. Sehr nachteilig! Dagegen verursachen proteinreiche Mahlzeiten Harnsäure, die über Urin (Wasserverlust!) ausgeschieden werden muß. Höherer thermogener Effekt als Fett oder Kohlehydrate, daher kann ein Imbiss vor dem Einschlafen sinnvoll sein. | Kompakte Nahrung mit hohem Brennwert (9 kcal/g im Gegensatz zu 4 kcal/g). Verbessert oft den Geschmack. Wenn möglich, sollten gesättigte Fettsäuren vermieden werden. |
| Proteine und Fette verbleiben länger als Kohlehydrate im Magen und sättigen subjektiv dadurch länger. Man kann beide Nährstoffgruppen mit Kohlehydraten kombinieren. |
Falls man sich nach einer anstrengenden Etappe erschöpft oder nicht wohl fühlt, trinke man ein kohlehydratreiches oder elektrolytreiches Getränk (ORS, „oral rehydration solution“) und warte ab, ob man sich danach besser fühlt. In vielen Fällen kann durch die Kohlehydrate, das Salz und das Kalium in diesen Getränken der Flüssigkeitshaushalt sowie die Muskel- und die Hirnfunktion erheblich gebessert werden. In extremer Höhe ist es oft besser, kohlehydratreiche Getränke verfügbar zu haben, weil man keine Lust hat, irgend etwas zu essen.
Hinweis: In großer Höhe gilt: Iss so viel, wie überhaupt geht, egal was! Hauptsache, es sind Kalorien. Falls es dir schmeckt, bevorzuge Kohlehydrate. Vergiss nicht, reichlich Flüssigkeit zu trinken.
Noch eine kurze Anmerkung zu Alkohol: Lass es sein! Hypothermie kann eine gefährliche Folge der Kombination aus körperlicher Belastung, unzureichender Nahrungsaufnahme und Alkohol sein. Hypothermie tritt dann ein, wenn der Wärmeverlust die Wärmeproduktion übersteigt. Das ist bei weitem nicht nur in sehr kalter Umgebung der Fall! Wie bereits erwähnt, entleert körperliche Anstrengung mehr oder weniger die Glykogenspeicher und die Blutglukosekonzentration neigt auch zum Absinken. Das Trinken von Alkohol wird den Blutzucker weiter senken, denn die Verstoffwechselung von Alkohol benötigt Zucker. Bei niedriger Blutglukosekonzentration ist die Fähigkeit des Körpers, auf Kälte adäquat zu reagieren, vermindert und gleichzeitig wird dadurch, dass durch den Alkohol die Hautgefäße erweitert werden, reichlich warmes Blut aus dem Körperkern an die Oberfläche transportiert, wodurch der Wärmeverlust des Körpers alarmierend steigt (Abb. 2.13).
Abb. 2.13: Alkohol als Risikofaktor für die Unterkühlung
Nimm aktiv an der Planung der Expeditionsnahrung teil, und sei es nur, um zu gewährleisten, dass deine Vorstellungen berücksichtigt werden. Wenn der Speiseplan von jemand anderem erstellt wird, dann nimm unbedingt einige persönliche Leckereien mit, beispielsweise Salami, Schokolade, Tee oder Süßigkeiten. Nahrung für große Höhen ist nicht zwingend anders als im Tal, aber sie sollte besonders kohlehydratreich sein und nach Möglichkeit reichlich (kohlehydrathaltige) Flüssigkeit und Elektrolyte enthalten. Am besten isst man, was man von daheim kennt und mag. Es muss gut transportierbar sein und die Temperaturen, die man erwartet, aushalten, wenig Wasser enthalten und leicht zuzubereiten sein. Insbesondere sollte ein Minimum an Brennstoff dazu nötig sein. Und was die Kalorien betrifft, gilt in großer Höhe vor allem: Iss so viel, wie irgendwie geht!
Webseiten mit weiterführenden Informationen zum Thema „Nahrungsmittel“:
■ www.nutritiondata.com
■ www.bda.uk.com/foodfacts/index.html#nutrients
■ www.usda.gov/cnpp
■ www.ars.usda.gov/services/docs.htm?docid=7783
■ hin.nhlbi.nih.gov/menuplanner/menu.cgi
Weiterführende Literatur
Morrison A, Schöffl V, Küpper T: Nutrition and mountaineering. Official Standards of the Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA) Medical Commission No.4. www.theuiaa.org/medical_advice.html (2008)
2.6 Zentrales und autonomes Nervensystem
R. Waanders
2.6.1 Allgemeine Reaktionen
Laut Ward et al. (1989, 2001) besteht allgemeine Übereinstimmung darüber, dass die Funktionen des zentralen Nervensystems in Höhen über 4500 m gestört sind. Ein „plötzlicher“ Aufenthalt in großer Höhe führt zu einer akuten zerebralen Hypoxie und somit zu einem Zustand der zerebralen Insuffizienz, bei dem eine Minderung der Hirnfunktionen als Folge einer Hirndurchblutungsstörung oder von Hirnstoffwechselvorgängen im Mittelpunkt steht.
Fallbeispiel. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts drangen einige verwegene Ballonfahrer in große Höhen vor. Sie waren nicht vorbereitet auf die Auswirkungen der akuten Hypoxie. Glaisher gibt in seinem Buch „Travels in the Air“ eine packende Beschreibung seiner Erlebnisse während einer Fahrt im Jahre 1862. Nachdem Glaisher bewusstlos im Korb zusammengebrochen war, sah sich sein Begleiter Coxwell gezwungen, den Ballon durch das Lüften von Wasserstoff herunterzubringen. Aber Coxwell hatte die Kontrolle über seine Hände verloren, woraufhin er die Schnur, mit der das Ventil bedient wurde, mit seinen Zähnen ergriff. Mit zwei bis drei Kopfbewegungen gelang es ihm, das Ventil zu öffnen. Nachdem der Ballon sicher gelandet war, verspürten die beiden Pioniere rasch keine Beeinträchtigungen mehr, so dass sie in der Lage waren, die mehr als zehn Kilometer bis zum nächsten Dorf zu Fuß zurückzulegen.
2.6.2 Anatomie und Hirngefäße
Das zentrale Nervensystem wird in drei große funktionale Abschnitte unterteilt. Das Rückenmark hält die Verbindungen des Gehirns mit den Organen und Muskeln aufrecht. An das Rückenmark schließt sich der Hirnstamm an. Er umfasst das Rhomb-, Met- und das Mesenzephalon (Mittelhirn). Das Vorderhirn, der funktional höchstrangige Gehirnteil, umfasst die Strukturen des Telenzephalon (Neokortex, Riechkolben, Basalganglien und limbisches System) und die Hirnregion des Dienzephalon (Thalamus, Hypothalamus, Epithalamus und Epiphyse).
Die Hirngefäße haben die Aufgabe, eine Blutversorgung des Gehirns in Ruhe und bei körperlicher und psychischer bzw. mentaler Belastung sicherzustellen. Im Schädelinneren vereinigen sich die beiden Vertebralarterien zu der Arteria basilaris, die Hirnstamm, Kleinhirn und die hinteren Abschnitte des Großhirns versorgt. Vertebralis und Basilaris bilden mit ihren Ästen den vertebrobasilären (hinteren) Hirnkreislauf. Die Arteria carotis interna gibt im Schädelinneren als wichtige Hauptäste die A. cerebri media und die A. cerebri anterior ab. Diese beiden Gefäße versorgen die überwiegenden Anteile des Großhirns und bilden mit ihren Ästen den vorderen Hirnkreislauf.
An der Schädelbasis existiert eine kreisförmige Verbindung zwischen den Gefäßen des vorderen und hinteren Hirnkreislaufes, des Circulus arteriosus Willisi. Diese kreisförmige Verbindung soll als anatomisch angelegter Umgehungskreislauf eine Blutversorgung der beiden Hirnhälften dahingehend absichern, dass einer Hemisphäre im Falle einer Mangeldurchblutung Blut von der anderen Hirnhälfte zur Verfügung gestellt werden kann.
2.6.3 Hypobare Hypoxie
Mit zunehmender Höhe sinkt der Atmosphären- oder Barometerdruck (PB). Höhenexposition geht mit einer Abnahme des Sauerstoffpartialdrucks pO2 der Atemluft, des alveolären Blutes palvO2 und des arteriellen Blutes partO2 einher. Die Folgen sind Hypoxämie und Hyperkapnie. Höhenexpositionen über der Schwellenhöhe von 2500 m Seehöhe bewirken aufgrund des daraus resultierenden Sauerstoffmangels im Gewebe einen Zustand von Hypoxie. Hypobare Hypoxie gilt als starker Stressor und führt einerseits zu einer zerebralen Gefäßdilatation sowie andererseits zu einem Anstieg der Gehirndurchblutung. Dem wirkt eine aus einer hypoxischen Hypokapnie resultierende Gefäßkonstriktion entgegen. Die Sauerstoffabgabe an das ZNS ist somit das Resultat einer Balance zwischen Vasodilatation und Vasokonstriktion, wobei die zerebrale Gefäßdilatation üblicherweise überwiegt.
Hinweis. Zur Abschätzung der Gewebeoxygenierung kann die pulsoxymetrische Bestimmung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SaO2) herangezogen werden. Diese korreliert mit der Ausprägung der Höhenleistungsfähigkeit bzw. der Höhensymptomatik im Sinne der Acute Mountain Sickness (AMS).
2.6.4 Zentrales Nervensystem
Die zerebrale Reaktion auf den verringerten Sauerstoffpartialdruck des arteriellen Blutes partO2 ist eine Steigerung der Durchblutungsgeschwindigkeit. Zusätzlich kommt es, im Zusammenspiel mit einer Permeabilitätsveränderung der Blutgefäße, initial während der Phase der subakuten Hypoxie zu einer lokal begrenzten Gehirnschwellung im Met- und Dienzephalon, die sich bei zunehmender Hypoxie über weite Teile des Gehirns ausweitet. Nach magnetresonanztomografischen Befunden (MRT) betrifft diese Schwellung ausschließlich die weiße Substanz (Substantia medullaris der Faserverbindungen wie das Corpus callosum). Die Schlüsselrolle spielt dabei die endotheliale Blut-Hirn-Schranke, die unter Hypoxämie undicht wird.
Bei schweren Hypoxien durch Herz- oder Atemstillstand kommt es in der Folge vor allem zu einem Zellverlust im Hippocampus, Corpus amygdaloideum und im anterioren Thalamus sowie zu neuropsychologischen Beeinträchtigungen der mnestischen Leistungen. Bei meist unauffälligem CT-Befund ergibt die Positronen-Emissions-Tomografie (PET) Hinweise auf Stoffwechselstörungen im mediobasalen (mesialen) Temporallappen. Auch transiente amnestische Episoden nach Schleudertraumen oder Migräneanfällen mit retrograden Gedächtnisstörungen stehen in Verbindung mit einer verminderten regionalen Hirnversorgung der mediobasalen Temporallappen. Als häufigste Ursache werden flüchtige Ischämien im Versorgungsgebiet der A. vertebrobasilaris gefunden.
In EEG-Untersuchungen zeigt sich unter Hypoxie – als Folge der Gehirnschwellung – eine signifikante Zunahme der langsamen Aktivität im Bereich der Delta-Power- (0,5–3 Hz) und weniger ausgeprägt der Theta-Power- (4–7,5 Hz) sowie eine Abnahme der Alpha-Aktivität (7,5–13 Hz, vor allem im Bereich der 7,5- bis 10,5-Hz-Frequenzen). Außerdem findet sich im EEG eine Abnahme der langsamen Beta-Aktivität (13–16 Hz) wie auch eine Zunahme der Beta-Power in den Frequenzen 20–25 und 30–35 Hz, was insgesamt auf Veränderungen der Vigilanz und des Arousals deutet.
2.6.5 Funktionelle Asymmetrie
Es gibt physiologische und anatomische Unterschiede zwischen den Hemisphären. Die rechte Hirnhälfte (RH) ist gewöhnlich ein wenig größer und schwerer als die linke Hemisphäre (LH) und hat mehr weiße Substanz als die LH. Zudem weisen die Temporallappen eine ausgeprägte Asymmetrie auf. Diese Asymmetrie des Temporallappens entspricht der funktionellen Asymmetrie des dienzephalen Thalamus. Die Valenzhypothese stellt fest, dass die LH dominant für positive und die RH dominant für negativ getönte Emotionen, Empfindungen und Körperzustände ist. Dies gilt sowohl für die Wahrnehmung, als auch für den Ausdruck. Dabei betrifft die Überlegenheit der RH eher basale Aspekte wie die autonomen Reaktionen (z. B. Blutdruck) auf emotionale Stimuli und Stressoren.
Untersuchungen von Otto et al. (in Chandramouli et al. 1993) belegen eindeutig die Aktivierung der RH durch aversive Bedingungen wie Depression oder Schmerzen. Patienten mit rechtshirnigen Läsionen tolerieren Schmerzen länger als Kontrollpersonen im Vergleich mit linkshirnig geschädigten Patienten. Der rechte Thalamus wird durch negative Erlebnisse intensiver aktiviert als der linke Thalamus. Die Amygdala, eine limbische Struktur im anterioren Teil des Temporallappens und das Zentrum der „angeborenen“ affektiven Funktionen, zeigt eine vergleichbare Asymmetrie. Stressfaktoren führen durchwegs zu einer deutlich stärkeren Aktivierung (Überreaktion) der rechten Amygdala.
Hypoxie gilt als starker Stressor. Im Rahmen von „Projekt Silberpyramide“ wurde überprüft, ob sich das EEG unter Hypoxie als prädiktiver Marker für das Auftreten von AMS eignet. Mit jeweils 24 Elektroden, angeordnet nach dem internationalen „10–20“-System, untersuchten Feddersen et al. (2007) 32 Personen auf 3450 m und 5050 m Höhe. Diejenigen (n = 12), die auf 5050 m Symptome der AMS entwickelten, reagierten unter subakut hypoxischen Bedingungen in 3450 m mit einem signifikanten Anstieg der Delta-Aktivität (T4-Elektrode) in der rechtstemporalen Region, während bei den anderen Personen (non-AMS) eine Abnahme der rechtstemporalen Delta-Aktivität im Powerspektrum verzeichnet wurde. Zusätzlich kam es bei den AMS-anfälligen Personen zu einem signifikanten Anstieg des Blutflusses in der rechten A. cerebri medialis von 51 cm/s in Baselinehöhe (100 m) auf 58 cm/s in 3450 m und 71 cm/s in 5050 m Meereshöhe. Die linksseitigen Flusswerte stiegen nicht an. Eine Quantifizierung der regionalen Sauerstoffsättigung (rSO2) mittels transkranieller Nahinfrarotspektroskopie zeigte neben der zu erwartenden generellen Reduktion der zerebralen Sättigung eine Umkehrung des unter Normoxie bestehenden „LH>RH“-Musters: Unter Hypoxie wurde initial eine höhere Sauerstoffsättigung in den Gefäßen der rechten Hemisphäre gemessen. Nachdem sich die Personen an die Höhe angepasst hatten – meistens nach 24 bis 48 Stunden – normalisierte sich das Muster wieder und die LH zeigte die bessere Sauerstoffsättigung.
2.6.6 Vegetatives Nervensystem
Hypoxämie bewirkt eine sympathoadrenerge Tonussteigerung bzw. Steigerung der Pars sympathica des vegetativen Nervensystems (VNS). Über das VNS werden zur Aufrechterhaltung der inneren Homöostase die Vitalfunktionen wie Herzschlag, Atmung, Blutdruck, Verdauung und Stoffwechsel kontrolliert. Der Sympathikus bewirkt insgesamt eine Leistungssteigerung des Organismus (Ergotropie). Er versetzt den Körper in hohe Leistungsbereitschaft und bereitet ihn auf Angriff oder Flucht oder andere außergewöhnliche Anstrengungen vor (Stressreaktion). Unter Hypoxie kommt es zu einem Anstieg der Herzfrequenz, des Blutdrucks, des systemischen Gefäßwiderstandes, der Sensitivität der Barorezeptoren und der Ventilation sowie zu einer Reduktion der Herzfrequenzvariabilität. Die hypoxiegetriggerte Sympathikusaktivierung induziert (multiple) somatische Beschwerden wie Kurzatmigkeit und Atemnot, Schwächegefühle, Schwindel, Herzklopfen, Benommenheit, Kopfschmerzen und zeigt dabei große Ähnlichkeit mit dem Hyperventilationssyndrom, einer über den Bedarf gesteigerten Lungenbelüftung, die mit einer Abnahme des Kohlenstoffdioxid-Partialdruckes (CO2) und einem pH-Anstieg (respiratorische Alkalose) im Blut einhergeht.
Zu den häufigsten vegetativen Reaktionen bei Hypoxie gehört ein Anstieg des systolischen Blutdrucks, während der diastolische Blutdruck unverändert bleibt. Systolischer Blutdruckanstieg korreliert positiv mit einer Aktivierung der RH. Elektrische Stimulierung von verschiedenen Kortexarealen bei Primaten führt 1–2 sec nach Stimulierung des anterioren Temporallappens, insbesondere des Temporalpols, zur größten Veränderung im Blutdruck. Dieses Resultat legt nahe, dass sich die beiden Hirnhälften in ihrer Fähigkeit, den Blutdruck zu steuern, unterscheiden. Die rechte Hemisphäre spielt eine größere Rolle bei der Wahrnehmung und Regulierung von Aktivität im autonomen, vegetativen Nervensystem und scheint spezialisiert zu sein für die Verarbeitung von afferenter Information aus dem kardiovaskulären System. Die funktionelle Asymmetrie geht dahin, dass die RH primär zu Arousal im VNS (Blutdruckanstieg) führt, die LH dagegen eher eine inhibitorische Funktion (Blutdrucksenkung durch Aktivierung des Parasympathikus) ausübt.
2.6.7 Individuelle AMS-Anfälligkeit
Die zerebrale Antwort auf Hypoxämie besteht aus einer Aktivierung im Sinne einer Überreaktion der RH und hat eine vegetative bzw. neurosomatische Symptomatik zur Folge. In der Höhe ist uns diese Symptomatik als Acute Mountain Sickness (AMS) oder Bergkrankheit bekannt. Menschen unterscheiden sich in ihrer Vulnerabilität für den Stressor Hypoxie, die individuelle AMS-Anfälligkeit ist nicht ausschließlich physiologischer Natur. Neuropsychologische Faktoren, die sich auf die emotionale, affektive Struktur einer Person beziehen, spielen eine große, wenn nicht dominante Rolle bei der Entstehung von AMS. An erster Stelle steht die sog. Angstveranlagung oder „Ängstlichkeit als Eigenschaft“ (engl.: „trait anxiety“ oder TA). Menschen mit einem ausgeprägten TA-Faktor reagieren früher und insgesamt intensiver auf den Stressor Hypoxie als Personen mit geringer Angstveranlagung. Je größer der individuelle TA-Faktor, umso stärker fällt die AMS-Symptomatik bei Höhenaufenthalten bis ca. 6000 m aus. Der zentrale „AMS-Mechanismus“ umfasst neben dem anterioren Temporallappen die tiefen, limbischen Strukturen des Thalamus, des Corpus amygdaloideum (Amygdala, Mandelkern) und des Hippokampus.
2.6.8 Kognitive und psychomotorische Leistung
Die durch die Hypoxämie-Hypoxie provozierte Gehirnschwellung kann sich zum einen in mentalen Leistungseinbußen, zum anderen in Störungen des Antriebs und der Affektivität äußern. Das Hirnorganische Psychosyndrom (HOPS) beschreibt die psychische Symptomatik (Tabelle 2.8). Ab einem gewissen Schweregrad können Desorientiertheit in Bezug auf Zeit, Person und Ort, Störungen der Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit, der Konzentration, Urteilsschwäche, allgemeine Verlangsamung der Denkprozesse, erschwerte Auffassung oder eine Bewusstseinstrübung beobachtet werden.
Tabelle 2.8: Symptomatik des HOPS (modifiziert nach Böther)
| Psychische Einbußen | Wesensveränderung |
| Konzentrationsminderung | Affektlabilität |
| Merkfähigkeitsschwäche | Dysphorie |
| Wortfindungsschwierigkeiten | nachlassende emotionale und affektive |
| Schlafrhythmusstörung | Belastbarkeit |
| schnelle Ermüdbarkeit | affektive Starre |
| Vitalverlust | Verstimmung |
| Desorientiertheit | charakterliche Vergröberung |
| Verwirrtheit | Verlust ethischer Normen |
Fallbeispiel. Litch und Bishop (1999) berichten über ein amnestisches Syndrom bei zwei Bergsteigern in Höhen von ca. 4000 m. Die Betroffenen wissen noch verschiedene autobiografische Details wie ihren Namen, ihr Alter oder vielleicht ihre Telefonnummer, aber sie können nicht sagen, wo sie sich gerade aufhalten, was sie vor 2 Stunden gegessen oder was sie in den letzten 24 Stunden erlebt haben. Das episodische Kurzzeitgedächtnis ist wegen lokaler Gehirnschwellung vorübergehend gestört, es kommt zu einer anterograden amnestischen Episode, die in tieferen Lagen rasch abklingt. Andere neuropsychologische Defizite können ein amnestisches Syndrom begleiten.
Zur Objektivierung der Leistungsminderung können kognitive und psychomotorische Leistungstests herangezogen werden, die thymopsychischen Parameter lassen sich mittels standardisierten psychiatrischen Skalen und Fragebögen erfassen.
2.6.9 Mittlere bis große Höhen (≤ 4000 m)
Eine wichtige Frage ist die nach der niedrigsten Höhe, in der aufgrund von subakuten hypoxischen Bedingungen geringfügige Veränderungen der neuropsychologischen Funktionen gemessen werden können. In einer Literaturübersicht über die Periode 1950–1963 stellt Tune (1964) fest, dass es allgemein akzeptiert ist, dass die psychomotorische Leistung in einer Höhe bis 3000 m nicht beeinträchtigt ist. Auch Green und Morgan (1985) fanden in einer Druckkammerstudie, in der 30 Probanden innerhalb von 3–5 min auf eine simulierte Höhe von 3050 m geführt wurden, keine Leistungseinbußen in einer logischen Denkaufgabe. Die Ergebnisse einer eigenen Feldstudie in 3050 m am Piz Buin (Waanders u. Riedmann 1994) lassen ebenfalls den vorläufigen Schluss zu, dass – trotz Absinken der arteriellen Sauerstoffsättigung auf ca. 90 % – bei gesunden Personen sowohl kognitive als auch psychomotorische Prozesse in einer Höhe von gut 3000 m nicht beeinträchtigt sind. Eine Sättigung des Hämoglobins im arteriellen Blut von ca. 90 % entspricht dabei einer Reduktion des Sauerstoffpartialdrucks der Atemluft von 25 % und scheint die Grenze zum subakuten HOPS zu markieren.
Auch präsentieren sich in Höhen von gut 3000 m nur äußerst selten die schwereren Formen der Bergkrankheit. Laut Hochstrasser et al. (1986) entwickelt ca. einer von viertausend Bergsteigern, die in 3000 m übernachten, ein Höhenlungenödem (HAPE) und/oder ein Höhenhirnödem (HACE), während die Inzidenz eines Höhenhirnödems in 4559 m bei ca. 1 pro 600 Nächtigungen bedeutend höher liegt. Gewöhnlich kommt es am 4. oder 5. Tag der Höhenexposition zur lebensbedrohlichen Ödemsymptomatik. Aufgrund dieser Zahlen dürfen wir schließen, dass ein Aufenthalt in 3000 m relativ sicher ist, vor allem während den ersten 24 bis 48 Stunden.
Die Auswirkung von Höhen zwischen 3000 und 4000 m auf Noo- und Thymopsyche wurden eher selten untersucht. Diese Höhen scheinen in Bezug auf Hypoxie und AMS eine sog. Grauzone bzw. einen Übergangsbereich darzustellen. In einer der wenigen Studien kommen Paul und Fraser (1994) zum Schluss, dass die Fähigkeit, neue Aufgaben zu lernen, bis in einer (simulierten) Höhe von 3658 m nicht beeinträchtigt ist. Nähern wir uns jedoch der „magischen“ 4000-Meter-Grenze, so wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich neuropsychologische Defizite mittels psychometrischer Testverfahren nachweisen lassen, immer größer.
2.6.10 Große Höhen (4000–5500 m)
In einer simulierten Höhe von 4500 m fand Cahoon (1972), dass die Effizienz in einer Kartensortieraufgabe während der ersten 3 Stunden reduziert war und sich anschließend verbesserte. In einer anderen Unterdruckkammerstudie wurde ein schnelles Aufsteigen auf 4300 m simuliert. Crowley et al. (1992) fanden, dass kognitive Leistungen und die Stimmung während der ersten 8 Stunden am meisten beeinträchtigt waren und sich anschließend wieder besserten. Bergsteiger, die während der ersten 6 Stunden ihres Aufenthaltes in 4559 m getestet wurden, zeigten im Vergleich zu Versuchspersonen, die nach 7 oder mehr Stunden Aufenthalt untersucht wurden, signifikant schwächere Werte im Syndromkurztest und im Stäbchentest.
In einer anderen Studie in einer Höhe von 4559 m wurde beobachtet, dass Personen mit beginnenden Symptomen der AMS auch Veränderungen in der Stimmung und im kognitiven Funktionieren zeigten. Bergsteiger, die innerhalb von 24 bis 48 Stunden AMS entwickelten, waren in den ersten 3–6 Stunden bereits leichtgradig im auditiven Kurzzeitgedächtnis (Zahlen nachsprechen) beeinträchtigt, während Probanden, die gesund blieben, auch eine bessere Kurzzeitgedächtnisleistung zeigten. Regard et al. (1991) schließen hieraus, dass Einbußen im Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis, d. h. eine Einschränkung in der Fähigkeit, neue Informationen aufzunehmen, den empfindlichsten neuropsychologischen Indikator für die akute Höhenkrankheit darstellen.
In einer Medikamentenstudie wurde die Auswirkung von Dexamethason gegen Plazebo bei 16 Militärangehörigen getestet, die in wenigen Stunden ins Pikes Peak Laboratory in einer Höhe von 4300 m geflogen wurden (Jobe et al. 1991). Während des ersten Tages in der Höhe waren die Stimmung und die kognitiven Leistungen der Plazebogruppe deutlich schlechter als die Werte der mit Dexamethason behandelten Probanden. Dies entspricht Ergebnissen von Banderet et al. (1986), die während der ersten 6 Stunden eine Reduktion in den kognitiven Leistungen in einer Höhe von 4600 m in allen sieben Tests gefunden haben. Nach 14–19 Stunden waren die Beeinträchtigungen deutlich zurückgegangen.
Insgesamt belegen die Messreihen in großen Höhen recht deutlich, dass der Zeitpunkt der Messung eine wichtige Rolle spielt. In den ersten paar Stunden nach dem Aufstieg werden sowohl in den Bereichen der Aufmerksamkeit und der Merkfähigkeit als auch in der psychomotorischen Geschwindigkeit deutlich schwächere Leistungen beobachtet als während späterer Zeitpunkte. In einer Feldstudie von Waanders et al. (2003) in 5050 m Höhe konnten 22 Personen untersucht werden. Die Probanden, die nach der ersten Nacht in der Zielhöhe getestet wurden, zeigten keine signifikant schwächeren Leistungen in vier computerisierten psychometrischen Verfahren (Kognition, Reaktionstest, verbaler Lerntest und Farb-Wort-Interferenztest) im Vergleich mit den Leistungen im Tal. Bei gleich bleibenden kognitiven Leistungen nahm jedoch die psychomotorische Geschwindigkeit mit der Höhe deutlich zu. Und auf der Beschwerdenliste wurden in großer Höhe auffallend mehr und intensivere Beschwerden protokolliert. Es liegt der Schluss nahe, dass die guten reaktiven und kognitiven Leistungen, die in 5050 m gemessen wurden, auf einer bereits im Rahmen des Trekkings erfolgten Akklimatisation der Teilnehmer basieren. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass auch die Werte auf dem Lake Louise AMS-Bogen recht niedrig waren: In 5050 m hatten die Teilnehmer im Gokyo-Team eine durchschnittliche Score von 1,67 Punkten, im Island Peak-Team von 0,92 Punkten. Die auf der Beschwerdenliste geäußerten Beschwerden galten primär der Kälte sowie der Kurzatmigkeit und der raschen Erschöpfbarkeit in gut 5000 m Höhe.
2.6.11 Große bis extreme Höhen (> 5500 m)
Hingston gab während der Mount-Everest-Expedition 1924, bei der Mallory und Irvine in einer Höhe von über 8300 m verschwanden, eine der frühesten Beschreibungen über das mentale Funktionieren in großer Höhe. Er ließ die Teilnehmer dieser Expedition verschiedene Kopfrechenaufgaben lösen. Hingston: „Though mental work is a burden at high altitude, yet with an effort it can be done“. McFarland führte in den Dreißigerjahren in den Anden eine klassische Serie von Feldstudien durch. Seine Untersuchungen in Höhen bis gut 6000 m zeigten, dass die Aufstiegsgeschwindigkeit einen wichtigen Faktor darstellt und dass sowohl einfache als auch komplexe psychologische Funktionen in großer Höhe ernsthaft beeinträchtigt sind, so z. B. die Merkfähigkeit.
In der dritten McFarland-Studie (1938) wurden die sensorischen und motorischen Responsen während der Akklimatisation in Höhen zwischen 5000 und 6000 m an den zehn Expeditionsteilnehmern gemessen. Alle Tests wurden frühestens 4 Tage nach dem Erreichen einer bestimmten Höhe abgenommen. Eine signifikante Reduktion des Hörens, des Sehens und in der Auge-Hand-Koordination konnte „erst“ in Höhen über 5330 m beobachtet werden. Auch waren verschiedene kognitive Leistungen recht deutlich betroffen. McFarland stellte fest, dass komplexe geistige Arbeit nur mit erhöhter Konzentration möglich war, dass zugleich jedoch erhöhte Ablenkbarkeit, Lethargie und Indifferenz herrschten, worunter die Konzentrationsfähigkeit litt.
Lieberman et al. (1994) untersuchten während der „1993 American Sagarmatha Expedition“ die Auswirkungen der extremen Höhe (6300 und 7150 m) auf neuronale Prozesse, die der motorischen Kontrolle beim Sprechen zugrunde liegen. Mit zunehmender Höhe fanden sich bei den 5 Probanden spezifische Abweichungen von den im Basislager erfassten Werten. Die Störungen ähnelten denen bei der Parkinson-Erkrankung. Als Erklärung für die Defekte kommt nach Ansicht der Autoren eine milde Hypoxie subkortikaler Nervenschaltkreise, die Basalganglien und präfrontalen Kortex verbinden, in Frage.
2.6.12 Langzeitfolgen der extremen Hypoxie
In einer Studie an acht Weltklassebergsteigern (Regard et al. 1989), die frühestens 5 Monate nach der Rückkehr aus großen Höhen durchgeführt wurde, konnten so genannte Frontalhirnsyndrome bei manchen Rückkehrern nachgewiesen werden. Dabei waren psychologische Fähigkeiten, wie z. B. von einem gelernten Konzept auf ein anderes zu wechseln, und die Konzentrationsfähigkeit eingeschränkt. Am empfindlichsten scheint die Merkfähigkeit auf eine länger andauernde Hypoxie zu reagieren. Townes et al. (1984) und Cavaletti et al. (1990) sowie Ryn (1988) kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Dagegen konnten Jason et al. (1989) bei den 12 Mitgliedern einer Mount-Everest-Expedition keine kognitiven Langzeitfolgen feststellen.
In sechs von insgesamt acht Publikationen lassen sich Hinweise für die These finden, dass ein mehrtägiger bzw. mehrwöchiger Aufenthalt in extremer Höhe (> 5300 m) wenigstens bei einigen Bergsteigern zu Langzeitschädigungen im ZNS mit Veränderungen der Persönlichkeit und mit bleibenden neuropsychologischen Defiziten führen kann. Diese Veränderungen scheinen bei Personen mit der höchsten „hypoxic ventilatory response“ (HVR) am auffälligsten zu sein. Eine Hypothese für dieses Phänomen findet man bei Hornbein (1992, 1989). Ein klar umrissenes Bild dieser Veränderungen lässt sich jedoch derzeit nicht beschreiben.
Kompaktinformation
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass umfangreiche Belege vorhanden sind, dass ein Aufenthalt in Höhen über 4500 bis 5000 m aufgrund der hypoxischen Bedingungen sowohl zu ernsthaften akuten (unmittelbaren und mittelfristigen) Beeinträchtigungen wie auch in vereinzelten Fällen zu Langzeitstörungen von verschiedenen kognitiven und affektiv-emotionalen Teilfunktionen führen kann. In Anbetracht der Vulnerabilität des ZNS für Hypoxie darf uns dies kaum überraschen!
2.6.13 ZNS-Schwellen
In Übereinstimmung mit der Höhe bzw. mit dem Ausmaß des Sauerstoffmangels in den Geweben und Organen des Körpers und unter Berücksichtigung der individuellen „AMS-Veranlagung“ kommt es zu einem typischen Cluster von somatischen und psychischen Symptomen, durch die akut auftretende Veränderungen oder Störungen der Hirnfunktionen erkennbar werden. Vier ZNS-Schwellen können unterschieden werden. Je nach Schwelle sind andere, zusätzliche Bereiche des zentralen Nervensystems von der Hypoxie betroffen.
In einer Höhe von ca. 2500 m wird die 1. ZNS-Schwelle erreicht bzw. überschritten. Das ZNS reagiert mit einer Aktivitätssteigerung des vegetativen, autonomen Nervensystems im Sinne einer sympathoadrenergen Tonussteigerung. Bei Personen mit der entsprechenden Vulnerabilität kann es nach einiger Zeit (6–8 h)zu den ersten (meistens noch harmlosen) Symptomen der Acute Mountain Sickness kommen. In ca. 4000 m wird die 2. ZNS-Schwelle überschritten. Ab dieser Höhe werden Störungen im Limbischen System (LS) mit Beeinträchtigungen oder Veränderungen von Affekt und Arbeitsgedächtnis berichtet. Die 3. ZNS-Schwelle, die kortikale Schwelle, befindet sich in ca. 5500 m. Häufig finden sich deutliche Beeinträchtigungen in den sog. höheren kortikalen Leistungen wie dem analytischen und problemlösenden Denken. Ab ca. 7000 m wird die 4. ZNS-Schwelle überschritten und die „Todeszone“ betreten. Die Folgen können fatal sein. Huey und Eguskitza (2000) berichten, dass bei Bergsteigern am Mount Everest und K2, die den Gipfel ohne Flaschensauerstoff erreicht hatten, um bis zu 250 % höhere Todesraten während des Abstiegs vorkommen im Vergleich zu Gipfelbesteigern mit Flaschensauerstoff.
Kompaktinformation
ZNS-Schwellen:
± 2500 M → 1. ZNS-Schwelle
= Vegetative Schwelle (VNS: Vitalfunktionen)
± 4000 M → 2. ZNS-Schwelle = Limbische Schwelle (LS: Affekt, Arbeitsgedächtnis)
± 5500 M → 3. ZNS-Schwelle = Kortikale Schwelle (Kortex: höhere kortikale Leistungen)
± 7000 M → 4. ZNS-Schwelle
= Terminale Schwelle
Weiterführende Literatur
Cavaletti G, Garavaglia P, Arrigoni G, Tredici G: Persistent memory impairment after high altitude climbing. Int J Sports Med 1990; 11: 176–178.
Feddersen B, Ausserer H, Neutane P, Thanbichler F, Depaulis A, Waanders R, Noachtar S: Right temporal cerebral dysfunction heralds symptoms of acute mountain sickness. J Neurol 2007: 359–363.
Hadolt I, Litscher G, Sattelmeyer V: Transkranielle zerebrale Oxymetrie in großen Höhen – Untersuchungen der regionalen zerebralen Sauerstoffsättigung im Rahmen des Projekts Silberpyramide. In: Waanders R, Frisch H, Schobersberger W, Berghold F (Hrsg.): Jahrbuch 2003 Österreich. Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin. Innsbruck, 2003, S. 91–100.
Hornbein TF: Long term effects of high altitude on brain function. Int J Sports Med 1992; 13: 43–45.
Missoum G, Rosnet E, Richalet J-P: Control of anxiety and acute mountain sickness in Himalayan mountaineers. Int J Sports Med 1992; 13: 37–39.
Saletu B, Linzmayer L, Grünberger J, Anderer P: Das Hypoxiemodell in der Psychopharmakologie: EEG-Mapping und psychometrische Studien unter hypoxischer Hypoxidose. In: Schobersberger W, Humpeler E, Hasibeder W, Jenny E, Flora G (Hrsg.): Jahrbuch 1993 der Österreich. Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin, Innsbruck: Österreich. Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin, 1993, S. 59–75.
Townes BD, Hornbein TF, Schoene RB, Sarnquist FH, Grant I: Human cerebral function at extreme altitude. In: West JB, Lahiri S (eds.): High altitude and man. Bethesda, Maryland: American Physiological Society, 1984, pp. 32–36.
Trapp M, Egger J, Miggitsch E-M, Rohrer P, Wurst L, Domej W: Psychophysiologische Stressreaktionen unter hypobarer Hypoxie. Psychologische Medizin 2008; 19: 27–34.
Tune GS: Psychological effects of hypoxia: review of certain literature from the period 1950 to 1963. Perceptual and Motor Skills 1964; 19: 551–562.
Waanders R, Frisch H, Schobersberger W, Berghold F (Hrsg.): Jahrbuch 2003 Österreich. Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin. Innsbruck, S. 91–100.
Ward MP, Milledge JS, West JB: High altitude medicine and physiology. London: Chapman and Hall Medical, 1989, 2001.
2.7 Schlaf in der Höhe
N. Netzer
2.7.1 Schlafqualität in der Höhe
„Ich verbrachte eine so schlechte Nacht dort oben, dass ich sie meinem ärgsten Feind nicht wünschen würde!“ So ein Zitat des Mediziners Dr. Jacotet nach seiner erfolgreichen Erstbesteigung des Mont Blanc 1884. Diese Beobachtung einer unruhigen, nicht erholsamen Nacht vor bald 130 Jahren haben vor und nach dem Arzt Jacotet viele Bergsteiger machen müssen, die in einer Höhe über 2500 m ihr Lager aufschlugen.
Der schlechte Schlaf, die schlechte Schlafqualität mit vermehrten zumindest subjektiv empfundenen Wachphasen und der Einfluss derselbigen auf eine reduzierte körperliche und geistige Leistungsfähigkeit am folgenden Tag wurden schon von Höhenmedizinern vor den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts beschrieben. Auch wusste man, dass es diesbezüglich keinen wirklichen Gewöhnungseffekt gibt und dass im Gegensatz zur Höhenkrankheit die Symptome ab einer bestimmten Höhe nicht auf gleichem Niveau persistieren oder mit zunehmender Akklimatisation abnehmen, sondern die Schlafqualität eher linear zur Höhe schlechter wird. In der Todeszone ist ein Schlaf wohl nur noch durch totale Erschöpfung möglich, ansonsten wird man durch die dort existierende Hypoxie kontinuierlich wach gehalten. Letzteres, nämlich wach zu bleiben, hat vielleicht auch Hermann Buhl das Leben gerettet, der ja nach eigener Aussage wegen zu spätem Erreichen des Gipfels bei seinem Alleingang auf den Nanga Parbat die Nacht vom 3. auf den 4. Juli 1953 im Gipfelbereich im Stehen verbringen musste.
Mit der Elektrifizierung von Hochquartieren und Forschungslaboratorien sowie einer inzwischen existierenden allgemein gültigen Schlafphasenklassifizierung nach Rechtschaffen und Kales wurde es in den 70er Jahren der 20. Jahrhunderts möglich, auch oberhalb 4000 m den Schlaf qualitativ und quantitativ zu ermitteln.
Fallbeispiel. Das objektive Ergebnis von Schlafstudien bei 6 gesunden Probanden in Meereshöhe und in einer Höhe von 4300 m auf dem Pikes Peak war, wie es die subjektiven Vorhersagen vermuten ließen:
– eine signifikante Abnahme der Tiefschlafphasen (Deltaphasen) 3 und 4 in der Höhe zugunsten oberflächlichen Schlafs in den Phasen 1 und 2 und des Wachzustands;
– eine signifikante Zunahme von Arousals und Mikroarousals (Sekunden dauernde Aufwachphasen mit einer Beschleunigung der EEG-Aktivität in den Alpharhythmus von 8–12 Hz, Muskelaktivität, Pulsbeschleunigung und Atemfrequenzsteigerung, die aber nicht bewusst alswach empfunden werden; s. dazu auch Abb. 2.14);
– eine Abnahme des REM („rapid eye movement“) Schlafs, der im Volkstümlichen auch als Traumschlaf oder paradoxer Schlaf bezeichnet wird;
– durch mehrere Wachphasen unterbrochener Schlaf, also eine Insomnie;
– ein generell erhöhter Puls in der Nacht gegenüber den Nächten auf Meereshöhe.
Abb. 2.14: Durchschnittliche Anzahl der Arousals (Schlafunterbrechungen) pro Stunde in verschiedenen Höhen bei der Operation Everest-II-Studie (Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung von J.D. Anholm und S.R. Sutton, Loma Linda, Kalifornien)
Allerdings wurde damals schon festgestellt: Von der Gesamtschlafzeit her erreichten die Probanden eine ausreichende Zeitdauer. So schlecht, wie ihn die Bergsteiger subjektiv beschrieben haben, war der Schlaf also nicht. Eher neigt man dazu, früher zu Bett zu gehen und insgesamt etwas länger im Bett respektive Schlafsack zu verbringen. Vielleicht ein Grund dafür, warum Menschen überhaupt in der Lage sind, doch gewaltige Anstrengungen auf mehrtägigen Höhentouren zu bewältigen.
Mitte der 80er Jahre und in den Folgejahren wurden diese grundsätzlichen Schlafveränderungen in Höhen über 3500 m in größeren Höhen in Feldstudien mit ambulanten Polygraphen und EEGs oder in simulierter Höhe bis zur Schlafhöhe auf dem Everest Südsattel bestätigt (Abb. 2.15). Es zeichnete sich bald ab, dass individuelle Unterschiede für die Ausprägung der Schlafstörungen bestehen, wie das ja auch für die akute Höhenkrankheit gilt, und dass die Schlafstörungen bei einheimischen Höhenbewohnern wie Sherpas u. a. nicht in dieser Form vorhanden sind. Mit einem neuen, validierten Fragebogen zur Schlafqualität konnte jetzt vor kurzem auch die subjektiv empfunden Schlafqualität recht gut mit den EEG-Ergebnissen korrelierend erfasst werden, was ebenfalls die grundsätzlichen Daten aus den 70er Jahren bestätigt.
Abb. 2.15: Das Plaza de Mulas Basislager auf der Normalroute am Aconcagua auf 4200 m Höhe. Hier fangen für die meisten Bergsteiger die Schlafprobleme so richtig an (Foto: N. Netzer)
Neu hinzugekommen ist durch mehrere Langzeit-EKGs bei Himalaya-Bergsteigern eine weitere pathophysiologische Veränderung im Schlaf in großen bis extremen Höhen, die bisher möglicherweise unterschätzt wurde: schwere, nur zum Teil mit der Tachykardie in Verbindung stehende Arrhythmien. Die auch tagsüber auftretenden und von Bergsteigern gefühlten Palpitationen wachsen sich in der Nacht zu Rhytmusstörungen bis zum kurzfristigen Kammerflattern aus.
2.7.2 Was stört den Schlaf in großer Höhe?
Entsprechend den Belastungen des Höhenbergsteigens gibt es zahlreiche Ursachen für die Schlafstörungen in großer Höhe:
■ ungewohnte Schlafumgebung und zum Teil unebene, harte und von unten her kalte Schlafauflage;
■ Kälte und kalte, trockene, den Energiehaushalt negativ beeinflussende Atemluft;
■ beengende, keine Zirkulation zulassende Kleidung und Schuhe;
■ Verdauungsprobleme;
■ Schmerzen durch kleine Verletzungen wie Fußblasen und Schürfwunden;
■ Übelkeit und Kopfschmerzen zum Teil in Verbindung stehend mit Höhenkrankheit, zum Teil unabhängig davon;
■ durch die extreme Anstrengung und auch Aufgeregtheit hohe nächtliche Adrenalin und Cortisolspiegel, die nur langsam abgebaut werden und den Bergsteiger wach halten;
■ laut schnarchende oder sonst auf irgendeine Art laute Geräusche verursachende Bergkameraden;
■ laute Windgeräusche;
■ Nykturie (vermehrtes nächtliches Wasserlassen) durch Höhendiurese auch in Verbindung stehend mit dem nächtlichen Abbau von peripheren Höhenödemen (Flüssigkeitsansammlungen im Hautgewebe und im Zwischenbindegewebe);
■ Angstzustände.
Diese Liste ließe sich durch jeden Bergführer, Höhenmediziner und erfahrenen Höhenbergsteiger wahrscheinlich beliebig erweitern, dennoch handelt es sich letztendlich nur um „Nebensächlichkeiten“.
Wie für die Entstehung der spezifischen Höhenkrankheiten ist auch für die Schlafstörungen in erster Linie die Hypoxie verantwortlich. Die durch den Sauerstoffmangel in der Höhe veränderte Atmung im Schlaf kann sogar als die Mutter aller gravierenden Höhenprobleme, sprich Höhenkrankheiten, in Erwägung gezogen werden. Während tagsüber die Atmung nur zum Teil autonom durch das Atemzentrum kontrolliert wird und der Mensch bewusst zum Ausgleich der Hypoxie schneller oder langsamer atmet, übernehmen im Schlaf die Neuronen des Atemzentrums die Atmungssteuerung quasi als Autopilot, gefüttert mit den Signalen der chemischen Messfühler (Chemorezeptoren) für die Zusammensetzung der Blutgase an der Arteria carotis, der Halsschlagader, auf die sie sich mehr oder weniger komplett verlassen. Vor allem der CO2-Parialdruck im Blut dient als Regelparameter.
Abb. 2.16: Periodische Atmung und abfallende Sauerstoffsättigung (SaO2) in der Höhe. Durch Gabe von Sauerstoff (Pfeile) können die Cheyne-Stokes-Apnoen sofort eliminiert werden („Operation Everest II“, Abbildung mit freundlicher Genehmigung von J.D. Anholm und S.R. Sutton, Loma Linda, Kalifornien)
Hier kommt es jedoch zu einer physiologischen Fehlsteuerung zwischen der Atemantwort auf Sauerstoffmangel und der Atemregulation auf der Basis des pCO2-Wertes. Einfach gesprochen könnte man sagen: Während man schnell atmet, um den Sauerstoffmangel auszugleichen, atmet man zuviel CO2 ab. Das Atemzentrum stellt daraufhin den Atemreflex ein und macht eine Atempause. Nach dieser Pause setzt wieder eine hochfrequente Atmung ein, um den nun entstandenen Sauerstoffmangel auszugleichen. Das Spiel beginnt von vorn (negative Rückkopplung). Die jetzt entstehende Atmung mit immer wiederkehrenden Pausen, so genannten zentralen, da vom Atemzentrum in der Medulla oblongata des Gehirns verursachten Apnoen, wird als Cheyne-Stokes- oder periodische Atmung bezeichnet (Abb. 2.16 und 2.17).
Abb. 2.17: Cheyne-Stokes-Atmung im REM-Schlaf auf 6100 m Höhe („Operation Everest II“, Abbildung mit freundlicher Genehmigung von J.D. Anholm und S.R. Sutton, Loma Linda, Kalifornien)
Die Apnoen allein und die mit ihnen einhergehenden Schwankungen des Sauerstoffgehalts im Blut, der während dieser Atempausen noch weiter abfällt, als er es ohnehin schon in großen bis extremen Höhen tut, mögen der Grund für die Entstehung der akuten Höhenkrankheit sein, für den schlechten Schlaf sind sie so noch nicht verantwortlich. Erst die Arousals, die mit der jeweiligen Beendigung der Apnoen in Verbindung mit einem Ausstoß von Adrenalin einhergehen, sind für die Unterbrechungen des Schlafs und die oben genannten Schlafstörungen verantwortlich und ebenfalls für die oben erwähnten Tachyarrhythmien. Auf diese Hypothese hat man sich weitgehend geeinigt. Grundsätzlich muss gesagt werden, dass die periodische Atmung eine physiologische Antwort des Körpers auf Sauerstoffmangel ist, und es gilt bis heute nicht als sicher, inwieweit sie auf der einen Seite in großer Höhe das Überleben sichert, aber auf der anderen Seite dies auf Kosten schlechten Schlafes und einer möglichen Progression der akuten Höhenkrankheit tut.
Abb. 2.18: Die Berliner Hütte auf knapp 6000 m Höhe auf der Normalroute am Aconcagua. Hier ändert sich die Atmung in eine hochfrequente Atmung, die im zentralen Nervensystem durch Sauerstoffrezeptoren getriggert wird (Foto: N. Netzer)
Neuere Untersuchungen an Tieren versuchen, die Interaktion zwischen zentralen (im Gehirn) und peripheren (an der Karotis) Chemorezeptoren besser verstehen zu helfen. Möglicherweise kommt es hier zu „Verständigungsschwierigkeiten“ zwischen den peripheren Messfühlern und ihren im Gehirn befindlichen Signalempfängern. Nicht ganz klar ist bis heute, warum es in extremen Höhen (Abb. 2.18), in denen weniger CO2 eine Rolle bei Atmungssteuerung spielt und periodische Atmung durch eine eher hochfrequente Daueratmung ersetzt wird, die allein durch Sauerstoffmangel und Sauerstoffrezeptoren im Gehirn getriggert ist, immer noch zu Arousals und Schlafunterbrechung kommt. Wahrscheinlich führt die extreme Hypoxie zu einem konstant hohen Pegel von Adrenalin, der normalen Schlaf nicht mehr zulässt, wie beispielsweise in dem oben genannten Beispiel von Hermann Buhl.
Patienten mit Schlafapnoe, schwerem obstruktivem Schnarchen und Asthma haben eines gemeinsam: Sie sind eher in mittleren Höhen gefährdet durch eine Verschlimmerung ihrer Symptome in Verbindung mit leichtem Sauerstoffmangel. Dieser Effekt wird auch als Overlap-Syndrom bezeichnet. Wer war noch nicht Zeuge von besonders lautem Schnarchen mit Atemaussetzern in einer Berghütte auf ca. 3000 m Höhe in den Alpen? In großen und extremen Höhen hingegen verschwinden die Symptome und werden ersetzt durch die für alle gültige periodische Atmung.
2.7.3 Gegenstrategien zu schlechtem Schlaf
Die Gegenstrategien zu schlechtem Schlaf in der Höhe kann man in zwei Hauptgruppen einteilen:
■ nichtmedikamentöse Methoden (Abstieg, Sauerstoff, Überdruckatmung),
■ medikamentöse Methoden (Schlafmittel, atemantriebsteigernde und atmungsregulierende Präparate).
Neben dem zügigen Abstieg ist die Gabe von Sauerstoff das sicherste Mittel in großen und extremen Höhen, um die Atmung sofort zu normalisieren (s. auch Abb. 2.18), periodische Atmung und Arousals zu eliminieren und damit auch den Schlaf zu normalisieren. Während eine Dauersauerstoffgabe über Maskenatmung am Tag und in der Nacht für normale Höhentouren eher unpraktikabel und auch zu teuer sein dürfte, spielt die Anreicherung der Raumluft in Gebäuden in großen Höhen, in denen Menschen leben, arbeiten und sich konzentrieren sollen, wie z. B. in den Observatorien am Mauna Kea auf Hawai (4218 m) oder bei Minen in Bolivien, Chile und Peru, durchaus eine praktische Rolle. Erschwinglich und durchaus praktikabel auch für normale Höhentrekking- und Besteigungstouren können so genannte Demandsysteme mit Sauerstoffbrillen sein, bei denen nur wenig Sauerstoff aus einer kleinen Sauerstoffflasche dann über Nasenbrillen zugereicht wird, wenn besonders viele Cheyne-Stokes-Apnoen auftreten.
In letzter Zeit hat man begonnen, auf der Basis der Behandlung von obstruktiver und zentraler Schlafapnoe mit Überdruckatmung in normalen Höhen, diese Methode auf die periodische Atmung in der Höhe bzw. auf die Behandlung von akuter Höhenkrankheit mit Erfolg zu übertragen. In der Entwicklung befindliche Systeme arbeiten als Masken oder Helme mit einem über Akkus betriebenen Ventilator. Dabei macht man sich zunutze, dass unter dem erhöhten inspiratorischem und endexspiratorischem Druck durch die Druckerhöhung eine Erhöhung des Partialdrucks des Sauerstoff in der Luft, die letztendlich durch die oberen Atemwege in die Lunge kommt, stattfindet.
Bereits von Anbeginn des Hochtourenbergsteigens an hat man versucht, mit Naturpräparaten (Coca, Ginko Biloba u. a.) und später mit Schlaf- und Schmerzmitteln den Schlaf in der Höhe positiv zu beeinflussen. Heute unterscheidet man zwei Präparategruppen die sozusagen „vorbeugend“ oder zur Unterdrückung von Symptomen, die Schlaflosigkeit auslösen, eingesetzt werden:
1 klassische zentral wirkende Sedativa, in erster Linie Benzodiazepine und Benzodiazepinabkömmlinge wie die Zopiclone (Flunitrazepam, Temazepam, Lorazepam, Loprazolam, Zolpidem, Zaleplon),
2 Präparate, die zentral und peripher die Atmungsteuerung beeinflussen und die periodische Atmung reduzieren (Acetazolamid, Theophyllin, Almitrin).
Bei den Benzodiazepinen macht man sich sowohl den zentral sedierenden als auch den leicht atemdepressiven und damit die Atmung beruhigenden Effekt zunutze. Daher wurde ein positiver Effekt auf den Schlaf in der Höhe auch schon recht früh publiziert. In jüngster Zeit hat es gute plazebokontrollierte Untersuchungen zu dem ebenfalls schon früh eingesetzten Temazepam und zu den Zopiclonen gegeben. Alle erfolgreich eingesetzten Benzodiazepine hatten auch gute Auswirkungen auf die akute Höhenkrankheit.
Das erfolgreichste Mittel zur Verbesserung des Schlafs in der Höhe durch eine Stabilisierung der Atmung ist wie auch beim Einsatz gegen akute Höhenkrankheit das Acetazolamid (Handelsname Diamox). Der Carboanhydrasehemmer hält den Blut-pH durch verminderten Abbau von CO2 niedrig und wirkt damit auf die oben beschriebene negative Rückkopplung durch indirekte Wirkung auf die peripheren Chemorezeptoren ein. Die periodische Atmung in mittleren bis großen Höhen findet fast oder gar nicht statt. Da damit auch die Arousals nicht stattfinden, wird der Schlaf nicht unterbrochen. Die positiven Auswirkungen von Acetazolamid auf die Qualität des Schlafes in der Höhe sind schon früh und umfangreich publiziert worden. Es scheint allen anderen Präparaten in der Unterdrückung der periodischen Atmung überlegen zu sein (Abb. 2.19).
Abb. 2.19: Acetazolamid und das Benzodiazepin Oxazepam im Vergleich in ihrer Wirkung auf die Sauerstoffsättigung im Schlaf in der Höhe (Abbildung mit freundlicher Genehmigung von J.D. Anholm und S.R. Sutton, Loma Linda, Kalifornien)
Abb. 2.20: Auswirkungen von zum Einschlafen gegebenem Theophyllin (300 mg retard) auf die Entwicklung von akuter Höhenkrankheit im Vergleich zu Plazebo im Verlauf mehrerer Tage in der Höhe (Cabanna Margherita, Monte Rosa, 4560 m). Der Lake Louise AMS Score ist unter Theophyllin signifikant niedriger (nach Küpper et al., J Travel Med 2008; mit freundl. Genehmigung)
Theophyllin, ein Verwandter des Coffein und Teein, ist eigentlich ein Mittel zur Erweiterung der Atemgefäße bei chronischer Bronchitis und Lungenemphysem. Es wirkt aber auch ähnlich wie Coffein, nur stärker, zentral im Gehirn atemantriebssteigernd. Da es nicht auf die peripheren Chemorezeptoren wirkt, ist es bei der Anwendung gegen Atem- und Schlafstörungen in großer Höhe möglicherweise Acetazolamid etwas unterlegen, ist aber in den niedrigen Dosen, in denen es eingesetzt wird (200 [–400] mg retard zur Nacht), ein sehr sicheres und bewährtes Präparat (Abb. 2.20).
Almitrin ist eigentlich eine Blutdruck senkende Substanz, die ähnlich wie Theophyllin zentral stimulierend auf das Atemzentrum wirkt. Wegen gefährlicher Allergien und anderer Nebenwirkungen ist es praktisch vom Markt wieder verschwunden. In einem Cross-Over-Versuch war es Acetazolamid unterlegen.
Dass eine gute Akklimatisation der Höhenkrankheit vorbeugen kann ist unumstritten, ob sie jedoch auch den Schlaf in extremen Höhen wirklich verbessern kann ist fraglich. Wie oben beschrieben, können es ja auch lebenserhaltende Umstände sein, mit denen uns unser Körper am Einschlafen hindern will. Weitere Forschungsergebnisse sollten hier abgewartet werden.
Weiterführende Literatur
Anholm JD, Powles AC, Downey R 3rd, Houston CS, Sutton JR, Bonnet MH, Cymerman A: Operation Everst II: arterial oxygen saturation and sleep at extreme altitude. AM Rev Respir Dis 1992; 145: 817–826.
Burgess KR, Johnson P, Edwards N, Cooper J: Acute mountain sickness is associated with sleep desaturation at high altitude. Respirology 2004; 9: 485–492.
Küpper TE, Strohl KP, Hoefer M, Gieseler U, Netzer CM, Netzer NC: Low-dose theophylline reduces symptoms of acute mountain sickness. J Travel Med 2008; 15: 307–314.
Lahiri S, Barnard P: Role of arterial chemoreflex in breathing during sleep at high altitude. Prog Clin Biol Res 1983; 136: 75–85.
Netzer NC, Strohl KP: Sleep and breathing in recreational climbers at an altitude of 4200 and 6400 meters: Observational study of sleep and patterning of respiration during sleep in a group of recreational climbers. Sleep Breath 1999; 3: 75–82.
Weil JV: Sleep at high altitude. Clin Chest Med 1985; 6: 615–621.
Williams ES: Sleep and wakefulness at high altitudes. Br Med J 1959; 24: 197–198.
2.8 Die Akklimatisation an die Höhe
2.8.1 Einführung
U. Gieseler
Erfolg und Misserfolg, Überleben und Tod liegen an den hohen Bergen sehr oft nahe beieinander. Nicht selten bewegt man sich auf einem schmalen Grat zwischen Erfolg und Misserfolg. Viele äußere, nicht beeinflussbare Faktoren, objektive Gefahren, wie Wetter-, Fels- und Eisverhältnisse, Lawinen oder akute Erkrankungen sind dabei mitentscheidend.
Hinweis. Die Akklimatisation während eines Höhenaufenthaltes kann man in gewissen Grenzen beeinflussen, wenn man die Gesetzmäßigkeiten der Höhe kennt und sie respektiert. Ohne Akklimatisation wird es keinen Gipfelerfolg geben, trotz der heute hervorragenden Ausrüstung, Technik und Trainingsmethoden. Teilnehmer von Trekkingtouren oder Expedition sollten deshalb eine genaue Kenntnis darüber haben.
Die Signale unseres Körpers in der Höhe sind vielfältig. Um sie richtig interpretieren zu können, bedarf es einiger Höhenerfahrung. Nicht jedem Zipperlein und Unwohlsein kann und muss nachgeben werden. Zu erkennen, wann es bedrohlich wird und was nur harmlos ist, ist eine manchmal nicht einfache Entscheidung, die oft nur aus dem Bauch heraus zu treffen ist! Ein Grundsatz für die großen Höhen lautet daher: „Höhenbergsteigen ist Leidensfähigkeit!“
Es erfordert oft schon ein hohes Maß an Masochismus, um bei Wind, Kälte, Eis und Schnee über Wochen im engen Zelt mit weitgehend fehlender Körperhygiene zu leben, und schwere Lasten zu schleppen, um dann unter Lebensgefahr über den Gipfel dorthin wieder zurückzukehren, wo man ja vorher schon war!
Grundsätze zur Akklimatisation
Äußere, nicht beeinflussbare Faktoren. Welche äußeren, nicht beeinflussbaren Faktoren spielen in der Höhe eine Rolle und wie beeinflussen sie die Leistung unseres Körpers?
■ Abnahme von
– Luftdruck, abhängig von Höhe und Breitengrad,
– Sauerstoffpartialdruck,
– Leistungsfähigkeit von 1 % pro 100 Höhenmeter,
– Temperatur von 0,6 °C pro 100 Höhenmeter,
– Luftfeuchtigkeit von 2,5 % pro 100 Höhenmeter;
■ Zunahme der UV-Strahlung von etwa 1–2 % pro 100 Höhenmeter;
■ Zunahme vom Wind mit dem Windchillfaktor.
Bedeutung von Luftdruck und Breitengrad für die Akklimatisation. Durch die tangentiale Sonneneinstrahlung an den Polen dehnt sich die Atmosphäre aufgrund der geringeren Erwärmung der Oberfläche weniger aus als am Äquator, d. h., die Luftdruckabnahme ist mit der Höhe dort größer als in einem südlicheren Gebirge wie dem Himalaya oder am Äquator.
Parallel zum abnehmenden Luftdruck reduziert sich auch der Sauerstoffpartialdruck in der Atmosphäre und den Lungenbläschen. Mit zunehmender Höhe wirkt sich dies negativ auf die Diffusion des Sauerstoffs von den Lungenbläschen in die roten Blutkörperchen aus. Es fehlt einfach der dazu erforderliche Druck von außen. Die Folge ist eine Abnahme der Leistungsfähigkeit in der Höhe von 10 % pro Tausend Höhenmeter.
Berge in Polnähe sind daher schwieriger zu besteigen als am Äquator. Durch den geringeren Luftdruck am 63. Breitengrad entspricht der 6194 m hohe Mount McKinley in Alaska einem 7000 m hohen Berg, der am 28. Breitengrad im Himalaya liegt.
Hoch- und Tiefdruckgebiete können in gewissem Umfang an hohen Bergen die Leistungsfähigkeit beeinflussen. Hochdruck führt zu absinkenden Luftmassen und einem damit zunehmenden Druck, Tiefdruck bewirkt das Gegenteil. Ein sinkender Luftdruck von 1 hPa entspricht einer Höhenzunahme von 10 m am momentanen Standort.
Hinweis. Fallender Luftdruck kann in einem Tiefdruckgebiet 30–45 hPa ausmachen, entsprechend einer Höhenzunahme von 300–450 m. Ohne ausreichende Akklimatisation kann dies an hohen Bergen kritisch sein.
Niedriger Luftdruck reduziert in großen und extremen Höhen zusätzlich die körperliche Leistungsfähigkeit. Nach Literaturangaben geht am Mount Everest ein Abfall des Luftdruckes um 5 % mit einer Abnahme der Leistungsfähigkeit um 25 % im Gipfelbereich einher!
Zeitlicher Ablauf und beeinflussbare Maßnahmen. Akklimatisation ist ein Anpassen des Körpers an die subakute Hypoxie. Eine akute Hypoxie wäre für den menschlichen Körper nur über wenige Minuten zu tolerieren.
Am Beginn steht die sympathogen ausgelöste Steigerung von Atem- und Herzfrequenz, getriggert über die arterielle Hypoxämie, die von den Chemorezeptoren am Glomus caroticum beider Halsschlagadern registriert wird (s. weitere Reaktionen im Kap. 2.3, Höhenphysiologie). Beides geschieht reflektorisch, zusätzlich lässt sich das Atemminutenvolumen jedoch auch durch gezielte Mehratmung erhöhen. Durch bewusste Hyperventilation in den ersten 1–2 Stunden auf einer neuen Höhe kann dem Körper mehr Sauerstoff zugeführt werden als unter normaler Ruheatmung.
Auch langsames Weiteraufsteigen von maximal 200 Höhenmetern über die jeweilige Schlafhöhe hinaus ohne Stress und Gepäck unterstützt diese Akutphase der Anpassung über eine vermehrte Atmung. Durch vermehrtes Abatmen von CO2 steigt die O2-Konzentration in den Alveolen.
Abb. 2.21: Zusammenhang von Ventilation, Atem- und Herzfrequenz in der Höhe im Verhältnis zum Sauerstoffpartialdruck
Im Verlaufe von mehreren Tagen normalisieren sich Herz- und Atemfrequenz. Wie schnell und ausgeprägt die Reaktion des Atemzentrums auf den Hypoxiereiz erfolgt, hängt von der individuellen HVR ab. Die hohe HVR mancher Individuen ist für eine schnelle Akklimatisation äußerst hilfreich. Wie Untersuchungen von West zeigten, lässt sich das Atemminutenvolumen mit zunehmender Höhe zunächst kontinuierlich weiter steigern (Abb. 2.21).
Jenseits von 5000 m nehmen sowohl Atemminutenvolumen wie auch Atemzugvolumen ab, obwohl die Atemfrequenz noch weiter gesteigert werden kann. Mit zunehmender Höhe nimmt, wie schon erwähnt, der O2-Partialdruck nicht nur in der Atmosphäre, sondern auch in den Lungenbläschen ab. Der erforderliche Druck, der für die Diffusion des Sauerstoffs aus den Alveolen in die Erythrozyten nötig ist, verringert sich immer weiter.
Mit zunehmender Höhe wird es schwieriger, die roten Blutkörperchen noch ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Die kontinuierlich abnehmende Diffusion ist in großer Höhe der eigentliche limitierende Faktor der Leistungsfähigkeit, vorausgesetzt, die Atemmuskulatur ist ausreichend trainiert. (s. Kap. 3.1, Belastung alpiner Sportarten).
Herzfrequenz und Akklimatisation
Die Herzfrequenz normalisiert sich bei Verbleiben auf gleicher Höhe und zunehmender Akklimatisation innerhalb weniger Tage oder liegt nur leicht über dem Talwert. Dies gilt allerdings nicht für die großen und extremen Höhen. Hier bleibt die Ruheherzfrequenz erhöht.
Hinweis. Ein morgendlicher Ruhepuls > 20 % über der zuvor in Tallage bestimmten Ruhefrequenz, ist fast immer ein Zeichen einer noch nicht abgeschlossener Akklimatisation. Ausnahmen sind durch akute Infekte oder einen relevanten Flüssigkeitsmangel bedingt.
Vor einem Höhenaufenthalt sollte in den Tagen vor Abreise der morgendliche Ruhepuls im Liegen zum Vergleich bestimmt werden. Eine Höhendiurese von 1 Liter oder mehr über Nacht ist Zeichen einer erfolgreichen Akklimatisation. Durch die Verminderung des Plasmavolumens steigt, wie beschrieben, der Hämatokrit an und die O2-Transportfähigkeit verbessert sich. Bei zusätzlichem Flüssigkeitsverlust durch eine Diarrhoe oder fehlender Zufuhr sinkt die O2-Transportfähigkeit und damit auch die Leistungsfähigkeit.
Grenzen der Akklimatisation
Hinweis. Eine Akklimatisation ist beim Menschen nur bis in Höhen von etwa 5300 m möglich. Dies ist sehr lange schon bekannt von südamerikanischen Bergarbeitern. Oberhalb dieser Höhe gibt es keine vollständige Akklimatisation mehr, sondern nur noch eine Anpassung an die Höhe über die Steigerung der Ventilation.
Bei weiterem Verbleib in der Höhe entwickeln sich ein rapider körperlicher Abbau mit Abnahme der Muskelmasse und eine Reduktion der Leistungsfähigkeit („High Altitude Deterioration“). Ein dauerhafter Aufenthalt in diesen Höhen ist nicht möglich.
Hinweis. Zusammengefasst gilt für die verschiedenen Höhenstufen:
– Mittlere Höhe (1500–3500 m): Sofortanpassung ist ausreichend
– Große Höhe (3500–5300 m): Akklimatisation erforderlich
– Extreme Höhe (5300–8850 m): nur noch über die Atemanpassung möglich
Ventilatorische Akklimatisation
Die Hyperventilation über die Lungen steigt im Verlauf eines Höhenaufenthaltes weiter an, wodurch pO2 und Sauerstoffsättigung ansteigen. Diesen Effekt bezeichnet man als ventilatorische Akklimatisation. Da sich der menschliche Körper nur bis in Höhen von etwa 5300 m komplett akklimatisieren kann, spielt sie in den großen und extremen Höhen oberhalb 5300 m die entscheidende Rolle. Ohne ventilatorische Akklimatisation wäre ein Aufstieg in große Höhen ohne künstlichen Sauerstoff nicht möglich. Sie erhöht den pO2 in den Alveolen und durch die Linksverschiebung der O2-Bindungskurve kann Sauerstoff besser aufgenommen werden.
Wie schon ausgeführt, führt die Hyperventilation zu einer Abnahme des pCO2. Durch diese vermehrte Abatmung von Kohlendioxyd wird über Chemorezeptoren im Gehirn der Atemantrieb im Atemzentrum gebremst, im Gegenzug jedoch stimuliert ihn die Hypoxie. Diese Anpassung der Rezeptoren im Gehirn auf die Hypoxie ist beim Menschen individuell unterschiedlich stark ausgeprägt.
Abnahme der Steigleistung in der Höhe
Die Abnahme der Leistungsfähigkeit macht sich ab einer Höhe von 1500 m mit 10 % pro 1000 Höhenmeter bemerkbar. Daher nimmt die Steigleistung in Höhenmetern pro Stunde ebenfalls ab.
Trotz Akklimatisation und Anpassung an verschiedene Höhenstufen resultiert immer eine inverse Beziehung zwischen Höhe und Leistungsfähigkeit (Tabelle 2.9).
Tabelle 2.9: Steigleistung pro Stunde am Beispiel von 300 bzw. 500 hm/h
| Höhe[m] | Leistung [hm/h] | |
| Bis 2500 | 300 | 500 |
| 3000 | 255 | 425 |
| 4000 | 225 | 375 |
| 5000 | 195 | 325 |
| 6000 | 165 | 275 |
| 7000 | 135 | 225 |
| 8000 | 105 | 175 |
Fallbeispiel: Als Messner und Habeler den Everest ohne Sauerstoff bestiegen, schafften sie eigenen Angaben zum Schluss nur noch 100 m/h. Am Wohnort jedoch legte Messner auf einer 6 km langen Straße 1000 hm in 35 min zurück!
Schlafhöhe und Höhenbergsteigen
Die folgende Abbildung von Höhenreich zeigt Höhensteigerungen nach verschiedenen Literaturangaben (Abb. 2.22). Alle Angaben beziehen sich auf die Schlafhöhe und nicht etwa auf die Anstiegshöhe am Tage.
Abb. 2.22: Empfehlungen zur Schlafhöhensteigerung anhand verschiedener Literaturangaben
Kompaktinformation
Lässt sich ein Aufstieg von 1000 m oder mehr nicht vermeiden, sollten wenigstens die nächsten 2 Tage auf dieser Höhe und ohne große körperliche Anstrengung verbracht werden. Ernsthafte Höhenprobleme erfordern immer einen Abstieg bis zum letzten beschwerdefreien Schlaflager.
Ein Aufstieg am Tage von 1000 und mehr Höhenmeter sind kein Problem. Wesentlich ist nur, nachts wieder auf der Höhe vom Vortage zu schlafen. Es sollte immer so tief wie möglich geschlafen werden: Go high – sleep low!
In der Akutphase einer Akklimatisation müssen anaerobe Belastungen möglichst vermieden werden.„Sich nicht zu Tode schleppen“ heißt ein wichtiger Grundsatz der Höhentaktik in dieser für den Körper so sensiblen Phase.
Nach einem Gipfelgang muss ein weiterer Verbleib in der Höhe möglichst kurz gehalten werden. Es ist wichtig, so konditionell machbar, so weit wie möglich abzusteigen. Unnötig lange Aufenthalte in extremer Höhe sind immer zu vermeiden.
Soweit es vom Gelände her möglich ist, sollte die tägliche Schlafhöhe nicht mehr als 300–600 m nach oben verlegt werden. Die individuelle Schlafhöhenverträglichkeit ist allerdings sehr unterschiedlich.
Bedeutung von Aufstiegsprotokollen
Sehr hilfreich sind Aufstiegsprotokolle mit Angaben zur Höhe, der Zeit in Tagen sowie Wegstrecken („Höhenprofil“, Abb. 2.23). Manche Agenturen stellen sie ihren Kunden vor Reisebeginn zur Verfügung.
Hinweis. Das Problem kommerzieller Anbieter ist, dass unter dem Druck von Zeit und Kosten der Trend zu immer kürzeren Reisen geht. Der Kilimanjaro mit fast 6000 m wird inzwischen schon in 4 Tagen angeboten, aus höhenmedizinischer Sicht der absolute GAU.
Grafische Darstellungen helfen schon im Vorfeld, kritische Schlafplätze zu erkennen. Topografische Karten helfen, schnelle und sichere Abstiegswege herauszufinden. Problematisch sind immer die Lagerplätze auf hohen Sätteln oder in Hochtälern, bei denen sowohl vor dem weiteren Aufstieg als auch vor einem Abstieg längere Zeit wieder aufgestiegen werden muss, da ein Abstieg ohne Gegenanstieg vom Gelände her nicht möglich ist.
Vorakklimatisation – Durchführung und Möglichkeiten
Manche Reisen sind ohne schnellen Höhengewinn nicht durchführbar, weil z. B. das Basislager nur per Helikopter oder Jeep erreichbar ist, oder Lagerplätze vom Gelände her vorgegeben sind, z. B. bei fehlendem Wasser. Dann sollte man vor Reisebeginn eine Vorakklimatisation in Erwägung ziehen, beispielsweise in den Alpen. So lassen sich Höhenprobleme bei Beginn der Tour und schnellem Aufstieg vermeiden, besonders bei anfälligen Individuen.
Abb. 2.23: Aufstiegsprotokoll zum Island Peak/Nepal (Stefan Schöfer, DAV Karlsruhe)
Hinweis. Der Sinn einer Vorakklimatisation ist niemals, eine bestimmte Bergtour schneller als üblich durchzuführen, sondern es geht ausschließlich um Vermeidung gravierender Höhenprobleme besonders anfälliger Personen.
Nach einer Untersuchung in Nepal werden Trekker organisierter Touren deutlich häufiger höhenkrank und es sterben 4-mal mehr Touristen als Individualreisende. Diese können sich ihre Zeit einteilen, der organisiert Reisende ist jedoch an einen festen Plan gebunden.
Arten der Vorakklimatisation. Es gibt zwei grundsätzliche Varianten zur Vorakklimatisation, entweder man schläft mehrere Tage auf hoch gelegenen Hütten oder hält sich intermittierend oder nachts in einer Hypoxiekammer auf, wie diese heute in verschiedenen Städten Deutschlands kommerziell angeboten werden.
Vorakklimatisation in hypobarer Hypoxie: Eine Vorakklimatisation auf einer hochgelegenen Hütte entspricht den physiologischen Gegebenheiten der Höhe, also einem Aufenthalt in hypobarer Hypoxie (Hypoxie unter abnehmendem Luftdruck). Für die Vorakklimatisation ist ein Höhenaufenthalt oberhalb der so genannten Schwellenhöhe von 2500 m erforderlich. Höhen zwischen 2500 m und maximal 3500 m sind sinnvoll. Findet sich jedoch keine Möglichkeit, irgendwo oberhalb von 2500 m zu schlafen, sondern nur z. B. auf 2000 m oder 2200 m, so ist aus eigener Erfahrung dies sicherlich nicht optimal, aber immer noch besser als ein Verbleiben im heimatlichen Flachland.
Hoch gelegene Hütten, wie z. B. die Theodulhütte oberhalb von Zermatt auf 3300 m oder die Mönchsjochhütte bei Grindelwald auf 3600 m, sind ideal zur Vorakklimatisation. Da sie per Seilbahn erreichbar sind, ist bei einem Schlechtwettereinbruch ein schneller und sicherer Abstieg immer gewährleistet.
Vorakklimatisation in normobarer Hypoxie: Eine Hypoxiekammer oder ein Hypoxiezelt ermöglichen einen Aufenthalt in normobarer Hypoxie, stellen also keine Unterdruckkammer dar, in der man schläft oder trainiert. Der Luftdruck bleibt jetzt konstant, die Sauerstoffzufuhr jedoch wird vermindert.
Vermutlich ist es effektiver, sicher aber weniger zeitaufwändig, 1 bis 2 Wochen nachts in normobarer Hypoxie zu schlafen und sich bis auf etwa 4000 m zu akklimatisieren. Höhen bis 6000 m sind möglich, jedoch nicht nötig. Derartige Zelte (z. B. „Höhenbalance“) kann man sich von den Firmen für ca. 400 € pro Woche ausleihen, man muss sie nicht selbst kaufen oder in einem Zentrum schlafen. Alternativ kann man in einigen Hypoxietrainingszentren schlafen, was meist deutlich billiger ist.
Dauer der Vorakklimatisation. Aus Erfahrung ist bekannt: Je öfter und länger sich jemand jährlich in der Höhe aufhält, desto günstiger wirkt sich dies auch auf seine Höhentauglichkeit aus. Offensichtlich entwickelt der Körper ein „Erinnerungsvermögen“ für die Hypoxie, wie R. Messner es einmal formulierte.
Die persönliche Erfahrung bestätigt dies. Eventuell hält die Akklimatisation sogar länger an, als man dies heute methodisch nachweisen kann. Nach mehreren Höhenaufenthalten innerhalb eines Jahres lag zwischen einer 3-wöchigen Trekkingtour in Nepal mit maximaler Höhe von 6200 m sowie einer Expedition auf 7000 m ein 5-wöchiger Aufenthalt in der Ebene. Dieser Zeitraum war offenbar nicht zu lang, um sich trotzdem schnell wieder ohne Höhenprobleme anzupassen.
Die Zeit der Vorakklimatisation sollte immer möglichst kurz vor dem Abflugtermin liegen. In der Literatur wird die anhaltende Dauer einer Akklimatisation mit 10–12 Tagen angegeben. Nur so lange ließ sich eine Wirkung in Studien nachweisen.
Hinweis. Höhenanfällige Personen sollten unabhängig von einer Vorakklimatisation immer langsam aufsteigen, soweit dies eben bei einer kommerziellen Reise möglich ist.
Kompaktinformation
1. Akklimatisation für längere Aufenthalte ab einer Schwellenhöhe von 2500 m
2. Nicht zu schnell zu hoch aufsteigen
3. Nicht mehr als 300–600 m pro Tag das Schlaflager höher verlegen
4. Ist eine Verlagerung der Schlafhöhe von 1000 m nicht zu vermeiden, die nächsten 2 Tage auf dieser Höhe eine Ruhepause einlegen
5. Möglichst tiefe Schlafhöhe: go high – sleep low
6. Vermeiden anaerober Belastungen in den ersten Tagen
7. Nach dem Gipfeltag so schnell und so weit wie möglich absteigen – unnötige Aufenthalte in großen Höhen sind zu vermeiden.
Nach einer Untersuchung von Schneider in Heidelberg wurden in einer kontrollierten Studie diejenigen, die langsam, aber ohne Vorakklimatisation auf 4600 m aufstiegen 3-mal häufiger bergkrank als diejenigen, die ebenfalls langsam, aber mit Vorakklimatisation aufstiegen. Und in der Gruppe ohne Vorakklimatisation und zusätzlichem schnellem Aufstieg, erkrankten 60 % der Teilnehmer an einer AMS, gegenüber 30 % mit Vorakklimatisation, aber trotzdem schnellem Aufstieg.
Hinweis. Es zeigte sich: Ein Aufenthalt von insgesamt 14 Tagen in den zurückliegenden 2 Monaten reichte zur Vorakklimatisation aus. Zusammengefasst ist also ein langsamer Aufstieg in Verbindung mit einer Vorakklimatisation die sicherste Art, Höhenprobleme zu vermeiden, insbesondere bei anfälligen Personen.
2.8.2 Wiederholte Höhenaufenthalte/intermittierende Hypoxie
M. Faulhaber
Definition und Einleitung
Werden wiederholte Sauerstoffmangelexpositionen (Hypoxie) durch normoxische (normaler Sauerstoffgehalt) Phasen unterbrochen, so spricht man von intermittierender Hypoxie (IH). Die Kombination von hypoxischen und normoxischen Phasen kann dabei beliebig variieren. So exponiert sich beispielsweise der Bergsteiger, der eine einwöchige Hochtour mit Gipfelbesteigungen und Hüttenübernachtungen durchführt, ebenso IH wie der Alpinskifahrer. Der Sauerstoffmangel wird entweder durch Aufenthalte in natürlicher Höhe oder durch simulierte Höhenbedingungen erreicht (Tabelle 2.10). Als Abgrenzung zum Höhentraining nach der Variante „live high – train low“ wird nachfolgend ausschließlich auf IH mit hypoxischen Expositionszeiten unter 6 Stunden eingegangen. Ebenso werden spezielle pathologische intermittierende Hypoxiezustände, wie sie beispielsweise bei Schlafapnoe auftreten, nicht behandelt. Als Synonym für IH wird in der Literatur teilweise auch der Begriff „Intervallhypoxie“ verwendet.
Folgende Parameter sind kennzeichnend für IH (IH-Protokolle):
■ Die Intensität ergibt sich aus der Höhe oder der inspiratorischen Sauerstoffkonzentration (FIO2) als Äquivalent dazu. So entspricht beispielsweise ein FIO2 von 12,5 % einer Höhe von ca. 4000 m.
■ Die Dauer und die Wiederholungszahl der einzelnen Hypoxieexpositionen sowie das Verhältnis von hypoxischen zu normoxischen Phasen ergeben das zeitliche Gefüge des IH-Protokolls. Es werden
a) wiederholte kurze hypoxische Expositionen (3–5 min) wechselweise mit ungefähr gleichlangen normoxischen Phasen für 1–2 Stunden pro Tag oder
b) kontinuierliche Hypoxieexpositionen von einer bis zu mehreren Stunden (einmal pro Tag)
angewendet. Die Gesamtdauer der IH-Anwendung variiert typischerweise von ca. 5 Tagen bis zu 6 Wochen.
■ Von Bedeutung ist auch, ob die Person während der Hypoxieexposition passiv (nur Hypoxie) oder (teilweise) körperlich aktiv (Hypoxie plus Training) ist.
Ähnlich wie beim sportlichen Training (z. B. Intervalltraining) hängen die erwirkten Anpassungen des menschlichen Organismus maßgeblich vom IH-Protokoll ab. Aus der Vielzahl der möglichen IH-Protokolle lässt sich leicht erkennen, dass dadurch die unterschiedlichsten Reaktionen – positiver wie negativer Art – ausgelöst werden können. Allerdings steckt die systematische Forschung in diesem Bereich noch in den Kinderschuhen. Die Effekte verschiedener IH-Protokolle und deren Wirkungsmechanismen sind wissenschaftlich noch nicht umfassend erklärt. Somit können momentan oftmals noch keine eindeutigen und wissenschaftlich abgesicherten Aussagen über die Wirksamkeit oder die Unwirksamkeit von IH gemacht werden.
Tabelle 2.10: Methoden zur Höhensimulation und deren praktische Aspekte
| Hypobare Hypoxie | Normobare Hypoxie | ||
| Beispiele aus der Praxis | Aufenthalt in Unterdruckkammer | Aufenthalt in Hypoxiezelt oder -kammer (normobar) | Atmung eines hypoxischen Gasgemisches über eine Maske |
| Höhensimulation | Sauerstoffmangel und Unterdruck | Sauerstoffmangel | Sauerstoffmangel |
| Aufwand (finanziell und infrastrukturell) | Sehr hoch | Hoch | Eher gering |
| Beeinflussung physiologischer Reaktionen | Event. durch Kammeraufenthalt | Gering, event. bei kleinen Kammern oder Zelten | Atmung kann durch Maske verändert werden |
| Wechsel zu Normoxie | Nur mit Zeitverzögerung möglich | Jederzeit möglich | Jederzeit und in kurzen Abständen möglich |
Praktische Anwendungsbereiche von intermittierender Hypoxie
IH wird seit Jahrzehnten vorwiegend von Ärzten in der ehemaligen UDSSR zur Therapie verschiedenster Erkrankungen erforscht und angewendet. Erst in jüngerer Zeit entdeckte der Leistungssport IH als Variante zum Höhentraining, wobei eine Steigerung der Ausdauerleitungsfähigkeit in Tallage durch IH kontrovers diskutiert wird. Für den Bergsport sind besonders die Effekte der IH interessant, die Mechanismen der Akklimatisation auslösen und somit zur Prophylaxe höhenbedingter Erkrankungen oder zur Leistungssteigerung in der Höhe dienen können.
Intermittierende Hypoxie bis zu 1 Stunde pro Tag über maximal 1 Woche. Bereits kurz andauernde Hypoxieexpositionen (unter 1 Stunde auf 4000 m) führen zu einer erhöhten Empfindlichkeit der peripheren Sauerstoffsensorik und somit zu einer Steigerung der hypoxischen Atemantwort (Hypoxic Ventilatory Response – HVR). Diese Anpassungen sind auch wesentlicher Bestandteil der ventilatorischen Akklimatisation unter chronischer Hypoxie. Bei Expositionszeiten von ca. 1 Stunde konnte bei geringeren Hypoxiegraden (z. B. 2500 m) keine HVR-Erhöhung beobachtet werden, bei lang andauernden Expositionszeiten (z. B. 20 Tage à 8–10 Stunden pro Tag auf 2650 m) war dies hingegen der Fall. Der Anstieg des HVR durch IH scheint schneller zu erfolgen als dies unter chronischer Höhenexposition der Fall ist. Das Maximum der HVR-Steigerung dürfte, individuell verschieden, nach 4 bis 7 Expositionen erreicht sein. Allerdings zeigt die Mehrzahl der Studien, dass der durch IH erzielte HVR-Anstieg eher kurzlebig ist und für maximal 1 Woche nach Beendigung der IH-Anwendung erhalten bleibt. Aus Beobachtungen an Einzelfällen kann vermutet werden, dass Personen mit einem niedrigen HVR (z. B. für ein Höhenlungenödem anfällige Personen) mit einer besonders ausgeprägten HVR-Steigerung reagieren.
Die Steigerung des HVR führt in Höhen über 4000 m auch bei Belastung zu einer erhöhten Ventilation und Sauerstoffsättigung und dürfte somit auch die submaximale Ausdauerleistungsfähigkeit verbessern. Für Höhenlagen unter 3000 m konnte dieser Effekt nicht gezeigt werden. Bezüglich Prophylaxe der akuten Bergkrankheit (AMS) wird angenommen, dass ein gesteigerter HVR, evtl. zusammen mit einem durch IH-Anwendung reduzierten sympathischen Tonus, die AMS-Inzidenz reduzieren und somit ein praktisch anwendbares Tool zur Vorakklimatisation sein kann. Es liegen allerdings noch keine publizierten wissenschaftlichen Studien vor, die explizit diese Protokolle im Hinblick auf eine AMS-Prophylaxe hin überprüft haben.
Kompaktinformation
Zur kurzfristigen Vorbereitung auf nachfolgende Höhenexpositionen kommen derzeit IH-Protokolle mit folgenden Eckdaten in Betracht:
1. Intensität: Höhe ca. 4000 m bzw. FIO2 ca. 12,5 %
2. Dauer pro Sitzung: 1 Stunde kontinuierliche Hypoxie oder Wechsel von ca. 5-minütigen hypoxischen Intervallen mit gleich langen normoxischen Phasen über 1 Stunde
3. Wiederholungszahl: 4 bis 7 Sitzungen, möglichst an aufeinander folgenden Tagen
4. Passive Exposition
Intermittierende Hypoxie von mehreren Stunden pro Tag über mehr als 1 Woche. Umfangreichere IH-Protokolle mit länger andauernden Expositionen oder Kombinationen aus chronischen mit intermittierenden Aufenthalten dürften neben einer reinen Steigerung des HVR mit weitergehenden ventilatorischen und eventuell auch hämatologischen Adaptationen verbunden sein. Erste Vorakklimatisationsstudien aus der Arbeitsgruppe um Richalet zeigten, dass eine Kombination von chronischem Höhenaufenthalt (1 Woche 4350–4800 m) mit anschließender intermittierender Hypoxie über 4 Tage (5000–8500 m) nachfolgend deutlich schnellere Aufstiegsraten in extreme Höhen zuließen als bei herkömmlichen Expeditionen ohne Vorakklimatisation. Für die Praxis des Höhenbergsteigers und Trekkers sind allerdings aktuelle Untersuchungen, die eine Reduktion der AMS-Symptomatik auf 4300 m durch IH über 3 Wochen (5-mal wöchentlich 4 Stunden) zeigen, von größerer Bedeutung. IH in der angewendeten Weise dürfte für eine Vorakklimatisation auf nachfolgende Höhenaufenthalte, zumindest in Höhen von 4000–5000 m, geeignet sein, zumal es auch zu einer Steigerung der Ausdauerleistung in dieser Höhe kommt. Einschränkend muss erwähnt werden, dass gut kontrollierte Studien auch hierfür noch fehlen.
Kompaktinformation
Zur längerfristigen Vorbereitung auf nachfolgende Höhenexpositionen können derzeit IH-Protokolle mit folgenden Eckdaten empfohlen werden:
1. Intensität: Höhe ca. 4000 m bzw. FIO2 ca. 12,5 %
2. Dauer pro Sitzung: mindestens 4 Stunden kontinuierliche Hypoxie
3. Wiederholungszahl: 7–15 Sitzungen über 1–3 Wochen
4. Passive Exposition; bei mehrwöchigen Programmen ist eventuell eine Kombination mit Belastung zur Leistungssteigerung in der Höhe vorteilhaft
Abschließend muss ergänzt werden, dass IH in den beschriebenen Formen niemals eine adäquate Höhentaktik ersetzen kann. In speziellen Fällen (z. B. zu einem Höhenlungenödem neigende Personen) oder als zusätzliches Tool, dürften die beschriebenen IH-Protokolle den sie anwendenden Personen einen „Akklimatisationsvorsprung“ gegenüber nicht Vorakklimatisierten verleihen.
Weiterführende Literatur
Burtscher M: Intermittierende Hypoxie: Höhenvorbereitung, Training, Therapie. Schweiz Z Sportmed Sporttraum 2005; 53: 61–67.
Burtscher M, Brandstätter E, Gatterer H: Preacclimatization in simulated altitudes. Sleep Breath 2008; 12: 109–114.
Muza SR: Military applications of hypoxic training for high-altitude operations. Med Sci Sports Exerc 2007; 39: 1625–1631.
2.9 Zusatzsauerstoff in extremer Höhe
2.9.1 Sauerstoffgeräte
B. Jelk
Früher wurden die Achttausender alle mit künstlichem Sauerstoff bestiegen. Es war von der medizinischen Einschätzung her für einen Menschen nicht möglich, ohne zusätzlichen Sauerstoff einen Achttausender ohne Schaden zu besteigen.
Die ersten, die eine Besteigung des Everests ohne künstlichen Sauerstoff wagten, waren Messner und Habeler im Jahre 1978. Sie hatten damit bewiesen, dass eine Besteigung des Everests ohne zusätzlichen Sauerstoff möglich ist. Nach dieser geglückten Besteigung wurde immer weniger zusätzlicher Sauerstoff benützt. Ein Grund war, dass die Flaschen aus Stahl und damit sehr schwer waren. Einzig die Japaner am Manaslu hatten Aluminiumflaschen. Auch die Masken schufen Probleme. Sie funktionierten schlecht und konnten nicht gut eingestellt werden. Somit wurde künstlicher Sauerstoff nur für den Notfall mitgenommen. Wir hatten bei der Lhotse-Shar- und der Manaslu-Expedition nur die Höhenlager für den Notfall mit je mit einer Flasche ausgerüstet. Wir hatten aber das Glück, dass beide Expeditionen erfolgreich waren und wir die Flaschen nicht benutzen mussten.
Mit der Entwicklung der neuen Flaschen aus Aluminium und Kunstfaser (Kohlenfaserverbundmaterialien) wurde das Gewicht der Flaschen von bis 6 kg auf 300–600 g reduziert. Auch der Inhalt wurde von 200 auf 300 bar erhöht. Damit stand bei etwa einem Zehntel des ursprünglichen Gewichts plötzlich rechnerisch 1,5-mal so viel Sauerstoff zur Verfügung wie zuvor. Die Masken wurden auch bequemer und besser sowie die Einstellungen viel einfacher. Nach wie vor besteht allerdings gelegentlich das Problem von Leckagen, wodurch viel Sauerstoff verloren gehen kann und das System ineffektiv wird. Potenziell kann dies eine große Gefahr bedeuten, wenn nämlich ein Bergsteiger, der unter Verwendung von Sauerstoff aufsteigt, in extremer Höhe feststellt, dass sein Sauerstoffvorrat sich dem Ende zuneigt und er nun bis zum Erreichen des Lagers mit dem niedrigeren Umgebungssauerstoff zurecht kommen muss – und dies, obwohl er für diese Höhe wahrscheinlich nicht optimal angepasst ist.
Beim Transport des Sauerstoffs traten früher regelmäßig Probleme auf, weil die Druckflaschen aus Metall nicht mit dem Flugzeug transportiert werden durften. Flaschen, die im Land gekauft wurden, waren dagegen oft nicht komplett gefüllt und enthielten in Einzelfällen noch nicht einmal Sauerstoff, sondern Druckluft. Auch wenn Letzteres kaum noch vorkommt, so sollte bei der Übernahme der Füllungsdruck jeder einzelnen Flasche überprüft werden. Unbedingt müssen auch die Ventile, Druckmesser, Durchflussmesser und Masken auf einwandfreien Zustand überprüft werden, bevor man aufbricht. Die erwähnten Karbonfaserflaschen stehen in den meisten Zielregionen nur im Ausnahmefall zur Verfügung. Im Gegensatz zu Metallflaschen dürfen sie jedoch im internationalen Luftverkehr mitgeführt werden.
Alle „klassischen“ Systeme haben den Nachteil des „continuous flow“, d. h. dass ein wesentlicher Teil des Zusatzsauerstoffs bei jedem Ausatmen verloren geht, also im eigentlichen Sinne „umsonst“ mitgeschleppt wird. Hier haben Kreislauf- oder Demandsysteme einen besonderen Vorteil. Erstere entziehen der Ausatemluft das überschüssige CO2, reichern es mit gerade der nötigen Menge an O2 an und führen es der Atmung zurück. Bei Letzteren geht zwar die Ausatemluft komplett an die Umgebungsluft verloren, aber das System gibt nur kurz zu Beginn der Einatemphase Sauerstoff ab, der dadurch weit umfänglicher für den Körper nutzbar ist.
Prinzipiell dürfen diese Systeme im Flugzeug transportiert werden (entsprechende Zertifikate liegen beim Kauf bei), nach dem 11. September ist es aber sinnvoll, rechtzeitig mit der zuständigen Fluggesellschaft Kontakt aufzunehmen. Eine besondere Verbreitung dürften diese Systeme aufgrund ihres enorm guten Gewicht-Nutzen-Verhältnisses vor allem als Notfallausrüstung haben.
Hinweis. Achtung: Auf sorgfältige Handhabung, v. a. der CO2-Absorber, achten! Bei falscher Benutzung können Verätzungen – schlimmstenfalls der Atemwege – auftreten!
2.9.2 Physiologische Veränderungen bei der Verwendung von Zusatzsauerstoff
T. Küpper
Die Diskussion über die Verwendung von Zusatzsauerstoff ist uralt: Die ersten Überlegungen wurden bereits von Paul Bert 1878 angestellt. Beim Besteigungsversuch des Everest von Mallory und Finch zeigte sich, dass Finch, der im Gegensatz zu Mallory Sauerstoff benutzte, eine deutlich höhere Aufstiegsgeschwindigkeit hatte. Die Möglichkeit, den Everest ohne Sauerstoff zu besteigen, wurde in der „klassischen“ Zeit im Gegensatz zu später nie ernsthaft in Zweifel gezogen. Und auch noch, als bereits Expeditionen mit Sauerstoff unterwegs waren, zeigte Kellas 1922 anhand von theoretischen Überlegungen nicht nur, dass dies möglich sein müsse, sondern er errechnete auch die im Gipfelbereich zu erwartende Aufstiegsgeschwindigkeit. Seine Resultate waren geradezu verblüffend genau: Messner und Habeler waren 1978 in genau der Geschwindigkeit unterwegs, die Kellas 56 Jahre zuvor vorausgesagt hatte!
Die – übrigens jahrelang nicht unbestrittene These – für die Verwendung von Zusatzsauerstoff besagte, dass in extremer Höhe die körperliche Leistungsfähigkeit gesteigert werden kann. Trotz der erwähnten Beobachtungen auf der Everest-Expedition 1922 hielt sich mehrere Jahrzehnte das Gegenargument, dass die Zusatzlast die Benutzer langsamer mache und dass deshalb die Verwendung nicht lohne. Immer wieder konnte die Steigerung der Aufstiegsgeschwindigkeit jedoch gezeigt werden. Man kann es auch so formulieren: Das Zusatzangebot „reduziert die aktuelle Höhe“ (Abb. 2.24). Dies geschieht allerdings nicht in dem Ausmaß, wie R. Messner es formuliert: „Sauerstoff degradiert den Everest zu einem Sechstausender“. Wie Abb. 2.24 zeigt, befindet sich der Alpinist auf dem Everest-Gipfel abhängig vom Ausmaß der Sauerstoffzufuhr auf 7400–8400 m. Spätestens seit Entwicklung der Karbonfaserflaschen spielt das Zusatzgewicht eine nachrangige Rolle.
Das Ausmaß der Sauerstoffzufuhr ist also ein ganz entscheidender Punkt, und zwar im doppelten Sinne: physiologischer Effekt auf der einen Seite und mitzuführender Bedarf auf der anderen Seite. Beides erhöht sich mit dem Ausmaß der Steigerung des inspiratorisch zugeführten Sauerstoffs (FiO2). Die Atemmechanik und die Maskenkonstruktion setzen der Steigerung wiederum technische Grenzen. Über diese Zusammenhänge sind zu im Höhenbergsteigen verwendeten Masken keine vergleichbaren Studien publiziert, jedoch ist aus der Notfallmedizin bekannt, dass sich bei Verwendung einer reinen Nasensonde der FiO2 nur um etwa 3–4 % steigern lässt, bei Atemmasken ohne Reservoirbeutel um etwa 10 % und bei Masken mit Reservoirbeuteln um bis etwa 25 % (jeweils bei hohem Sauerstoffflow). Die hohen Flussraten von deutlich über 4 l/min sind beim Höhenbergsteigen jedoch unrealistisch, weil es unmöglich ist, einen dafür ausreichenden Vorrat zu tragen. Mit einem üblichen Masken-Beutel-System und in der Höhe üblichen Flussraten von 0,5–2 l/min (nur kurzfristig, z. B. in Steilpassagen, mehr) sind die in Abb. 2.26 dargestellten Werte dagegen eher realistisch.
Abb. 2.24: Äquivalenzhöhen bei Verwendung von Zusatzsauerstoff
Die Vorteile der Sauerstoffbenutzung in extremer Höhe liegen augenscheinlich vor allem im Bereich der Erhöhung der Sicherheit bzw. Verminderung der Todesrate. Es muss betont werden, dass es sich bis zum ausstehenden Beweis einer Korrelation lediglich um eine Koinzidenz, also das zufällige gleichzeitige Auftreten zweier Ereignisse, handelt. Der Beweis, dass die Verwendung von Zusatzsauerstoff die Sicherheit erhöht, steht aus! Beispielsweise könnten diejenigen, die Zusatzsauerstoff verwenden, ein grundsätzlich wesentlich größeres Sicherheitsbedürfnis haben und dadurch ihre Hochlager besser ausstatten und nur bei besonders sicherem Wetter den Gipfelgang angehen. Dann wäre dies sicher der Primärfaktor für die geringere Todesrate. Dessen ungeachtet gibt es jedoch beeindruckende Zahlen:
Im Zeitraum 1978–1999 benutzten 8,9 % der erfolgreichen Bergsteiger („Summiter“, n = 1173) am Everest Zusatzsauerstoff, zumeist ab dem South Col (bzw. der analogen Höhe auf anderen Routen). 40 von ihnen starben beim Abstieg. Die Todesrate lag bei denen, die ohne Zusatzsauerstoff unterwegs waren, mit 8,3 % immerhin fast dreimal so hoch wie bei denen, die Zusatzsauerstoff benutzten (3 %). Am K2 ist dies noch extremer: Insgesamt waren hier im Zeitraum 1978–1997 164 Alpinisten erfolgreich. Von diesen waren 71,3 % ohne Zusatzsauerstoff unterwegs. Von Letzteren starben 18,8 % beim Abstieg, während bei denen mit Sauerstoff kein einziger starb (Gesamttodesrate am K2 im genannten Zeitraum 13,4 %).
Aus diesen Zahlen ist keinesfalls zu schließen, dass die Gesamtzahl der Toten am Berg durch die Verwendung von Sauerstoff sinkt. Die Zylinder müssen in die Höhe geschafft werden und sollten im Übrigen aus Umweltschutzgründen auch wieder mit herab gebracht werden. Somit sind nicht nur mehr Personen dem Risikogelände exponiert, sondern auch individuell länger und öfter. Es liegen beispielsweise keinerlei Daten vor, ob nicht mehr Menschen (Porter!) im Khumbu-Eisbruch (Everest) beim Transport vieler Sauerstoffflaschen sterben als die Zahl der Toten, die im Gipfelbereich durch die Verwendung des Sauerstoffs vermieden werden.
Hinweis. In letzter Zeit werden in manchen Regionen spraydosenähnliche Sauerstoffflaschen zur Besserung von Höhensymptomen und im Einzelfall auch zum Aufstieg angeboten. Finger weg! Sie sind mit 14 bar gefüllt und bieten nur für einige wenige Minuten Sauerstoff, auch bei sparsamster Verwendung viel zu wenig, um einen Höhenkranken zu behandeln oder einen Aufstieg zu versuchen! Würden nicht immer wieder ahnungslose Alpinisten darauf hereinfallen, wäre das Angebot von „sauerstoffangereichertem Trinkwasser“ zur Linderung von Beschwerden und Besserung der Leistungsfähigkeit in der Höhe eigentlich ein netter Scherz. Es hat nur einen einzigen Effekt, der es von normalem Wasser unterscheidet: Es ist bei 2–3 US$ pro Flasche für den Verkäufer ein gutes Geschäft.
Neben der Benutzung zum Aufstieg wird Zusatzsauerstoff in den Hochlagern verwendet. Hier wird ein Effekt genutzt, der seit Paul Bert, Angelo Mosso und Nathan Zuntz, also seit über 100 Jahren, wohlbekannt ist: die Verbesserung des Schlafs. Mit zunehmender Höhe tritt eine signifikante Zunahme von Apnoephasen ein, die zunächst die O2-Sättigung auf relativ hohem mittleren Niveau stabilisieren, in noch größerer Höhe aber schließlich zum Problem werden, weil ein Schlaf im eigentlichen Sinne nicht mehr möglich ist. Hier setzt die nächtliche O2-Gabe ein: Neben einer Verbesserung der SaO2 tritt eine Verringerung der Herzfrequenz, eine Minderung des Atemminutenvolumens, aber vor allem eine signifikante Verbesserung der Schlafstruktur mit Minderung der Apnoephasen ein. Die Benutzer fühlen sich am nächsten Morgen deutlich erholter als diejenigen, die ohne Sauerstoff die Nacht verbracht haben. Es ist bislang nicht bewiesen, dass die nächtliche Sauerstoffbenutzung über den rein subjektiven Effekt, eine bessere Nacht verbracht zu haben, hinausgeht, also dass das Risiko für Höhenprobleme gesenkt oder die Leistungsbereitschaft am folgenden Tag durch die subjektiv bessere Erholung gesteigert wird.
2.9.3 Anwendungspraxis und ethische Fragen
B. Jelk
Seitdem der Trishul (7120 m, Garhwal-Himal/Indien) als erster Berg von einer britisch-französischen Expedition im Jahre 1907 mit Zusatzsauerstoff erstbestiegen worden ist, wird von Alpinisten in großer Höhe regelmäßig Sauerstoff eingesetzt, wenn auch heute nicht mehr unterhalb der 8000-m-Marke und auch an den niedrigen Achttausendern nur im Ausnahmefall oder zeitweilig, beispielsweise zum Schlafen. Die Trisul-Besteigung war damals bahnbrechend, dauerte es doch 21 Jahre, bis ein höherer Berg bestiegen werden konnte.
Bereits von Anbeginn an entzündete sich unabhängig von jeglicher physiologischer Überlegung eine teilweise heftige Debatte über die ethischen Aspekte einer Besteigung mit Sauerstoff. Berühmt ist das Zitat von Mallory, der 1922 am Everest trotz der höheren Aufstiegsgeschwindigkeit seiner „sauerstoffgeschwängerten“ Partner feststellte: „When I think of mountaineering with four cylinders of oxygen on one’s back and a mask over one’s face – well, it loses its charm”. H.W. Tilman brachte es 1948, also Jahrzehnte bevor R. Messner die Verwendung von Zusatzsauerstoff als „unsportlich“ verdammte, kurz und bündig auf den Punkt: “… oxygen use is not climbing by fair means” Heute würde man das wohl „Doping“ nennen.
Zeitweilig war die Verwendung von Zusatzsauerstoff so selbstverständlich geworden, dass niemand ernsthaft daran glaubte, dass Besteigungen von Achttausendern ohne diesen überhaupt möglich sein könnten – Herrn Kellas und die großen Höhen, die bereits Mallory und seine Kameraden erreicht hatten, hatte man offensichtlich vergessen. G. Pugh hält Tilman und anderen Sauerstoffgegnern 1957 als erster seine Vermutung entgegen, dass Zusatzsauerstoff die Sicherheit der Bergsteiger erhöhe – eine, wie oben dargestellt, bis heute nicht schlüssig bewiesene Vermutung.
Selten wird es so offen formuliert, aber bei vielen Menschen spielt offensichtlich auch eine Rolle, dass die Angst vor der Höhe oder vor einer Höhenkrankheit reduziert wird. Die Expeditionen in die hohen Berge sind viel einfacher geworden und die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs wird als größer angesehen. Aus diesem Grunde wagen sich aber auch Bergsteiger an diese Berge, die ohne zusätzlichen Sauerstoff nie an einer Expedition teilnehmen würden. Die Angst, an einem Berg zu sterben, ist um vieles reduziert worden.
In letzter Zeit wagen sich wieder weniger Alpinisten ohne zusätzlichen Sauerstoff an einen Achttausender. Die Höhe, in der zusätzlich Sauerstoff genommen wird, ist unterschiedlich. Mit der Kommerzialisierung der Expeditionen tragen Höhenträger die Sauerstoffflaschen in die Höhenlager und die Bergsteiger benützen sie, sobald sie das Gefühl haben, ohne sie nicht mehr weiterzukommen.
Es gibt die Ansicht, dass zusätzlicher Sauerstoff gleichzustellen mit Doping beim Radfahren, z. B. bei der Tour de France. Es erlaubt Amateuralpinisten, die eigentlich nichts in diesen Bergen zu suchen haben, Achttausender zu besteigen. Mit viel Geld ist eine Besteigung des Everest möglich. Aus eigener Erfahrung sind Personen bekannt, die 3–5 Versuche unternommen hatten und schlussendlich den Gipfel mit Höhenträgern, die alles getragen haben, und zusätzlichem Sauerstoff den Gipfel erreicht haben. Diese Art von Höhenbergsteigen stört natürlich diejenigen, die ein Bergsteigen „by fair means“ propagieren, und dies sind nicht nur die Spitzenbergsteiger. Das Interesse an den Achttausendern ist bei guten Alpinisten durch diese Entwicklung verloren gegangen. Darum werden von ihnen schwierige und neue Routen in allen Höhen vorgezogen. Bislang haben sich die führenden Personen und die internationalen Verbände noch nicht auf eine einheitliche Ansicht einigen können. Es ist jedoch zu beobachten, dass die Verwendung von Zusatzsauerstoff zunehmend als „nicht natürlicher Eingriff in den Körper zur Leistungssteigerung“ betrachtet wird, was also der Definition des Dopings entsprechen würde. Das Minimum, das von demjenigen zu fordern ist, der Sauerstoff verwendet, ist die Angabe „Besteigung mit Zusatzsauerstoff“. Das gebietet allein schon die sportliche Fairness. Über die Verwendung selbst muss jeder Bergsteiger letztlich ganz persönlich entscheiden.
Hinweis. O2-Flaschen werden bei ca. +20 °C gefüllt, aber z. B. bei –20 °C benutzt. Damit gilt das Boyle-Mariotte’sche Gesetz nicht uneingeschränkt, was vermeintliche „Leckagen“ der Ausrüstung erklärt. Dadurch stehen in der Höhe ca. 15 % weniger Druck zur Verfügung. Da die Systeme nicht temperaturkompensiert sind, wird das Gas etwa 15 % schneller abgelassen. Als Faustformel sollte man den Flascheninhalt um mindestens 10 % unterschätzen, um ein vorzeitiges Ende des Vorrats in extremer Höhe zu vermeiden (Windsor u. Milledge 2008).
Weiterführende Literatur
Huey RB, Eguskitza X: Supplemental oxygen and mountaineer death rates on Everest and K2. Jama 284(2): 181 (2000)
Küpper T, Schöffl V, Netzer NC. Cheyne Stoke Breathing at High Altitude – Benefit or Troublemaker? Sleep Breath 12(2): 123–127 (2008)
Küpper T, Schöffl V, Netzer N. Cheyne-Stoke-Atmung in der Höhe – eine sinnvolle Reaktion des Körpers oder eher Ursache für Störungen? Jahrbuch 2007 der Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin, Innsbruck, 2007, pp. 115–127
Windsor JS, Rodway GW. Supplemental oxygen and sleep at altitude. High Alt Med Biol 7: 307–309 (2006)
2.10 Hochlandvölker
T. Küpper
2.10.1 Geschichte und demografische Übersicht
Die Beschreibung und Untersuchung von Hochlandbewohnern ist aufgrund zahlreicher Faktoren auch hinsichtlich scheinbar banaler Studien hochgradig problematisch. In den meisten Fällen fehlt eine geeignete Vergleichsgruppe, denn ethnisch gleiche Personen, die aber im Flachland unter vergleichbaren Bedingungen (Ernährung, medizinische Versorgung, Sozialstruktur usw.) leben, sind praktisch nicht zu finden. Der Vergleich der verschiedenen Hochlandvölker wird zusätzlich massiv durch die unterschiedlich ausgeprägte Anpassung an die Höhe erschwert, denn derartige genetische Vorgänge werden unmittelbar dadurch beeinflusst, wie lange das jeweilige Volk in der Höhe lebt. Per definitionem bezeichnet man als Hochlandvölker diejenigen Populationen, die dauerhaft und über bereits mindestens mehrere Generationen in Höhen über 3000 m leben.
Man geht heute davon aus, dass von den drei am besten untersuchten Hochlandvölkern – Tibeter, Andenbewohner und Äthiopier (Abb. 2.25) – die Tibeter am längsten, nämlich etwa 50 000–100 000 Jahre, in der Höhe leben. So wurden beispielsweise in der Nähe von Lhasa steinzeitliche Funde gemacht. Die frühesten menschlichen Funde, deren Alter gesichert werden konnte, fanden sich in den Anden aus der Zeit vor etwa 20 000 Jahren bei Ayacucho (Peru, 2900 m). Ein 9500 Jahre altes Skelett wurde bei Lauricocha (Peru, 4200 m) gefunden, andere Funde aus dieser Gegend stammen sogar aus 6271 m, wobei es allerdings als gesichert angesehen wird, dass diese Höhe nie dauerhaft besiedelt war. Einige Fundorte, deren Alter noch nicht abschließend gesichert werden konnte, weisen darauf hin, dass die Besiedelung der Hochregionen der Anden eventuell bereits vor 30 000 Jahren begonnen hat.
Abb. 2.25: Geografische Verbreitung der Hochlandvölker der Erde
Bekanntlich stammt der Mensch aus Ostafrika und seine ersten Spuren hier sind mindestens 3 Millionen Jahre alt, nach anderen Quellen bis zu 6 Millionen Jahre (abhängig davon, welches Wesen man als ersten Menschen definiert). Das darf jedoch nicht zu dem Schluss verleiten, dass die Bewohner des Äthiopischen Hochlandes diejenigen sind, die am längsten in der Höhe leben und sich somit besonders gut adaptiert haben müssten. Die beiden Hauptgruppen der zahlreichen äthiopischen Völker, die die Hochebenen bewohnen, nämlich die Amharas und die Tigraeaner, sind erst etwa 1000 v Chr. aus dem südlichen arabischen Raum – einem Tiefland – eingewandert.
Hinweis. Viele westliche Touristen wissen nicht, dass im Himalaya inzwischen die meisten Träger keine Hochlandbewohner (Sherpas) sind. Diese Träger müssen sich genauso akklimatisieren wie die Touristen und haben aufgrund der Arbeits- und Lebensumstände manchmal sogar ein höheres Risiko für Höhenkrankheiten als die Touristen! Als Reisender sollte man darauf achten, dass die ausgewählte Agentur Mitglied der International Porter Protection Group (IPPG, www.ippg.net) ist und deren Richtlinien befolgt.
2.10.2 Schwangerschaft und kindliche Entwicklung
Alle Untersuchungen weisen darauf hin, dass sozioökonomische Faktoren für die meisten beobachteten Veränderungen wesentlich wichtiger sind als die Höhe und dass zwischen den drei genannten Volksgruppen spezifische Unterschiede beachtet werden müssen. Auch ist die primäre Datenlage oft durch einen Bias beeinflusst: So finden sich immer wieder Berichte über die angeblich besonders hohe Lebenserwartung der Hochlandvölker. Dies sollte mit großer Skepsis gesehen werden, denn einerseits fehlt in praktisch allen Fällen eine ausreichende Dokumentation des Geburtsdatums und andererseits bedeutet bei diesen Völkern im Gegensatz zu Europa ein hohes Alter ein hohes Sozialprestige. Somit sind die meisten Angaben, die die befragten Personen geben, deutlich zu hoch.
In Peru ist das Verhältnis neugeborener Mädchen zu Jungen in den Hochlagen deutlich größer als im Tal. In Nepal ist dies dagegen umgekehrt. Hier wird die Relation zwischen den Geschlechtern durch eine höhere Mortalität der Jungen und ein höheres Todesrisiko der Männer durch Unfälle ausgeglichen. Bereits den spanischen Eroberern fiel auf, dass die Fertilität sowohl ihrer Frauen – in Spanien alles Tieflandbewohnerinnen – als auch mitgebrachter Haustiere in einigen Städten Südamerikas deutlich reduziert war. So galt Jauja, die frühere Hauptstadt von Peru, unter den Conquistadores als „sterile Stadt“. Die Ursache liegt aller Wahrscheinlichkeit nach in einer massiv größeren Rate an Frühaborten innerhalb der ersten beiden Schwangerschaftswochen. Besonders gut dokumentiert und im Original erhalten sind die Berichte von La Calancha (1639) und Cobo (1653). Bereits hier wurde die Beobachtung gemacht, dass die Höhenanpassung der Ureinwohner von Vorteil war, denn während fast alle spanischen Kinder innerhalb weniger Wochen nach der Geburt starben (vermutlich an der subakuten Höhenkrankheit), überlebte ein deutlich größerer Anteil der Mischlingskinder und fast alle Kinder der Ureinwohner. Auch wurde die Beobachtung gemacht, dass die spanischen Kinder meist überleben, wenn die Schwangeren zur Geburt das Tiefland aufsuchen und dort bleiben, bis das Kind etwa ein Jahr alt ist. Diese Methode wird übrigens auch heute noch von den Frauen der Han-Chinesen, die in das Tibetische Hochland umgesiedelt worden sind, angewendet.
Ob die Fertilität der an die Hochregionen angepassten Völker tatsächlich geringer ist, ist trotz aufwändiger Studien nach wie vor unklar. So interpretieren auch Hoff und Abelson ihre Daten mit großer Vorsicht. Sie konnten in Peru zeigen, dass die Fertilität mit zunehmender Höhe linear abnimmt, aber auch sie sagen fairerweise, dass sie die möglicherweise beeinflussenden soziökonomischen Faktoren nicht vollständig unter Kontrolle hatten.
Ähnlich verhält es sich mit Studien zur Abortrate. Im Vergleich zum weltweiten Mittel von etwa 15 % liegt diese sowohl in den Anden (< 1 %) als auch in Äthiopien (9,1 %) deutlich niedriger. Allerdings kann dies durchaus eine Folge der bereits erwähnten höheren Rate an Frühaborten sein, die als solche nicht registriert wurden. Dies könnte auch mit Angaben von Hultgren korrespondieren, der allerdings zutreffend anmerkt, dass es sicherlich sehr schwierig ist, die allgemeine Versorgung der Schwangeren und die medizinische Infrastruktur als wesentlich ursächliche Faktoren abzugrenzen. Die medizinische Betreuung kann auch in folgendem Zusammenhang eine relevante Ursache für die Abortrate sein: Angerio berichtet von einer leicht erhöhten Inzidenz der Präeklampsie (Hypertonie) und bringt dies mit einer erhöhten Endothelinfreisetzung in Zusammenhang. Die Verminderung der Prostaglandine könnte ebenfalls eine mögliche Erklärung sein.
Das kindliche Wachstum ist bei Hochlandvölkern bereits intrauterin verzögert. Verschiedene Mechanismen führen hier jedoch dazu, dass die Sauerstoffversorgung des Föten optimiert wird. So ist das Plazentagewicht zwar nicht größer als im Tal, aber die Zahl der Villi und Kapillaren ist deutlich erhöht, was die Gasaustauschfläche vergrößert. Die Vili weisen außerdem eine dünnere Diffusionsbarriere auf. Die relativ kleinere Körpergröße der Föten verschiebt das Plazenta-Fötus-Verhältnis zugunsten der Plazenta. Alle diese Faktoren wirken hinsichtlich der Versorgungslage des Föten zusammen und sind vermutlich Resultat einer genetischen Adaptation. Die Folge ist naheliegenderweise ein vermindertes Geburtsgewicht. Von Cerro de Pasco (4300 m) wird ein mittleres Geburtsgewicht von 2,8 kg im Vergleich zu Lima (beide Peru) von 3,5 kg berichtet. Es wird diskutiert, ob diese Verringerung mit einer trotz erhöhter Uterusdurchblutung verminderten Umbilikalarteriendurchblutung zusammen hängt. So konnte an Tibeterinnen gezeigt werden, dass das Geburtsgewicht nicht mit der Sauerstoffsättigung, wohl aber mit dem Blutstrom der Umbilikalarterie in Zusammenhang steht. Dagegen spielt die fetale Seite offensichtlich keine wesentliche Rolle. Hier ist beispielsweise trotz höherer Blutviskosität durch höheren Hämatokrit und somit verlängerter Kreislaufzeit die Sauerstoffversorgung uneingeschränkt.
Auch die weitere kindliche Entwicklung verläuft langsamer, sei es das erste Sitzen oder Gehen, sei es Wachstum oder Menarche. Die Kinder von Quetchua-Indianern in Peru liegen bezüglich der Körpergröße etwa 2 Jahre hinter gleichaltrigen Kindern aus dem Tiefland, allerdings ist ihre Wachstumsphase deutlich länger und die endgültige Körpergröße wird erst mit 22 Jahren erreicht. Im Tien Shan (s. Abb. 2.25) beträgt der Unterschied etwa ein Jahr. Interessanterweise können derartige Unterschiede in Äthiopien nicht nachgewiesen werden. Gleiche Zeitunterschiede finden sich auch für die Menarche – allerdings wiederum nicht in Äthiopien. Derzeit geht man davon aus, dass die Höhe zwar ein unabhängiger Faktor für die fetale und kindliche Entwicklung ist, dass sozioökonomische Faktoren, insbesondere die Ernährung, aber wesentlich maßgeblicher sind und beobachtete Unterschiede durch die Verlängerung der Wachstumsperiode ansonsten weitgehend ausgeglichen werden.
2.10.3 Physiologische Veränderungen
Abhängig von der Art der Veränderung dauern diese Mechanismen Jahre bis hin zu vielen Generationen (Abb. 2.26). Während man diejenigen Mechanismen, die innerhalb einiger Monate ablaufen, noch als Akklimatisationsvorgänge betrachten kann, sind Vorgänge, die erst jenseits eines Vierteljahres stattfinden, echte Adaptationen, die im Laufe der Jahre auch genetisch fixierte und über die Generationen weitergegebene Veränderungen einschließen. Alle haben das gemeinsame Ziel, die Sauerstoffversorgung des Organismus unter den gegebenen Umständen zu optimieren.
Das Herz-Kreislauf-System zeigt charakteristische Unterschiede, abhängig davon, ob es sich um Neuankömmlinge bzw. Völker, die noch nicht allzu lange in großer Höhe leben, handelt oder um „echte“ Höhenvölker. Dabei wirken direkte wie indirekte Faktoren. Durch den Euler-Liljestrand-Mechanismus (hypoxische pulmonale Vasokonstriktion) erhöht sich der Druck im kleinen Kreislauf, was nicht nur bei Tieflandbewohnern, sondern auch bei Hochlandbewohnern der Anden zu rechtsventrikulärer Hypertrophie führt (Abb. 2.27). Damit das System diese hohen Drücke verkraften kann, bildet sich bei Kindern aus den Anden-Hochregionen die Muskulatur der Pulmonalarterien nicht nach der Geburt zurück, wie dies normalerweise der Fall wäre. Irgendein Vorteil dieser Vorgänge ist nicht denkbar. Daher sollten sie eher als Reaktion, denn als Anpassung gesehen werden. Ein normalerweise sinnvoller Vorgang, nämlich das Umlenken des Blutstroms von minderdurchbluteten Arealen der Lunge in solche mit guter Durchblutung durch den Euler-Liljestrand-Reflex, wird bei längerem Höhenaufenthalt eher zum Nachteil. Diese Probleme haben „echte“ Höhenvölker wie die Tibeter nicht. Sie haben sich über Hunderte von Generationen adaptiert und zeigen sowohl in Ruhe als auch unter Belastung einen allenfalls geringen Anstieg des Druckes im kleinen Kreislauf und eine etwa halb so große Inzidenz der rechtsventrikulären Hypertrophie (17 % vs. 29 % bei Han-Chinesen in Tibet). Aus Tierversuchen ist bekannt, dass es sich bei der hypoxischen pulmonalen Vasokonstriktion um eine echte genetische Veränderung und nicht nur um eine physiologische Adaptation handelt, die nach den Mendel‘schen Regeln autosomal-dominant vererbt wird.
Abb. 2.26: Zeiträume verschiedener Akklimatisations- und Adaptationsmechanismen (Daten aus Ward et al. 2000 und zahlreichen anderen Quellen). Der Hauptaktivitätsbereich des jeweiligen Mechanismus ist mit Rot angedeutet
Die maximale Herzfrequenz ist bei Tibetern im Gegensatz zu Andenbewohnern und Tieflandbewohnern in der Höhe nicht limitiert. Dies ist vermutlich dadurch erklärbar, dass sie in der Höhe keinen reduzierten Vagotonus aufweisen.
Über den größeren Thoraxumfang von Hochlandbewohnern wurde oft berichtet. Allerdings stellt sich dieses Merkmal bei genauer Betrachtung als relativ kleiner Unterschied zu Tieflandbewohnern gleicher Ethnie heraus: Die Steigerung der Vitalkapazität betrug im Mittel gerade einmal 300 ml. Für eine dauerhafte Höhenadaptation dürfte dies von marginaler Bedeutung sein, denn die Tibeter zeigen dieses Merkmal nicht und haben eine den Tieflandbewohnern vergleichbare Vitalkapazität. Allerdings könnte die größere totale Lungenkapazität der Andenbewohner, die vor allem auf einem erhöhten Residualvolumen beruht, für diese Population durchaus von Vorteil sein, denn hierdurch reduziert sich die Schwankungsbreite des pCO2 zwischen den jeweiligen Atemzügen und es ist für die Atemregulation folglich leichter, die bekannte Tendenz zu periodischer Atmung unter Kontrolle zu halten. Auch hier zeigt sich die längerfristige Adaptation der Himalayavölker an die Höhenhypoxie: Tibeter haben eine sehr hohe Diffusionskapazität und Sherpas weisen durch höheren pCO2 eine deutlich geringere Höhenalkalose auf. Dies ist ein Hinweis darauf, dass ihr Sauerstofftransport äußerst effektiv ist.
Abb. 2.27: Träger im Marsyangdi-Tal (Nepal). Diese Männer stammen aus dem Tiefland, sind allenfalls teilweise höhenakklimatisiert und haben ein den Touristen vergleichbares Risiko für Höhenzwischenfälle (Foto: T. Küpper)
Die Atmung und Atmungskontrolle ist in der Höhe ein außerordentlich labiles und kritisches Problem, nicht nur im Schlaf: Bereits Paul Bert beobachtete gegen Ende des 19. Jahrhunderts gesunde Personen, die im Wachzustand eine deutliche Periodik in der Atmung aufwiesen (Abb. 2.28). Im Laufe der Zeit ökonomisiert sich die Atmung, was sich unter anderem in einer Abnahme des Atemminutenvolumens in Ruhe um 12–15 % in 4000–4500 m Höhe zeigt. In Jahrzehnten dauernden Höhenaufenthaltes verschiebt sich die hypoxische Atemantwort (HVR) hin zu niedrigeren Werten. Bei Völkern, die schon sehr lange in der Höhe leben (Tibeter), ist dagegen die HVR sehr stabil und nimmt auch mit zunehmendem Alter praktisch nicht ab.
Bei den Andenbewohnern wurden oft sehr hohe Hämoglobinspiegel berichtet und diese dahingehend interpretiert, dass es sich hierbei um eine Langzeitadaptation handelt, die bei noch längerer Adaptationszeit (Tibeter, Sherpas) wieder verschwindet. Bei genauer Untersuchung waren aber offensichtlich in nennenswertem Umfang Personen mit chronischer Höhenkrankheit („Mong’s Disease“) in den Kollektiven. Bereinigt man die Kollektive, lässt sich der Unterschied nicht mehr darstellen. Trotzdem lassen sich Unterschiede zwischen den Aymara in den Anden und Tibetern bzw. Sherpas sichern: Die Südamerikaner haben etwa 4 g/dl höhere Hämoglobinspiegel. Offensichtlich ist der mit dem Hämoglobinanstieg verbundene Effekt der Konzentration von Sauerstoffträgern nur in der (relativ) akuten Phase der Höhenadaptation von Vorteil, während über die Zeit der damit verbundene Viskositätsanstieg eher von Nachteil ist. So interpretiert man heute den niedrigeren Hämoglobinwert der Tibeter als Zeichen der Langzeitadaptation. An tibetischen Frauen, die in etwa 5000 m lebten, konnte als Beweis dieser These gezeigt werden, dass die Sauerstoffsättigung im Wesentlichen von einem einzigen Gen abhängig war. Dies konnte bei Andenbewohnern nicht gefunden werden.
Es soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass trotz über 30 000 Jahre erfolgter Höhenadaptation in Tibet eine vollständige Adaptation in dem Sinne, dass der Organismus die Höhe absolut und schädigungsfrei akzeptiert, offensichtlich noch nicht erfolgt ist. Bereits in der Fötalphase treten mit erhöhter Inzidenz Schädigungen auf (kraniofaziale Defekte, Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, Analatresie und andere). Vermutlich weil unmittelbar nach der Geburt der Sauerstoffpartialdruck nicht in dem Maße ansteigt, wie im Tiefland, also die Resistance der Pulmonalgefäße nicht entsprechend gemindert wird, besteht eine höhere Inzidenz für persistierenden Ductus arteriosus Botalli. Diese Inzidenz ist eindeutig höhenabhängig und besonders groß bei Tieflandbewohnern, die in Hochregionen umsiedeln (Han-Chinesen in Tibet: 2,5 %).
Die hohe Inzidenz der chronischen Bronchitis und der chronisch-obstruktiven Bronchialerkrankung (COPD) insbesondere im Himalaya und in Tibet (22,9 %!) ist dagegen nicht der Höhe, sondern den sozialen Umständen zuzuschreiben, neben dem Rauchen insbesondere auch dem ständigen Kochen und Heizen mit offenem Feuer in engen, schlecht belüfteten Räumen. Problematisch ist die recht hohe Rate an Komplikationen (5–12 % Lungenemphysem, 1 % Cor pulmonale). Ähnlich höhenunabhängig dürfte auch die niedrige Rate an Arteriosklerosen und Myokardinfarkten der Hochlandbewohner sein. Ebenfalls sozioökonomische Umstände dürften hauptverantwortlich für die niedrigen Cholesterinspiegel in Bhutan, bei Sherpas und Tibetern sein. Eindeutig mit den sozialen Umständen hängt das nahezu ausschließlich in den Himalayaländern vorkommende Kangri-Karzinom zusammen. Hierbei handelt es sich um ein spinozellluläres Plattenepithelkarzinom der Bauchdecke auf dem Boden einer geschwürigen verbrennungsbedingten Narbe. Ursächlich kommt im Kaschmir das unter der Kleidung getragene Holzkohleöfchen in Frage („kangri“ = Feuerkorb), in anderen Gegenden, dass man ganz dicht an einem Feuer oder einer anderen Wärmequelle schläft („kang“ = Ofen).
Abb. 2.28: Erste Messung der höhenbedingten Cheyne-Stokes-Atmung durch A. Mosso auf der Margheritahütten-Expedition 1894 mit der in Abb. 1.4 dargestellten Messapparatur (aus: Mosso 1899)
Hinsichtlich der arteriellen Hypertonie ist die Lage deutlich unübersichtlicher. Zunächst einmal ist die Inzidenz bei Hochlandbewohnern generell niedrig. Allerdings finden sich deutliche Unterschiede. Die sehr geringe Rate bei der Andenbevölkerung beruht höchstwahrscheinlich auf der traditionellen Ernährung und dem Lebensstil. Bei Sherpas und bei der Bevölkerung im Tien Shan und Pamir ist arterielle Hypertonie praktisch unbekannt, während sie bei den dazwischen wohnenden Tibetern bei etwa 4 % der erwachsenen Bevölkerung diagnostiziert werden kann. Eine leicht erhöhte Inzidenz findet sich auch bei männlichen Bewohnern des äthiopischen Hochlandes. Vermutlich spielt die Salzaufnahme der Tibeter dabei eine wesentliche Rolle, denn sie gehört mit bis zu 1 kg pro Monat zu den höchsten der Welt. Hauptquelle für diese exorbitante Menge ist der Buttertee, der jederzeit und in größeren Mengen getrunken wird und der in Tibet im Gegensatz zu Bhutan, Tien Shan oder dem Sherpaland gesalzen ist (in den letztgenannten Gegenden wird allenfalls etwas gesalzen). Die Ursache der erhöhten Inzidenz in Äthiopien ist dagegen unklar.
Ansonsten eine absolute Rarität, so ist der Karotisgabeltumor (Chemodektom, Paraganglion, chromaffiner Tumor) relativ häufig bei der Hochlandbevölkerung der Anden (in Tibet und bei Sherpas besteht keine erhöhte Inzidenz). Chronische Hypoxie führt zu einer Hypertrophie des Glomus caroticum auf etwa die dreifache Masse, wofür vor allem die Typ-II-Zellen verantwortlich sind. Auf dieser Basis entwickelt sich offensichtlich in einem Teil der Fälle der gutartige Tumor, der öfter bei Frauen als bei Männern vorkommt. Ein Zusammenhang mit bösartigen Tumoren wurde bislang nicht gefunden.
Gerade für reisende Ärzte, die unterwegs gelegentlich Einheimische behandeln, muss darauf hingewiesen werden, dass die Keimzahl in großer Höhe zwar relativ gering ist, aber dass in Einzelfällen mit einer erhöhten Zahl an Resistenzen zu rechnen ist. Beides beruht vermutlich auf der Selektion durch UV-Licht. Atemwegserkrankungen können in Tibet jedoch nach wie vor gut mit Penicillin behandelt werden, was aufgrund der hohen Resistenz in westlichen Ländern nur bedingt sinnvoll ist.
2.10.4 „Re-Akklimatisation“ nach vorübergehendem Tieflandaufenthalt
Immer wieder kommt es vor, dass Hochlandbewohner tiefe Regionen aufsuchen und dort längere Zeit verweilen, sei es zur Arbeit oder zu Verwandtenbesuch. Auch wenn Details zum zeitlichen Ablauf noch völlig unbekannt sind, so ist unumstritten, dass sie, abhängig von der Aufenthaltsdauer, dabei einen Teil ihrer Höhenadaptation verlieren und sich beim erneuten Aufsuchen der Höhe entsprechend akklimatisieren müssen. Besonders drastisch fällt dies beim „re-entry pulmonary oedema“ auf, das insbesondere Kinder von Hochlandbewohnern nach Aufenthalt in tiefen Lagen betrifft (Abb. 2.29): Während die Inzidenz des HAPE bei Tieflandbewohnern unabhängig vom Alter ähnlich ist und primär vom Höhenprofil abhängt, haben die Kinder von Hochlandbewohnern bei der Rückkehr in die Höhe aus noch nicht ganz geklärten Gründen ein im Vergleich zu ihren Eltern deutlich erhöhtes Ödemrisiko. Details sind aus methodischen Gründen noch nicht geklärt, beispielsweise ist der Anteil bzw. Einfluss von Confoundern wie gleichzeitig bestehende Herz- oder Lungenerkrankungen und insbesondere akute Atemwegsinfekte als möglicher Triggermechanismus noch unzureichend untersucht. Offensichtlich handelt es sich auch hier um ein vor allem die Andenhochlandbevölkerung betreffendes Problem, wenn es auch in Einzelfällen bei Tibetern (Kinder wie Erwachsene) beschrieben wurde.
Abb. 2.29: Hochlandbewohner in Peru besuchen einen Markt im Tiefland (Quetchua oder Aimara) (Foto: U. Gieseler)
Die chronische Höhenkrankheit („Mong’s disease“) könnte ein Wegbereiter für das Re-entry-HAPE sein, insbesondere in Kombination mit körperlicher Anstrengung. Um ein nennenswert erhöhtes Risiko zu haben, muss eine Mindestzeit in niedriger Höhe verbracht werden. So hielten sich in einer größeren Studie in Peru nur 10,5 % der Patienten mit Re-entry-HAPE weniger als 7 Tage im Tiefland auf. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass das Risiko bei Kindern offensichtlich schon nach 3–5 Tagen Tieflandaufenthalt steigt. Weder klinisch noch therapeutisch finden sich Unterschiede zum „normalen“ HAPE.